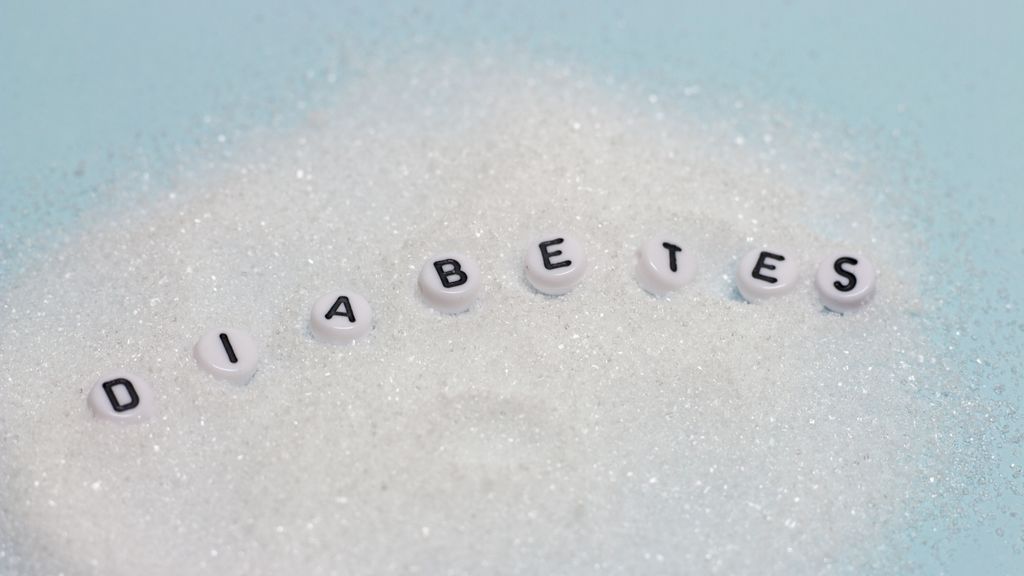
©
Getty Images/iStockphoto
„Patienten und Behandler können sich auf einiges freuen“
Jatros
30
Min. Lesezeit
13.11.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die HARMONY- und die PIONEER-Studie waren die beiden meistdiskutierten Highlights des EASD. Prof. Julia Mader, Graz, erklärt im Gespräch, warum. Außerdem gab es spannende Präsentationen zu technologischen Entwicklungen. Große Erwartungen setzen Patienten und Behandler in die ersten kommerziellen Bauchspeicheldrüsensysteme, die bald erwartet werden. Und eine praktische Studie aus Graz dazu, wie sich Sport und Diabetes Typ 1 besser vereinbaren lassen, war ebenfalls Thema des Interviews.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Sehr geehrte Frau Prof. Mader, wenn Sie den diesjährigen EASD-Kongress Revue passieren lassen, welches waren für Sie die wichtigsten Studien oder Präsentationen?</strong></p> <p><strong>J. Mader:</strong> Eines der Highlights war sicher die Präsentation der HARMONYOUTCOME- Studie. Diese doppelblinde, randomisierte Studie untersuchte den Einsatz von Albiglutid, einem GLP-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA), bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und vorbestehenden kardiovaskulären Erkrankungen. Die Patienten wurden 1:1 in zwei Gruppen geteilt und erhielten zusätzlich zur vorbestehenden antidiabetischen Therapie Albiglutid (n=4731) vs. Placebo (n=4732). Die Behandlung lief über 4 Jahre. Beide Studienarme waren sehr gut gematcht hinsichtlich Alter, Geschlechterverteilung, Diabetesdauer und HbA1c. Es zeigte sich eine 22 % ige Risikoreduktion hinsichtlich des kombinierten Endpunkts an kardiovaskulären Ereignissen (3-Punkte-MACE) im Albiglutid- Arm, in dem 4,75 Events pro 100 Patientenjahre auftraten, im Vergleich zu Placebo, in dem sich 5,87 Events pro 100 Patientenjahre ereigneten. Somit konnte ein weiterer GLP-1-RA einen positiven kardiovaskulären Effekt zeigen. Soweit zu hören war, ist eine Einführung in den europäischen Markt derzeit allerdings nicht geplant. Aber möglicherweise ändert sich dies ja.<br /> GLP-1-RA werden subkutan verabreicht. Wir wissen von einigen Patienten, dass sie auch den bestmöglichen subkutanen Applikationsformen reserviert bis ablehnend gegenüberstehen, daher gibt es Bestrebungen, GLP-1-RA auch oral verfügbar zu entwickeln. Aufgrund der Größe des Moleküls und seiner Empfindlichkeit gegenüber Enzymen ist dies jedoch nicht so einfach zu bewerkstelligen. Im Rahmen des PIONEER-Studienprogramms wurde Semaglutid als oraler GLP-1-RA mit SNAC (Sodium N-(8-[2- hydroxybenzoyl]amino)caprylat) versetzt und getestet. Semaglutid wird dadurch nicht so schnell enzymatisch abgebaut und ist daher auch ausreichend bioverfügbar. In der PIONEER-1-Studie wurden Patienten in frühen Stadien des Typ- 2-Diabetes (Ausgangs-HbA<sub>1c</sub> 8,0 % bei allen Gruppen) mit oralem Semaglutid (in unterschiedlichen Dosierungen) im Vergleich zu Placebo behandelt. Jede Gruppe umfasste ca. 175 Teilnehmer. Am Ende der 26-wöchigen Behandlungsphase zeigte sich in allen drei Dosierungsstufen ein niedrigerer HbA<sub>1c</sub> (6,5– 7,0 % ) im Vergleich zu Placebo (7,6 % ). Der größte Effekt auf das Körpergewicht war bei der höchsten Semaglutid-Dosierung von 14mg (–4,0kg) zu beobachten, wohingegen es im Placebo-Arm lediglich zu einer Reduktion um 1,4kg kam. Diese war vergleichbar mit der Dosierung von Semaglutid 3mg, bei der es zu einer Reduktion um 1,5kg kam. Eine orale Darreichungsform mit einer der subkutanen Gabe vergleichbaren Wirksamkeit würde die Therapieoptionen natürlich erweitern.</p> <p><strong>Es wurde eine Reihe von Möglichkeiten präsentiert, die die Insulintherapie bei Typ-1-Diabetes ergänzen. Wie sehen Sie die Optionen?</strong></p> <p><strong>J. Mader:</strong> Seit längerer Zeit bestehen Überlegungen, die Insulintherapie bei Typ-1-Diabetes durch andere Agenzien zu ergänzen. Durch Einsatz dieser ergänzenden Therapien besteht die Hoffnung, Blutzuckerspitzen zu minimieren, die Insulindosis zu reduzieren und damit eine geringere Gewichtszunahme und ein niedrigeres Hypoglykämierisiko zu erzielen. Allerdings gibt es dabei auch eine wesentliche Forderung an diese Agenzien, nämlich neben der Verbesserung der glykämischen Kontrolle auch potenzielle Risiken abzuwägen. In diesem Hinblick wurden in der Vergangenheit unter anderem Metformin, DPP- 4-Hemmer, GLP-1-RA und Pramlimatid untersucht. In der letzten Zeit fokussierte sich die Forschung auf den ergänzenden Effekt von SGLT-2-Hemmern bei Patienten mit Typ-1-Diabetes. Bei SGLT- 2-Hemmern besteht ein gewisses Risiko für das Auftreten von Ketoazidosen, welches durch eine möglichst niedrige SGLT-2-Hemmerdosis etwas reduziert werden kann. Im Rahmen des EASE-Programmes wurde der Einsatz von SGLT- 2-Hemmern in unterschiedlichen Dosierungen bei Patienten mit Typ-1-Diabetes und Typ-2-Diabetes getestet. Als Fortsetzung befassen sich das EASE-2-Programm und das EASE-3-Programm mit der Anwendung von Empagliflozin in niedriger Dosierung bei Typ-1-Diabetes. Dabei wird die Sicherheit von Empagliflozin 2,5mg, Empagliflozin 10mg und Empagliflozin 25mg gegenüber Placebo untersucht. Ein spezieller Fokus liegt dabei wie gesagt auf dem Auftreten von Ketoazidosen und schweren Hypoglykämien. Die beiden randomisierten, kontrollierten Studien haben ein ähnliches Design. Die Studien wurden in 28 Ländern durchgeführt, wobei EASE-2 eine Studiendauer von 26 Wochen mit ca. 720 Studienteilnehmern aufwies und EASE-3 eine Studiendauer von 52 Wochen mit ca. 960 Studienteilnehmern hatte, wobei auch eine 2,5mg-Dosierung eingesetzt wurde. Ergänzend wurde in einer Untergruppe an Patienten auch eine kontinuierliche Glukosemessung durchgeführt. Primärer Studienendpunkt war HbA<sub>1c</sub> zum Zeitpunkt nach 26 Wochen. Bei EASE-2 konnte der HbA<sub>1c</sub> in beiden untersuchten Dosierungen Empagliflozin vs. Placebo zu Woche 26 um 0,5 % gesenkt werden. Dieser Effekt war auch nach 52 Wochen noch erhalten. Bei der 2,5mg-Dosierung von EASE-3 konnte eine HbA<sub>1c</sub>-Reduktion um 0,3 % zu Woche 26 im Vergleich zu Placebo erzielt werden; die beiden höheren Empagliflozin- Dosierungen erzielten wie in EASE-2 eine HbA<sub>1c</sub>-Reduktion von 0,5 % . Die größte HbA<sub>1c</sub>-Reduktion konnte bei den Patienten mit den höchsten HbA1c-Ausgangswerten erzielt werden. Gleichzeitig konnte eine Reduktion des Körpergewichts von knapp 3kg in den Gruppen mit den höheren Dosierungen und von knapp 2kg in der 2,5mg-Gruppe in der Woche 26 im Vergleich zu Placebo beobachtet werden. Es zeigte sich auch, dass bis zu 13 % der Insulindosis unter Empagliflozin-Behandlung eingespart werden konnten, in der 2,5mg-Gruppe immerhin 6 % . In der Gruppe mit kontinuierlicher Glukosemessung erhöhte sich die Zeit im Zielbereich von 50 % auf 60 % . Das Sicherheitsprofil zeigte sich hinsichtlich urogenitaler Infekte und Hypovolämie vergleichbar mit dem, das bereits bei Typ-2-Diabetes bekannt war, wobei das Risiko bei der Gruppe mit der 2,5mg-Dosierung im Vergleich geringer war. Das Ketoazidoserisiko war insgesamt erhöht und vergleichbar mit dem anderer SGLT-2-Hemmer-Anwendungen bei Typ-1-Diabetes. Im Vergleich zu den höheren Dosierungsgruppen war das Kezoazidoserisiko bei der Gruppe mit 2,5mg geringer. Das Nutzen-Risiko-Profil muss natürlich mit den Patienten besprochen werden.</p> <p><strong>Kommen wir zu technologischen Entwicklungen. Zu welchen Devices wurden die spannendsten Neuerungen gezeigt?</strong></p> <p><strong>J. Mader:</strong> Spannend war beispielsweise eine Neuerung, die darauf abzielt, Hypoglykämien zu vermeiden. In der PROLOG-Studie untersuchten Buckingham et al. den Effekt der Umstellung von Patienten mit Insulintherapie (Pumpe oder Pen) auf ein kombiniertes Insulinpumpen- CGM-System mit prädiktiver Hypoglykämieabschaltung (t:slim X2 Insulinpumpe mit DexcomG6 Sensor und Basal-IQ-Technologie). Die Patienten verwendeten für jeweils 3 Wochen in einem Cross-over-Design eine sensorunterstützte Pumpentherapie oder das System mit prädiktiver Hypoglykämieabschaltung. Unter Verwendung der prädiktiven Hypoglykämieabschaltung konnte die Zeit in der Hypoglykämie um 30 % reduziert werden, während die mittlere Sensorglukose in beiden Gruppen gleich war (je 159mg/dl). Die Zeit im Zielbereich erhöhte sich unter prädiktiver Hypoglykämieabschaltung nur leicht (3 % ). Pro Tag kam es zu 5,7 ± 4,3 Abschaltungen mit einer mittleren Dauer von 18 Minuten. Dabei kam es auch zu einer Reduktion der Basalinsulindosis von 21,5 U/ Tag vs. 20,3 U/Tag. Der Usability Score von 88,8/100 zeigt, dass die Teilnehmer das System einfach in der Anwendung fanden und darüber hinaus waren sie auch mit dem System zufrieden.<br /> Eine weitere interessante Arbeit präsentierten Chernavvsky et al. Diese untersuchten die Anwendbarkeit einer künstlichen Bauchspeicheldrüse bei Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren mit Typ-1-Diabetes während eines Ski-Camps. Es wurde die sensorunterstützte Pumpentherapie vs. Control IQ, das Closed-Loop-System von Tandem Diabetes, getestet. Die Auswertung ergab, dass sich die Zeit in der Normoglykämie mit 55,4 % unter Control IQ vs. 73,1 % bei der sensorunterstützten Pumpentherapie signifikant erhöht hatte (p=0,032). Gleichzeitig reduzierte sich die Zeit in der Hyperglykämie (>180mg/dl) auf 41 % vs. 21,6 % , p=0,026. Auch die mittlere Blutglukose war bei Control IQ deutlich niedriger: 141 vs. 169mg/dl (p=0,03). Insgesamt konnte die künstliche Bauchspeicheldrüse bei den Jugendlichen sicher angewandt werden. Und auch hier war das Patientenfeedback positiv.<br /> Johnson et al. untersuchten bei 278 insulinpflichtigen Patienten mit Typ- 2-Diabetes und einem HbA<sub>1c</sub> >58mmol/ mol die Effektivität einer Insulinbolusgabe mittels Calibra Patch vs. Abgabe mittels eines Insulinpens unter Verwendung eines Insulintitrationsalgorithmus. Zur Therapieüberwachung verwendete eine Subgruppe an Patienten verblindet eine kontinuierliche Glukosemessung. Es zeigte sich in der Woche 24 eine signifikante Verbesserung der Blutzuckereinstellung in beiden Gruppen. Zwischen den beiden Gruppen gab es sich jedoch keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich HbA<sub>1c</sub> oder CGM-basierten Parametern (bei dem Subset der CGMUser). Offenbar ist die Hürde multiple Injektionen eine geringere Barriere als vermutet und zudem kann mittels eines guten Algorithmus mit beiden Abgabemethoden eine zufriedenstellende Einstellung erreicht werden.<br /> Bally et al. berichten über die erste Anwendung eines kompletten Closedloop- Systems ohne Mahlzeitenbolus bei hospitalisierten Patienten mit Typ-2-Diabetes und Hämodialyse. In die Studie wurden 19 Patienten eingeschlossen und über 15 Tage behandelt. 10 Patienten wurden in die Closed-loop-Gruppe randomisiert und 9 einer subkutanen Insulintherapie laut lokalen Vorgaben zugewiesen. Die Zeit im Zielbereich konnte im Vergleich zur Standardtherapie um knapp 40 % erhöht werden. In keiner der Gruppen kam es zu einer schweren Hypoglykämie oder Ketoazidose.</p> <p><strong>Worin bestehen die Innovationen und wie werden diese die Arbeit künftig beeinflussen? Welche Vorteile sehen Sie für die Patienten?</strong></p> <p><strong>J. Mader:</strong> Große Erwartungen setzen Patienten und Behandler sicher in die ersten kommerziellen Bauchspeicheldrüsensysteme. Nachdem nun beide Systeme (Control IQ von Tandem Diabetes Care, MiniMed 670G von Medtronic) die EU-Zulassung erhalten haben, sollen die Systeme im Lauf des nächsten Jahres auch den Weg auf den österreichischen Markt schaffen. Diese Systeme haben sicherlich das Potenzial, eine deutliche Verbesserung der Blutglukoseeinstellung bei gleichzeitiger Reduktion von Hypoglykämien zu erreichen. Wie allerdings in weiterer Folge die Erstattung durch Kassen gestaltet sein wird, ist letztlich noch nicht geklärt. Ich hoffe, die Indikationsstellung bleibt dieselbe wie für die Erstattung von CGM-Systemen. Weitere Verbesserungen sind auch bei den CGMSystemen an sich zu beobachten, die deutlich an Genauigkeit zugelegt haben. Zusätzlich wird auch Kalibrationsfreiheit immer mehr zum Thema, was einerseits das für viele Patienten lästige Fingerstechen wegfallen lässt und andererseits zu einer Verbesserung der Signalgenauigkeit beigetragen hat, da die Verwendung von schlechten Kalibrationszeitpunkten oder schlechten Kalibrationswerten (verunreinigter Finger, schlechter Messwert vom Blutzuckermessgerät) das Signal sehr beeinträchtigen kann.<br /> Zum Flash-Glukosemesssystem, dem FreeStyle-Libre, wurden einige Neuerungen präsentiert, über die zum Teil in einem eigenen Artikel im Journal berichtet wird.</p> <p><strong>Abgesehen von den eben besprochenen technologischen Entwicklungen: Was würden Sie morgen selbst in Ihre tägliche Praxis einbauen bzw. was haben Sie schon eingebaut?</strong></p> <p><strong>J. Mader:</strong> Eine sehr praxisorientierte Arbeit entstand aus der Arbeitsgruppe meines Kollegen Prof. Harald Sourij, in der er gemeinsam mit Sportwissenschaftlern untersuchte, wie eine Insulindosisanpassung von Insulin Degludec bei Sport erfolgen soll. Bisher wurde eine Reduktion der Bolusinsulindosis rund um den Zeitraum einer sportlichen Aktivität empfohlen. Jedoch ist auch eine unzureichende Basalinsulinanpassung bei Sport mit Hypoglykämien assoziiert. In der aktuellen Studie wurde bei Patienten mit Typ-1-Diabetes eine zwischenzeitliche Dosisanpassung von Insulin Degludec bei sportlicher Aktivität an fünf Tagen hintereinander mit mittlerer Intensität getestet. In der Studie konnte gezeigt werden, dass eine 25 % ige Reduktion der Basalinsulindosis bei körperlicher Aktivität an aufeinanderfolgenden Tagen, wie beispielsweise während einer Ski- oder Sportwoche, sinnvoll ist, um Hypoglykämien zu vermeiden.</p> <p><br /><strong><em>Vielen Dank für das Gespräch!</em></strong></p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten
Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


