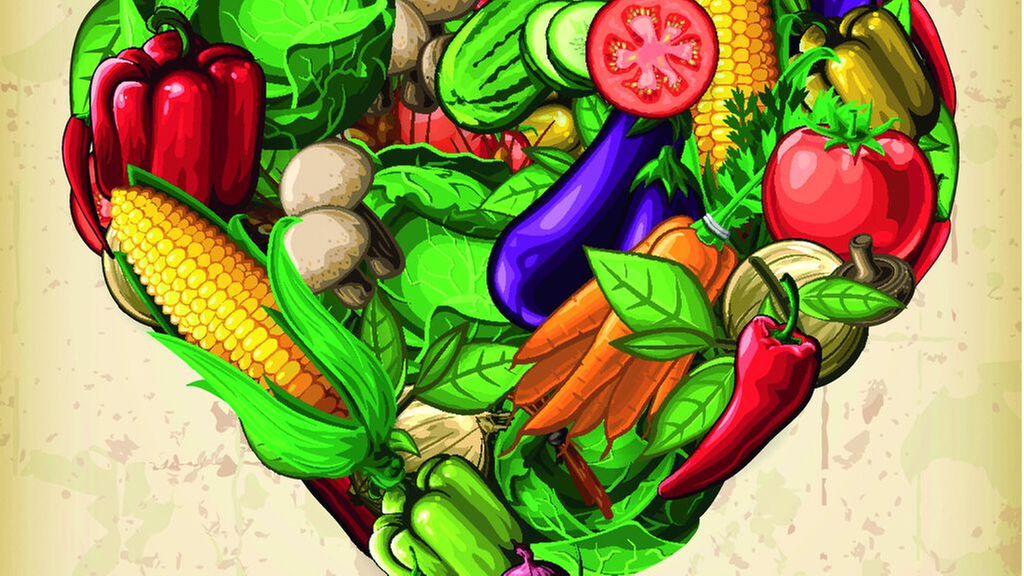
©
Getty Images
Kopfschmerzen und Hyponatriämie
Jatros
Autor:
Ass. Dr. Christoph Schrangl
1. Medizinische Abteilung<br> Krankenanstalt Rudolfstiftung, Wien<br> E-Mail: christoph.schrangl@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
11.07.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ein älterer Patient kam nach einem Urlaub, in dem sich bereits eine schwere Symptomatik zeigte, zu uns in die Rudolfstiftung. Der Fallbericht zu diesem Patienten zeigt einen Ausfall aller hormonellen Achsen des Hypophysenvorderlappens sowie die Diagnostik und Therapie.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <ul> <li>Eine adäquate Hydrokortisonsubstitution soll bei entsprechendem Verdacht unverzüglich erfolgen. Eine laborchemische Bestätigung darf diese nicht verzögern.</li> <li>Bei Hypokortisolismus sind eine Schulung des Patienten sowie die Aushändigung eines Notfallausweises wesentlich. Eine Aufklärung soll insbesondere das Verhalten in Notfallsituationen und bei Infekten, Operationen und anderen Stresssituationen abdecken.</li> <li>Typischerweise kommt es oft zuerst zum Ausfall von Wachstumshormon gefolgt von der gonado- und thyreotropen Achse und zuletzt von der kortikotropen Achse.</li> </ul> </ul> </div> <h2>Patientenvorstellung in der Notaufnahme</h2> <p>Im Februar 2019 wurde ein 80-jähriger Patient bei uns im Krankenhaus Rudolfstiftung in der zentralen Notaufnahme vorstellig. Grund dafür waren starke Kopfschmerzen, Doppelbilder sowie Erbrechen. Diese Symptome bestanden seit ungefähr 10 Tagen und hatten im Urlaub auf Teneriffa begonnen. Der Patient hatte deshalb bereits vor Ort mehrere Spitäler aufgesucht. Im Rahmen dieser Besuche wurden eine kraniale Computertomografie (cCT), Laboruntersuchungen sowie eine Lumbalpunktion durchgeführt. Eine Erklärung für die Beschwerden konnte</p> <p>Klinisch präsentierte sich der Patient in leicht reduziertem Allgemeinzustand mit einem Blutdruck von 120/50 mmHg und einer Herzfrequenz von 70/min. Im internistischen Status war ein 4/6-Systolikum mit p. m. im 4. ICR links parasternal bemerkenswert, ansonsten ergaben sich, abgesehen von Exsikkosezeichen, Normalbefunde. Laborchemisch zeigten sich in der ZNA ein akutes Nierenversagen mit einem Serumkreatinin von 3,5 mg/dl (Referenzbereich: 0,7 bis 1,2 mg/dl), eine kombinierte Elektrolytstörung mit einer Hyponatriämie von 122 mmol/l (136 bis 145 mmol/l) und einer Hyperkaliämie mit einem Serum- Kalium von 5,0 mmol/l (3,4 bis 4,5 mmol/l) sowie eine metabolische Azidose mit einem pH-Wert von 7,30 und einem „base excess“ von –2,6 mmol/l (–1,5 bis 3 mmol/l). Ansonsten war das Akutlabor weitestgehend unauffällig. Weiterführend erfolgte noch eine neurologische Begutachtung. Paresen der äußeren Augenmuskeln, links ausgeprägter als rechts, konnten bei fingerperimetrisch erhaltenem Gesichtsfeld festgestellt werden. Zum Ausschluss eines Insultes wurde in weiterer Folge eine kraniale MRT durchgeführt. In dieser fand sich eine ausgedehnte Raumforderung im Bereich der Sella turcica.</p> <h2>Aufnahme an der endokrinologischen Abteilung</h2> <p>In der Zusammenschau dieser Befunde entschloss man sich zur Aufnahme an der endokrinologischen Abteilung. Die oben genannten Elektrolytstörungen (Hyponatriämie, Hyperkaliämie), die metabolische Azidose gemeinsam mit dem grenzwertig niedrigen Blutdruck sowie die klinische Präsentation mit Übelkeit und Erbrechen legten den Verdacht eines Kortisolmangels nahe. Entsprechend wurde Hydrokortison als Bolus sowie anschließend als Dauerinfusion verabreicht. Eine laborchemische Bestätigung war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, vor Infusionsbeginn wurde jedoch Blut zur Kortisolbestimmung abgenommen. Die Auswertung am nächsten Morgen zeigte eine niedrige Serumkonzentration von Kortisol (2,72 μg/dl l; Normbereich je nach Tageszeit 2,68 bis 18,4 μg/dl) und bestätigte so die Verdachtsdiagnose. Insbesondere in Anbetracht der Stresssituation wären deutlich höhere Werte physiologisch.</p> <p>Die Hyperkaliämie sowie die metabolische Azidose wurden zum Teil auch durch das akute Nierenversagen mitverursacht. Sonografisch wurde eine postrenale Ursache ausgeschlossen. Auch in weiteren Untersuchungen zeigte sich kein Hinweis auf eine spezifische Ursache, sodass von einem prärenalen Nierenversagen im Rahmen einer Exsikkose durch das Erbrechen ausgegangen werden konnte. Passend dazu kam es zu einer Besserung der Nierenfunktion nach Flüssigkeitssubstitution.</p> <p>Ebenso konnte am nächsten Tag eine weiterführende hormonelle Diagnostik durchgeführt werden. Hierbei zeigten sich Ausfälle mehrerer hormoneller Achsen: Zum einen fiel eine Hypothyreose mit sowohl vermindertem fT3 und fT4 als auch mit einem verminderten TSH auf. Diese Befunde können als zentrale (sekundäre) Hypothyreose interpretiert werden. Zum anderen war auch die gonadotrope Achse ausgefallen: LH und Testosteron waren unter der Nachweisgrenze. Zu diesen Befunden passend zeigte sich auch ein verminderter Prolaktinspiegel, dadurch konnte auch gleichzeitig das Vorliegen eines Prolaktinoms ausgeschlossen werden. Das ACTH war im Normbereich, eine Interpretation dieser Tatsache unter laufender Substitution zum einen und in der Stresssituation zum anderen ist jedoch schwierig. Die somatotrope Achse (hGH-Stimulation und IGF-ISpiegel, ev. Indikation zur Wachstumshormonsubstitution) wird im Rahmen von ambulanten Nachkontrollen (postoperativ) in unserer Hormonambulanz abgeklärt.</p> <h2>Therapie</h2> <p>Nach dem Start einer Kortisoltherapie wurde auch mit einer Thyroxinsubstitution begonnen. Eine Testosteronsubstitution wurde dem Patienten angeboten, allerdings von diesem nicht gewünscht. Unter der parenteralen Glukokortikoidgabe besserte sich der klinische Zustand des Patienten rasch. Der Elektrolyt- und Säure-Basen-Haushalt war im Laborbefund wieder ausgeglichen. Unter diesen Voraussetzungen wurde auf eine orale Gabe (zuerst 40 mg Hydrokortison pro Tag, im Verlauf Reduktion auf 30 mg/die) umgestellt.</p> <p>Zur ätiologischen Zuordnung sowie zur Planung der weiteren Therapie wurde anschließend eine gezielte MRT der Hypophyse durchgeführt. Hierbei zeigte sich eine ca. 2 cm im Durchmesser haltende Raumforderung mit Verlagerung des Hypophysenstiels nach rechts. Das Chiasma opticum war nicht tangiert. Noch im Rahmen des stationären Aufenthalts wurde eine Gesichtsfelduntersuchung durchgeführt. Auf eine bitemporale Hemianopsie gab es, im Einklang mit dem MRT-Befund, keinen Hinweis. Im weiteren Verlauf wird eine transsphenoidale Exstirpation der Raumforderung durch die neurochirurgische Abteilung geplant. Zum Entlassungszeitpunkt blieb unklar, ob der Ausfall des Hypophysenvorderlappens aufgrund eines verdrängenden Wachstums der Raumforderung oder wegen einer Ischämie entstanden ist. Ein Hypophysenapoplex wäre mit der Klinik des plötzlich einsetzenden Kopfschmerzes gut vereinbar. Ein Hypophysenstimulationstest wurde aufgrund der eindeutigen klinischen Präsentation nicht durchgeführt und ist postoperativ geplant.</p> <h2>Hypophysenvorderlappen- Insuffizienz</h2> <p>Eine Insuffizienz des Hypophysenvorderlappens ist zumeist das Resultat eines Adenoms der Hypophyse. Als weitere Ursachen kommen Blutungen, Apoplexe, Traumata oder Infektionen infrage. Adenome sind zu ca. 40 % hormonell inaktiv, zu 40 % liegt ein Prolaktinom vor, der restliche Anteil von 20 % geht auf andere hormonell aktive Tumoren zurück. Zu einem signifikanten Ausfall der Hormonproduktion kommt es erst nach Zerstörung von mehr als 80 % der Zellen. Betroffen ist typischerweise zuerst die somatotrope Achse, anschließend die gonadotrope, dann die thyreotrope und zuletzt die kortikotrope Achse (Tab. 1). Die hormonelle Abklärung erfolgt im Allgemeinen durch Bestimmung der Effektor- sowie der stimulierenden Hormone. Weiterführend werden dynamische Stimulationstests zur Differenzierung zwischen einem hypothalamischen, hypophysären und einem peripheren Hormonmangel angewandt (Abb. 1). Das bildgebende Verfahren der Wahl ist die gezielte MRT der Hypophyse. Therapeutisch kommt die neurochirurgische (zumeist transsphenoidale) Resektion einer Raumforderung infrage. Im Falle des Vorliegens eines Prolaktinoms ist ein Therapieversuch mit Cabergolin indiziert. Symptomatisch erfolgt eine Substitution der Effektorhormone. Zur Kortisolsubstitution wird Hydrokortison angewandt. Eine Aufklärung des Patienten über die Notwendigkeit zur Steigerung der Dosis in Stresssituationen bzw. bei Infekten und über die Indikation zur parenteralen Gabe bei gastrointestinalen Infekten ist unumgänglich. Thyroxin wird wie bei einer Hypothyreose anderer Genese substituiert, ein erniedrigter TSHWert ist hier Ausdruck der Hypophyseninsuffizienz und nicht etwa einer Hyperthyreose. Eine Testosteronsubstitution kann transdermal oder als Depotspritze erfolgen. Zur Wachstumshormontherapie steht rekombinantes Wachstumshormon zur subkutanen Verabreichung zur Verfügung. Prolaktin wird nicht substituiert.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Diabetes_1903_Weblinks_jatros_dia_1903_s44_tab1_schrangl.jpg" alt="" width="650" height="275" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Diabetes_1903_Weblinks_jatros_dia_1903_s44_schrangl_abb1.jpg" alt="" width="650" height="322" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten
Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


