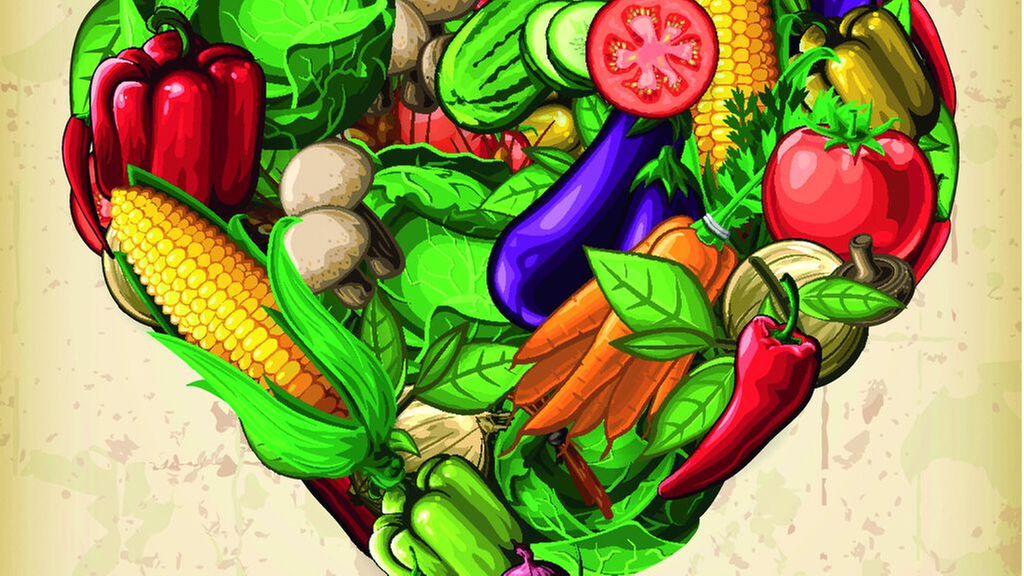
©
Getty Images
Diabetes – eine Herausforderung mehr für uns Lehrer
Jatros
30
Min. Lesezeit
25.09.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Kommt ein Kind mit Diabetes an eine Schule, sind insbesondere die Lehrer des Kindes gefragt, sich mit der Situation auseinanderzusetzen. Wir sprachen mit Helmut Thiebet, Lehrer in der NMS III, Weiz, und stellvertretender Bundesvorsitzender der Österreichischen Diabetikervereinigung, darüber, wie es ihm dabei geht, welche speziellen Probleme auftreten und wie eine gute und österreichweite Lösung dafür aussehen könnte. Denn eines gibt es derzeit noch nicht – eine wissenschaftlich fundierte Ausbildung für Lehrer darin, was Diabetes ist und wie mit der Erkrankung und den Betroffenen umgegangen werden sollte.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Herr Thiebet, wann wurden Sie als Lehrer mit dem Thema Kinder mit Diabetes an der Schule konfrontiert?<br /><br /> H. Thiebet:</strong> Vor etwa 6 Jahren kam eine Mutter zu uns, die ihren Sohn, der Diabetiker ist, bei uns in der Neuen Mittelschule III in Weiz zum Schulbesuch anmelden wollte. Da auch schon der Ehemann, der ebenfalls Diabetiker ist, bei uns an der Schule unterrichtet worden ist, haben wir die Familie und die Situation gekannt, was alles natürlich vereinfacht hat. Wir haben im Vorfeld, als das Kind noch in die vierte Klasse Volksschule gegangen ist, die Eltern und das Kind zu einem längeren informellen Gespräch eingeladen. Dabei hat die Mutter uns die Ängste geschildert, die sie in Verbindung mit diesem Schulneueintritt hat. Ihre Hauptsorgen betrafen einerseits den gesundheitlichen Aspekt, dass sich das Kind z.B. bei einer Hypoglykämie nicht selbst helfen kann, andererseits die schulischen Leistungen, da bei einer leichten Unterzuckerung möglicherweise die Konzentration des Kindes leidet. Speziell beim Sport zeigten sich trotz guter Ausgangswerte bei dem Kind stark schwankende Blutzuckerwerte, wobei es beim Sport eher zu einem Anstieg als zu einem Absacken der Glukosewerte kam. Um dem Kind die Ängste zu nehmen, sind wir mit dem Buben in die künftige Klasse gegangen, haben ihm alles im Schulhaus gezeigt und ihm so die Sicherheit gegeben, dass wir die Situation gemeinsam „gut schaukeln werden“. Auch meine Frau, die ebenfalls Diabetikerin ist und als Lehrerin arbeitet, konnte in dieser Situation zur Beruhigung beitragen. <br />Ich war zwar nicht der Klassenvorstand des Buben, aber die Kollegin, die die Klasse leitete, wurde von uns im Vorfeld genau gebrieft. Die Eltern und das Kind selbst haben zugestimmt, dass wir die Klassenkameraden über die Erkrankung informieren, wobei der Bub auch anwesend sein wollte. Bei diesem Klassenworkshop haben wir vor allem darauf Wert gelegt, die Krankheit zu erklären und zu erläutern, wie man mit ihr umgeht. Wir haben den Kindern erklärt, was bei einer Hypoglykämie passiert, und sie genau instruiert, was zu tun ist, wenn sie in einer solchen Situation dabei sind. Außerdem haben wir eine „Hypobox“ – mit einem Coca-Cola, Traubenzucker und einem Müsliriegel – in der Klasse, im Physiksaal und im Turnsaal platziert. Dass die Kinder selbst etwas tun können, hat ihnen und dem Buben Sicherheit gegeben. Einerseits sind ja nicht immer Lehrer in den Klassen anwesend und andererseits gibt es ja auch das Leben außerhalb der Schule. <br /><br /><strong>Wie sind die anderen Lehrer in die Situation eingebunden worden?<br /><br /> H. Thiebet: </strong>Der Direktor unserer Schule hat für die Information und Fortbildung Zeit genehmigt. Zu Beginn des Schuljahres wurde in der Schulkonferenz mit den Kollegen alles besprochen. Dafür haben wir uns etwa zwei Stunden Zeit genommen, denn dem Direktor war wichtig, dass jeder Lehrer, der in die Situation kommt, helfen zu müssen, auch Bescheid weiß, was er tun kann. Neben dem Umgang mit kritischen Situationen haben wir aber auch Hilfestellung im Alltag thematisiert. Als Beispiel nenne ich hier: den Blutzucker zu messen, wenn einem Lehrer auffällt, dass das Kind unkonzentriert ist, oder vor einer Schularbeit. Die Information über die Krankheit und darüber, was man tun kann, hat den Lehrern ebenfalls Sicherheit gegeben. <br /><br /><strong>Es gibt ja nicht nur den normalen Schulalltag mit geregeltem und planbarem Verlauf, sondern auch Schulveranstaltungen oder Tage, die nicht so gut planbar sind. Wie wurde damit umgegangen?<br /><br /> H. Thiebet:</strong> Solche Situationen unterscheiden sich natürlich vom normalen Schultag – ich möchte hier als Beispiel die Schwimmwoche in der ersten Klasse bringen. Die Turnlehrer, die den Schüler zwar kennen und auch die Fortbildung absolviert haben, wollten als zusätzliche Sicherheit mich bei der Schulwoche dabei haben. Und auch den Eltern war das wichtig, denn der Bub hat auch in der Nacht immer wieder mit Unterzuckerungen zu kämpfen. Die Eltern wiederum haben sich beim Betreuungsteam des Kindes an der Uniklinik Graz genau informiert, was zu beachten ist, und die Informationen weitergegeben.<br /> Um die nächtlichen Unterzuckerungen zu vermeiden, hat die Mutter mich gebeten, den Buben in der Nacht zu wecken und ihn den Blutzucker kontrollieren zu lassen. Wir haben also vor dem Schlafengehen gemessen, dann gegen 2 oder 3 Uhr nochmals und in der Früh wiederum. Bei Abweichungen hat der Bub dann korrigiert.<br /> Der Sport während der Schwimmwoche hat zum erwarteten Auf und Ab des Blutzuckerspiegels geführt. Daher musste oft gemessen und korrigiert werden. Manchmal kam es durch Sport zu einem Anstieg, manchmal zu einem Abfall des Blutzuckerspiegels. Durch seine Basis-Bolus-Therapie war das Kind aber flexibel im Umgang mit dieser Situation. Ich habe das Problem mit dem Schüler besprochen und die Problemlösung überwacht.<br /> Der dritte wichtige Faktor war natürlich das Essen. Da er eine Basis-Bolus- Therapie hatte, musste er zu den Mahlzeiten Insulin dazuspritzen, wobei er sich damit schon gut ausgekannt hat. Beim Mittagessen haben wir uns schon im Vorfeld erkundigt, wie viel BE er isst, und uns diesbezüglich per Zeichensprache verständigt, damit es nicht auffällt. <br /><br /><strong>Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?<br /><br /> H. Thiebet:</strong> Natürlich ist es aufwendig, als Lehrer eine solche Betreuung zu übernehmen, letztlich war es aber eine sehr nette Woche mit dem Kind. Mein Schluss daraus ist, dass es sicher ein großer Vorteil ist, die Betreuung auf mehrere kompetente Betreuungspersonen verteilen zu können. Man darf nicht übersehen, dass vieles auf Eigeninitiative und Vorwissen beruht hat. Dass dies möglich ist, hat sich beim Schulschikurs des Buben in der zweiten Klasse gezeigt. Auch die anderen Lehrer hatten mittlerweile zusätzliche Sicherheit gewonnen, sodass es kein Problem war, dass ich beim Schikurs nicht dabei war.<br /> Aber auch die Kinder entwickeln sich weiter und benötigen je nach Alter, Wissensstand, persönlichem und emotionalem Entwicklungsstand unterschiedliche Unterstützung. So hat sich der Bub in der vierten Klasse zum Diabetesprofi entwickelt. Dennoch hat es ihm Sicherheit gegeben, gelegentlich mit mir in be- stimmten Situationen Rücksprache zu halten. Wichtig erscheint mir, die Kinder nicht auszugrenzen, sodass sie überall mitmachen können. Dabei ist natürlich ein entscheidender Faktor, dass eine gute Kooperation zwischen Eltern und Lehrern besteht.<br /> Im Spätherbst des vergangenen Jahres hat der Bub die Schule gewechselt. Danach hat er uns besucht und erzählt, dass sein HBA<sub>1c</sub> 6,8 ist, also hervorragend. Das hat er von sich aus erzählt, ohne dass ich ihn gefragt habe, da hat sich ein gutes Vertrauensverhältnis mit dem Buben aufgebaut. <br /><br /><strong>Was würden Sie sich für die Zukunft wünschen, um die Situation zu verbessern? <br /><br />H. Thiebet:</strong> Derzeit sind Lehrer laut SchUG 2017 dazu verpflichtet, das Messen des Blutzuckers zu überwachen. Das Kind darf jederzeit Blutzucker messen, der Lehrer muss das auf Wunsch der Eltern überwachen. Das ist schon ein Riesenschritt; mir war das aber ein bisschen zu wenig, denn wenn ich ein Kind auf eine Sport-/Erlebniswoche mitnehme, muss ich schon ein bisschen mehr wissen. Hinzu kommt, dass wir immer mehr Kinder mit Diabetes an den Schulen haben. Leider ist das Wissen von Lehrern über Diabetes gering, wie eine Untersuchung von Frau Mag. Wallner gezeigt hat. Ich würde mir daher eine gut fundierte Diabetesfortbildung für Lehrer wünschen. Lehrer im Pflichtschulbereich sind zu 15 Stunden Fortbildung pro Jahr verpflichtet. Eine anlassbezogene Schulung, wenn ein Kind mit Diabetes in die Schule kommt, wäre ideal. Lehrer sollen keine Diabetologen werden, aber sie sollen mit der Situation umgehen können und es sollen Ängste abgebaut werden.<br /> Wir haben ein Fortbildungskonzept mit medizinischem Grundwissen zum Thema Diabetes entworfen. Die wissenschaftlichen Inhalte kommen von der Österreichischen Diabetes Gesellschaft – Prof. Sabine Hofer aus Innsbruck hat den medizinischen Teil beigesteuert – und von der Österreichischen Diabetikervereinigung, die praktische Erfahrungen eingebracht hat. In einer Art Checkliste, die wir den Lehrern an die Hand geben, werden alle Punkte thematisiert, vom Aufnahmegespräch bis hin zum Inhalt einer Hypobox. Wir versuchen, auch ein Tool zu entwerfen, das bei einer Lehrerfortbildung verwendet werden kann. Auch der Gruppe der Diabetesberater, die durch Frau Barbara Semlitsch vertreten wird, wurde das Konzept vorgestellt, denn eine solche Lehrerfortbildung kann entweder durch Schulärzte, wenn es diesen zeitlich möglich ist, oder durch Diabetesberater erfolgen. Prof. Hofer entwickelt den medizinischen Teil speziell für Schulärzte. Bei den Lehrern kommt es auf das Grundwissen an: Was ist Diabetes, welche Folgen hat er, wie wirkt er sich aus, was mache ich in bestimmten Situationen? Darüber darf ich auch bei der ÖDG-Tagung im Herbst in Salzburg ein Referat halten.<br /><br /> <strong>Vielen Dank für das Gespräch!</strong></p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Diabetes erhöht das Sturzrisiko deutlich
Eine dänische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass sowohl Patienten mit Typ-1- als auch Patienten mit Typ-2-Diabetes öfter stürzen und häufiger Frakturen erleiden als Menschen aus einer ...
Notfall Diabetische Ketoazidose: Leitliniengerechtes Handeln kann Leben retten
Akute Stoffwechselentgleisungen können lebensbedrohlich sein und erfordern eine rasche und leitliniengerechte Diagnostik und Therapie. Pathogenese, Klinik, typische Befunde und die ...
Wie oft wird Diabetes nicht oder spät erkannt?
Im Allgemeinen wird von einer hohen Dunkelziffer an Personen mit undiagnostiziertem Typ-2-Diabetes ausgegangen. Ein Teil davon sind von Ärzten „übersehene“ Fälle. Eine von der University ...


