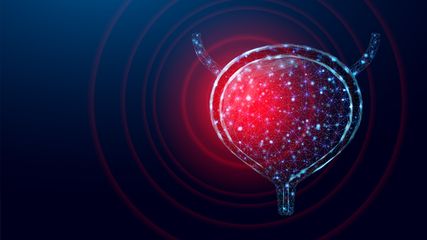©
Getty Images
Blasenentleerung bei hoher, kompletter Querschnittslähmung der Frau
Urologik
Autor:
Dr. Alexandra Gulacsi, FEBU
E-Mail: alexandra.gulacsi@tirol-kliniken.at
Autor:
Dr. Gusztav Kiss
Autor:
Dr. Marco Pedrini
Autor:
Dr. Jannik Stühmeier
Autor:
Priv.-Doz. Dr. Peter Rehder, MB, ChB, MSc, MMed
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Horninger
<br>Universitätsklinik für Urologie Medizinische Universität Innsbruck
30
Min. Lesezeit
21.08.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Oberste Ziele der Rehabilitation bei Patientinnen und Patienten mit Querschnittslähmung sind die Erhaltung der üblichen Lebenserwartung und die Gewährung einer guten Lebensqualität. Die Tetraplegie stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich anhand von Fallbeispielen mit den urologischen Aspekten der Rehabilitation tetraplegischer Frauen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Versorgungsunterschiede bei tetraplegischen Frauen und Männern beachten</li> <li>Oberstes Ziel: Selbstversorgung – auch in der Blasenentleerung</li> <li>Katheterismus im Rollstuhl erwünscht</li> <li>Zugang bei Frauen nur mit (Nabel-)Stoma möglich</li> </ul> </div> <p>Die Selbstversorgung bei tetraplegischen Patientinnen ist eine besondere Aufgabe, da bei Frauen geschlechtsspezifische, erschwerende Faktoren zu beachten sind. Vor allem die Frage der Kontinenz ist bei Frauen noch wichtiger, weil die Versorgung deutlich komplexer ist.</p> <h2>Neurologische und urologische Grundlagen</h2> <p>Es sind weltweit mehr als 2,7 Millionen Patientinnen und Patienten von Querschnittslähmung betroffen, es kommen jedes Jahr circa 130 000 Fälle dazu. In Österreich sind aktuell 4000 posttraumatische Querschnittslähmungen registriert, jährlich kommen 200–250 Fälle mit dieser Diagnose hinzu.<br /> Die häufigste Ursache der Querschnittslähmung ist das Wirbelsäulen-Trauma, u. a. durch Verkehrsunfälle, Stürze bzw. Extremsport. Weitere, seltenere Ursachen sind: neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose, Durchblutungsstörungen bzw. Raumforderungen des Myelons.<br /> Die Nachsorge ist sehr komplex. Die Patienten benötigen regelmäßige orthopädische, neurologische, unfallchirurgische bzw. urologische Kontrollen und Eingriffe.<br /> Nach Angaben der Betroffenen bedeuten die Blasen- und Mastdarmentleerungsstörung die größten Einschränkungen im Alltag, noch vor der Bewegungsstörung. Die vegetativen Beschwerden verursachen oft mehr Komplikationen als der Bewegungsapparat selbst.<br /> Bei der Diagnose wird die Läsionshöhe als letztes intaktes Segment definiert. Diese kann nach klinischer Untersuchung anhand des Dermatoms, der Kennmuskel bzw. mithilfe der Bildgebung beschrieben werden. Mit der Zeit kann sich die neurologische Höhe, aufsteigend oder sinkend, minimal ändern.<br /> Eine genaue Definition der hohen Querschnittslähmung gibt es nicht. Aus urologischer Sicht wird die anatomische Höhe Th 6 als wichtige Grenze gedeutet, da bei höheren Läsionen mit einer autonomen Dysreflexie der distal liegenden vegetativen Bahnen gerechnet werden muss. Eine lebensbedrohliche Verletzung besteht bei C 2/3 wegen des wahrscheinlichen Ausfalls des N. phrenicus. Aus der Sicht der Selbstständigkeit und Funktion der oberen Extremitäten ist C 5 eine wichtige Grenze. Unsere Fallbeispiele behandeln Fälle von tetraplegischen Frauen mit einem Lähmungsniveau höher als C 5.<br /> Bei einer frisch aufgetretenen Querschnittslähmung – unabhängig von Höhe und Ursache – ist aus urologischer Sicht die Sicherstellung der Blasenentleerung entscheidend. Erst nach der Akutphase ist eine weiterführende Diagnostik notwendig.<br /> Bei der hohen, kompletten Querschnittslähmung sowie auch bei allen tieferen suprasakralen spinalen Läsionen besteht eine neurogene Detrusorüberaktivität zusammen mit einer Detrusor-Sphinkter-Dyssynergie, bei gleichzeitiger Asensitivität der Harnblase. Früher wurde diese Funktionsstörung zutreffend spastische Blase oder Reflexblase genannt, laut aktueller Definition ist die Bezeichnung „suprasakrale, neurogene Blase“ richtig.<br /> Bei einer „spastischen“ Blase sind mehrere Maßnahmen zur Blasentleerung möglich. Zwei Untergruppen sollten differenziert werden: gut erhaltene Handfunktion (Paraplegie) und keine ausreichende Handfunktion (Tetraplegie).</p> <h2>Gut erhaltene Handfunktion, Paraplegie</h2> <p>In dieser Untergruppe sind beinahe die gleichen Optionen bei Frauen und Männern möglich. Häufigste Methode ist der intermittierende Selbstkatheterismus in Kombination mit antimuskarinerger Therapie. In Einzelfällen bei schlechter Handfunktion ist auch eine getriggerte Entleerung mit oder ohne Sphinkterotomie möglich, diese ist aber bei Frauen wegen des erschwerten Auffangens des Harnes nicht praktikabel. Bei Männern jedoch mit Kondom- Urinal – nach Evaluierung des Status und Aufklärung des Patienten – auf Wunsch möglich. Eine Blasenaugmentation ist bei geringer Blasenkapazität bzw. bei nicht therapierbaren, hohen intravesikalen Drücken zu erwägen. Auch ein katheterisierbares Stoma ist eine Option. Ein suprapubischer bzw. transurethraler Dauerkatheter sollte wegen Langzeitkomplikationen vermieden oder nur als Ultima Ratio in Betracht gezogen werden.</p> <h2>Keine ausreichende Handfunktion, Tetraplegie</h2> <p>Die Evaluierung muss geschlechtsspezifisch erfolgen. Der intermittierende Selbstkatheterismus ist bei Männern in einigen Fällen möglich, auch der Fremdkatheterismus kann unter Umständen im Rollstuhl, ohne Transfer durchgeführt werden. Eine Sphinkterotomie mit der Verwendung eines Kondom-Urinals ist ebenso eine mögliche Lösung.<br />Bei Frauen bestehen erschwerende Faktoren. Der Selbstkatheterismus kann ohne guter Handfunktion weder im Rollstuhl noch im Bett durchgeführt werden. Selbst der Fremdkatheterismus stößt meistens auf erhebliche Hindernisse wegen der notwendigen Lagerung und/oder Transfer und wegen möglicher Spasmen. Das bedeutet, dass die Patientin für Umlagerungen und für die Katheterisierung auf Hilfe weiterer Personen angewiesen ist. Dabei sollte der Katheterismus täglich 4–5-mal durchgeführt werden, ein extrem hoher Pflegeaufwand bzw. eine hochgradige Einschränkung des selbstständigen Lebens. Des Weiteren ist die Inkontinenz bei Frauen schwer versorgbar, trotz modernster Einlagen muss mit dermatologischen Komplikationen gerechnet werden.<br /> Die suprasakrale, neurogene Blase kann auch mit einem sakralen Vorderwurzelstimulator (SARS) nach Brindley versorgt werden, diese Methode ist jedoch nur mehr in wenigen Zentren weltweit im Einsatz.</p> <h2>Mögliche Therapieansätze für junge tetraplegische Frauen mit Kinderwunsch – Fallbeispiele</h2> <p>In den letzten 5 Jahren haben wir in unserer Klinik 2 junge Frauen mit frisch erlittener Tetraplegie betreut. Ursache war in beiden Fällen ein Trauma beim Sport. Betroffene sehen es heutzutage als selbstverständlich an, dass nach Abschluss der Rehabilitation die Rückkehr ins Berufsleben möglich ist. So muss auch das urologische Ziel die maximale Selbstständigkeit im Blasenmanagement sein. Das heißt selbstständige Blasenentleerung und Sicherheit vor Harninkontinenz. Dementsprechend wählten wir eine Therapieoption mit katheterisierbarem Stoma, da im Vorfeld in beiden Fällen mit entsprechender medikamentöser Therapie eine ausreichende Blasenkapazität und die manuelle Fähigkeit für die Handhabe des Selbstkatheterismus über ein Nabelstoma gesichert werden konnte.<br /> Bei der präoperativen Abklärung spielte die Urodynamik eine Schlüsselrolle (Abb. 1). Bei den Patientinnen wurde unter antimuskarinerger Therapie eine Blasenkapazität von 400–600 ml erreicht. Unter Fremdkatheterismus 4–6-mal am Tag waren sie kontinent. Wegen der ausreichenden Kapazität war keine gleichzeitige Blasenaugmentation notwendig. Bei der Operation wurde zuerst eine diagnostische Laparoskopie durchgeführt, um den Appendix zu beurteilen. In beiden Fällen war er intakt, somit konnte die Operation durchgeführt werden. Das neu geschaffene Nabelstoma ist selbst mit eingeschränkter Handfunktion gut erreichbar und ist kontinent (Abb. 2). Bei dem Mitrofanoff-Stoma ist jedoch eine der häufigsten Komplikation die Verengung, Vernarbung des Stomas. Um diese als Frühkomplikation zu vermeiden, wurde ein Dauerkatheter zur Schienung für ca. 6–8 Wochen belassen, um erst dann mit dem Selbstkatheterismus anzufangen. Die postoperativen Kontrollen zeigten zufriedenstellende urodynamische Befunde, das heißt, die Blasenkapazität hat sich kaum geändert und die Patientinnen blieben mit Antimuskarinergika weiterhin kontinent. In beiden Fällen ist der Katheterismus ohne Hilfe möglich bzw. sind keine Komplikationen aufgetreten.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1903_Weblinks_uro_1903_s16_abb1_gulacsi.jpg" alt="" width="1455" height="1093" /></p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Urologik_Uro_1903_Weblinks_uro_1903_s16_abb2_gulacsi.jpg" alt="" width="723" height="518" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>Burgdörfer H et al.: Manual – Neuro-Urologie und Querschnittlähmung, Leitlinien zur urologischen Betreuung Querschnittgelähmter. 3. überarbeitete Auflage (2002); aus dem Arbeitskreis Urologische Rehabilitation Querschnittgelähmter • S2k-Leitlinie der Deutschsprachigen Medizinischen Gesellschaft für Paraplegie (DMGP). Neurourologische Versorgung querschnittgelähmter Patienten. Erarbeitet durch den Arbeitskreis Neuro-Urologie der Deutschsprachigen, Medizinischen Gesellschaft für Paraplegie (DMGP) • Blok B et al.: Neuro-urology, Guidelines, European Association of Urology • Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA): Auszug aus der Statistik 2017; Ausgabe 2018 • Adriaansen JJ et al.: Bladder-emptying methods, neurogenic lower urinary tract dysfunction and impact on quality of life in people with long-term spinal cord injury. J Spinal Cord Med 2016; 8: 1-11 • Hakenberg OW et al.: Application of the Mitrofanoff Principle for intermittent selfcatheterisation in quadriplegic patients. Urology 2001; 58: 38-42 • Pannek J, Bertschy S.: Mission impossible? Urological management of patients with spinal cord injury during pregnancy: a systematic review. Spinal Cord 2011; 49: 1028-32</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Historische Momente aus Wiener urologischen Abteilungen
Der 51. Österreichische Urologenkongress in der Messe Wien vom 22. bis 25.5.2025, veranstaltet zusammen mit der bayrischen Schwestergesellschaft, fokussierte nicht nur wichtige ...
Zytoreduktive Nephrektomie im Jahr 2025 – ein evidenzfreier Raum?
Die zytoreduktive Nephrektomie (CN) ist heutzutage weiterhin ein fester Bestandteil der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC). Doch ob und wann ein Patient einer CN ...
Blasenerhalt trotz BCG-Versagen bei High-Risk-Tumoren: intravesikale Strategien heute und morgen
Standard bei BCG-Versagen beim nichtmuskelinvasiven Blasenkarzinom ist die radikale Zystektomie. Alternativen mit Gemcitabin oder Mitomycin sind onkologisch unterlegen. Neue Ansätze wie ...