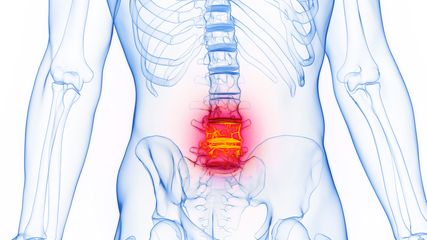<p class="article-intro">Rehabilitationsmaßnahmen stellen eine wichtige und wesentliche Säule im österreichischen Gesundheitswesen dar. Für Rheumapatientinnen ist Rehabilitation ein bedeutender Therapiebestandteil und eine gute Chance für ein selbstbestimmtes Leben.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Maßnahmen der Rehabilitation orientieren sich am ICFSystem unter Miteinbeziehung der Kontextfaktoren (Alter, Geschlecht …), basierend auf dem biopsychosozialen Modell.</li> <li>Eine genaue Zieldefinition, von der Rheumapatientin gemeinsam mit einem multidisziplinären Team erarbeitet, bildet die Grundlage jedes Rehabilitationsaufenthaltes.</li> <li>Erlernen von Selbstmanagementstrategien, Erwerb von Gesundheitskompetenzen und Information über den Zugang zu gesundheitsrelevanten Themen sind essenzielle Kenntnisse.</li> </ul> </div> <p>Laut WHO bedeutet Rehabilitation den koordinierten Einsatz medizinischer, sozialer, beruflicher, pädagogischer und technischer Maßnahmen sowie die Beeinflussung des sozialen Umfeldes, um die Funktion zu verbessern und den Betroffenen zu größtmöglicher Selbstständigkeit zu verhelfen.<sup>1</sup> Die Basis der Maßnahmen in der Rehabilitation ist das biopsychosoziale Modell, eine mehrdimensionale Betrachtungsweise, die sich in der International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) widerspiegelt (Abb. 1).<sup>2</sup> In der Rehabilitation werden die unterschiedlichen Maßnahmen entsprechend diesem biopsychosozialen Therapieansatz von multidisziplinären Teams ergriffen. <br />Im Mittelpunkt steht das Erreichen der Partizipation in allen Bereichen des täglichen Lebens. Zu den Tätigkeiten des alltäglichen Lebens zählen für Frauen neben ihrer beruflichen Tätigkeit häufig auch Kindererziehung, Haushalt sowie mitunter auch die Pflege von Angehörigen. Diese Mehrfachbelastung muss bei der Zieldefinition während eines Rehabilitationsaufenthaltes miteinfließen. Zudem sind Health Professionals aufgefordert, die unterschiedlichen, durch das Geschlecht bedingten Gesundheitsbedürfnisse, genderabhängigen Risikofaktoren und klinischen Manifestationen in die Therapieprogramme miteinzubeziehen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_a1-abb1.jpg" alt="" width="788" height="515" /></p> <h2>Besonderheiten der Rehabilitation bei Rheumapatientinnen</h2> <p>Rheumatische Erkrankungen betreffen sehr heterogene Patientengruppen. Zudem sind manche Diagnosen, wie etwa die rheumatoide Arthritis (RA), häufiger bei Frauen als bei Männern zu finden. Neben Gelenkaffektionen sind mögliche Komorbiditäten wie kardiovaskuläre Begleiterkrankungen und Diabetes bei der Planung einzelner Rehamaßnahmen zu berücksichtigen. Weiters geht die RA mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten einer Osteoporose einher. Von einem spanischen Spitalsregister wurden Hüftfrakturen einer Periode über 17 Jahren (1999–2015) ausgewertet und dabei zeigte sich, dass Patienten mit RA im Vergleich zur Normalbevölkerung ohne RA durchschnittlich 6 Jahre früher von Hüftfrakturen betroffen sind.<sup>3</sup> <br />In der Rehabilitation finden sich Patientinnen, welche primär wegen der Diagnose ihrer rheumatischen Erkrankung mit den daraus resultierenden Funktionseinschränkungen, Schmerzen und geänderten Lebensumständen aufgenommen werden, aber auch jene Rheumapatientinnen, die beispielsweise als Folge von Frakturen rehabilitativer Maßnahmen bedürfen. <br />Bei vielen Erkrankungen stehen Funktionseinschränkungen der Hände im Vordergrund. Die Hände sind unser wichtigstes Instrument, um die Aktivitäten des täglichen Lebens übernehmen zu können, und Hände spielen eine sehr bedeutende Rolle in der Kommunikation zur Pflege sozialer Kontakte und Beziehungen. <br />Das Vorhandensein psychischer Belastungen, sei es aus privaten, familiären oder beruflichen Ursachen, ist oft ein begleitendes Thema während eines Rehabilitationsaufenthaltes. Bestehen solche Belastungen, finden sie Niederschlag in den für die Rehabilitation gemeinsam zu erarbeitenden Zielen. <br />Müdigkeit und Erschöpfung bei chronischen Erkrankungen und die Unsicherheit, welche Art von Belastung, sei es im Kraft- und/oder Ausdauerbereich, gut anzuwenden und umzusetzen wäre, sind ein wichtiger Ansatz bei der Auswahl der Therapien. Das Ziel ist hierbei, mit den Patientinnen wieder Vertrauen in die Möglichkeiten des eigenen Körpers zu gewinnen und Übungsprogramme anzuwenden, die gelenkschonende Bewegungen ermöglichen. Wieder Freude an der Bewegung zu haben, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die erlernten Trainingsprogramme in den Alltag übernommen werden. <br />Eine besondere Herausforderung stellen geriatrische Rheumapatientinnen dar, da bei ihnen neben der rheumatischen Grunderkrankung Beeinträchtigungen der Sinnesfunktionen und der kognitiven Leistungsfähigkeit zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang interessant sind Ergebnisse einer Studie zum Thema „behavioral medicine“ für ältere Frauen, welche alleine mit chronischen Schmerzen leben.<sup>4</sup> Derzufolge ist es auch für ältere Frauen mittels Verhaltensänderungen durchaus möglich zu lernen, physikalische Aktivitäten in den Alltag zu integrieren und dadurch die Aufgaben des täglichen Lebens besser zu managen. Im biopsychosozialen Modell sind die Herangehensweisen gut abbildbar und auch als Ziel bei älteren Patientinnen denkbar.</p> <h2>Was ist wichtig vor dem Rehabilitationsaufenthalt?</h2> <p>Grundsätzlich müssen die drei Voraussetzungen Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit und Rehabilitationsprognose gegeben sein. Die Rehabilitationsbedürftigkeit wird im Vorfeld durch den behandelnden Arzt gemeinsam mit der Patientin erörtert, im Sinne einer gemeinsamen Entscheidung. Grundsätzlich ist immer die Patientin die Antragstellerin. Rehabilitationsfähigkeit bedeutet, dass die Patientin motiviert ist und keine hohe Aktivität der rheumatologischen Grunderkrankung vorliegt, also eine Phase besteht, in welcher die medikamentöse Einstellung nicht im Vordergrund steht. Die Rehabilitationsprognose ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Rehabilitationsziel in einem bestimmten Zeitraum erreichbar ist. <br />Für eine optimale Planung des Rehabilitationsaufenthaltes sollte eine entsprechende Qualität der Zuweisung vorliegen. Der ÖGR-Arbeitskreis für Rehabilitation hat sich eingehend mit diesem Thema beschäftigt und auf der ÖGR-Jahrestagung 2018 ein Poster präsentiert, in welchem die wünschenswerten Basisinformationen dargestellt wurden.<sup>5</sup> Exemplarisch genannt seien eine aus der Zuweisung hervorgehende Zieldefinition, die Gehfähigkeit der Patientin oder vorliegende Einschränkungen im Beruf.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1902_Weblinks_a1-abb2.jpg" alt="" width="589" height="468" /></p> <h2>Maßnahmen in der Rehabilitation</h2> <p>In der Rehabilitation stehen die nicht medikamentösen Therapien im Vordergrund. Neben den einzelnen therapeutischen Maßnahmen sind multidisziplinäre Schulungen im Fokus. Durch entsprechende Informationen und Erwerb von Gesundheitskompetenzen bei Vorliegen der rheumatologischen Grunderkrankung soll die Basis für das Erlangen der besten Selbstmanagementstrategien gelegt werden.</p> <p><strong>Ärztliche, pflegerische und therapeutische Anamnese und Statuserhebung</strong><br /> Die Erhebung erfolgt multidisziplinär und erfasst jedenfalls die Zieldefinition unter Miteinbeziehung der Patienten. Neben Schmerzen, Funktionseinschränkungen, Komorbiditäten und Medikamenten werden – entsprechend dem biopsychosozialen Modell – auch die Kontextfaktoren wie umwelt- und personenbezogene Faktoren, darunter fällt auch das Geschlecht, erfasst. Hier wird bei Aufnahmen auch erfasst, ob die Zuweisung als Folge einer Fraktur erfolgt ist und ob eine RA oder Osteoporose vorliegt, um entsprechende Maßnahmen einzuleiten.</p> <p><strong>Ergotherapien</strong><br /> Die Ergotherapie umfasst die klassische Einzeltherapie, wobei hier in Abhängigkeit von der vorliegenden Situation die Stabilisierung der betroffenen Gelenke, die Schmerzreduktion und die Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten im Vordergrund stehen. Ein weiterer Schwerpunkt der Ergotherapie ist alltagsrelevantes Training inklusive Versorgung mit individuell angepassten Schienen und Hilfsmitteln, so der Bedarf gegeben ist. Die Vermittlung von Informationen über ergonomische Arbeitsweisen ist für Rheumapatientinnen, vor allem bei oft von Frauen ausgeübten Tätigkeiten im Büro und Arbeiten an Bildschirmen und PCs, von enormer Bedeutung, um lange am Arbeitsprozess teilhaben zu können. Ergotherapeuten arbeiten im Bereich der gesamten oberen Extremität inklusive Schultergelenk. Dem Schultergelenk sollte bei Patienten mit RA schon in frühen Stadien, vor allem bei physisch anstrengenden Berufen mit Überkopfarbeiten, Beachtung geschenkt werden.<sup>6</sup></p> <p><strong>Physiotherapie</strong><br /> Physiotherapie gibt es als Gruppenund als Einzeltherapien. Im Fokus stehen hier das individuelle Training, die Verbesserung von koordinativen Fähigkeiten, die Kräftigung der Muskulatur unter Miteinbeziehung der jeweils individuellen Situation und das Erlernen von Bewegungsmustern, die gut in den Alltag integrierbar sind. Die Fähigkeit des Vermittelns von Freude an der Bewegung ist eine wesentliche Eigenschaft im Training mit den Patienten. Mitarbeiter sollten daher über entsprechende Kompetenzen in dieser Form der Kommunikation verfügen. Herauszufinden, was die einzelnen Patientinnen motiviert, „in Bewegung zu bleiben“, ist wesentlich für die nachhaltige Implementation der erlernten Bewegungsmuster.</p> <p><strong>Informationen und Schulungen</strong><br /> Informationen und Schulungen können im Rahmen von Einzelsettings oder in Gruppen geboten werden. Die Themen sind vielfältig und umfassen die Bereiche Diätologie und Psychologie. Gruppen gibt es zu bestimmten Themen und in unterschiedlichen Größen. Raucherberatung oder Informationen zum Lebensstil sind Beispiele dafür. Für Rheumapatientinnen ist der gute Umgang mit Stress, Schmerzen im Alltag und den sich durch die Diagnose ergebenden Änderungen der Lebensumstände Ziel der Maßnahmen der Rehabilitation.</p> <p><strong>Massagen, Thermo- und Elektrotherapie</strong><br /> Alle diese Therapieformen werden in der Schmerztherapie als Teil eines multimodalen Konzeptes angeboten. Massagen dienen zur Lockerung von Muskeln, Sehnen und Bändern. Thermotherapien finden, je nach Erfordernis, als Kälte- und Wärmetherapien Anwendung. Durch Stromanwendungen im Rahmen der Elektrotherapie kann es zur Beeinflussung der Nozizeptoren und zur Unterdrückung der Schmerzweiterleitung kommen.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Im Zentrum der Rehabilitation von Rheumapatientinnen stehen die individuelle Rehabilitandin und die mit ihr definierten Ziele entsprechend dem biopsychosozialen Modell. Das multidisziplinäre Team unterstützt sie in der Umsetzung der gesetzten Ziele. In der Erarbeitung der Ziele wird ganz speziell auch auf Themen eingegangen, welche sich aus den Kontextfaktoren ergeben. <br />Das Erlernen von Selbstmanagementstrategien und Gesundheitskompetenz inklusive Erwerb von Kenntnissen über den Zugang zu gesundheitsrelevanten Themen ist für jede einzelne betroffene Rheumapatientin ein wesentlicher Bestandteil, um in Zusammenschau mit dem eigenen Krankheitsbild mit den Anforderungen des Lebens zurechtzukommen. <br />Sich über einen längeren Zeitraum hinweg mit den vorgeschlagenen Maßnahmen einverstanden zu erklären und an der Erarbeitung dieser auch selbst mitzuwirken, ist ganz im Sinne des biopsychosozialen Modells und führt auch zu Nachhaltigkeit. Je besser Patientinnen geschult und geübt sind, umso besser gelingt der Alltag im Arbeitsumfeld und später auch im höheren Alter. Nicht verbieten, sondern Möglichkeiten finden und anbieten, damit Rheumapatientinnen das machen können, was ihnen Freude bereitet, das ist meine Vorstellung von Rehabilitation.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> WHO Technical Report 668/1981 <strong>2</strong> www.who.int/classifications/ icf/en/ <strong>3</strong> Mazzucchelli R et al.: RMD Open 2018; 4: e000671 <strong>4</strong> Cederbom S et al.: Clin Interv Aging 2014; 9: 1383-97 <strong>5</strong> Mur E et al.: ÖGR-Jahrestagung 2018, Wien, Poster 9 <strong>6</strong> Bilberg A et al.: Scand J Rheumatol 2014; 43: 119-23</p>
</div>
</p>