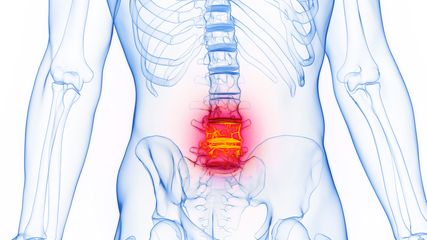©
Getty Images
Hochkarätige Fortbildung im Schloss Spitz
Jatros
30
Min. Lesezeit
11.07.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Wachauer Rheumatag in Spitz an der Donau hat sich zu einer der größten rheumatologischen Fortbildungsveranstaltungen in Österreich entwickelt. Zum 17. Wachauer Rheumatag kamen rund 250 Mediziner aus Niederösterreich, Wien, Tirol, Salzburg und Kärnten.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Das alljährliche Treffen in Schloss Spitz wird vom Verein „Wachauer Rheumatag e. V.“ in Zusammenarbeit mit dem Karl-Landsteiner-Institut für Klinische Rheumatologie veranstaltet und von Dr. Thomas Nothnagl unter der wissenschaftlichen Leitung von Prim. Doz. Dr. Burkhard Leeb organisiert.<br /> Die mittlerweile traditionelle frühmorgendliche Fallpräsentation bestritt diesmal Prim. Dr. Christa Oliveira- Sittenthaler vom SKA-RZ Laab im Walde. Sie stellte den komplizierten Fall einer 73-jährigen Patientin zur Diskussion, die seit früher Jugend an Psoriasis leidet und nach der Menopause Schübe von Gelenksarthritis sowie schwerwiegende pulmonale Beschwerden entwickelte.<br /> Über den aktuellen Stand bezüglich Biologikatherapie berichtete Dr. Raimund Lunzer vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Graz-Eggenberg. Die Fakten aus heutiger Sicht: Biologika sind rasch wirksam, gut verträglich und haben ein sehr geringes Interaktionspotenzial. Die „number-needed-to treat“ bei TNF-Inhibitoren beträgt 2–3 und sie haben auch eine deutliche Wirkung auf andere Befallsmuster wie Enthesitis, Daktylitis, Arthritis und Uveitis. IL17-Inhibitoren wirken sehr gut bei Psoriasis, aber nicht bei CED. IL23- Hemmer hingegen zeigen sehr gute Wirksamkeit bei CED, nicht aber bei SpA. Für die neuen JAK-Inhibitoren liegen laut Lunzer exzellente Daten für RA, SpA, atopische Dermatitis und SLE vor; nur bei Psoriasis zeigen sie nicht den gewünschten Erfolg. Das Karzinomrisiko steigt unter Biologika nicht an, das kardiovaskuläre Risiko wird sogar reduziert. Biosimilars erweisen sich zunehmend als gleichwertige Therapieoption. Auch der Wechsel auf ein Biosimilar zeigt bis jetzt keine negativen Effekte für die Patienten.<br /> „Insgesamt konnte in den letzten Jahrzehnten eine deutliche Reduktion der Krankheitsaktivität bei chronisch-entzündlichen rheumatischen Erkrankungen verzeichnet werden“, so Lunzer. Seit Beginn der „Biologika-Ära“ sind Krankenstandstage wegen rheumatischer Erkrankungen deutlich zurückgegangen. Das derzeit angewandte Treat-to-target-Prinzip führt zum Therapieerfolg. Was nicht heißt, dass es nicht noch Luft nach oben gäbe: „Ganz so einfach ist es in der Praxis dann doch nicht immer“, sagt Lunzer. Komplette Remission erreicht immer noch nur die Hälfte der Patienten. Besonderer Verbesserungsbedarf aus Patientensicht besteht bei Psoriasis und Psoriasisarthritis: Laut der MAPP-Umfrage (Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis) findet fast die Hälfte der befragten Patienten, dass die Therapie schlimmer ist als die Erkrankung. 85 % wünschen sich bessere Therapien. Auch die Realität der Diagnostik lässt noch Wünsche offen: PsA-Patienten warten bis zu 72 Monate auf eine Diagnose und es dauert bis zu 10 Jahre, bis ein Patient ein Biologikum erhält.<sup>1</sup> Dabei würde eine frühe Behandlung mit TNF-Hemmern (innerhalb von 6 Monaten) bei PsAPatienten zu weitaus besseren Remissionsraten führen.<sup>2</sup></p> <h2>Milch statt Bier</h2> <p>Tipps zu Ernährungsempfehlungen für Gichtpatienten gab Doz. Dr. Johann Gruber, Innsbruck. Dass Alkohol und insbesondere Bier zu meiden sind, ist hinlänglich bekannt, aber man sollte die Patienten darauf hinweisen, dass auch alkoholfreies Bier aufgrund der enthaltenen Hefezellen einen hohen Puringehalt hat.<br /> Vorsichtig sollte man auch bei der Empfehlung zur Gewichtsreduktion sein. Denn manche Patienten sind übermotiviert und machen eine zu strenge Diät, die zu kataboler Stoffwechsellage und somit Ketoazidose führt. Die Folgen: die renale Ausscheidung von Harnsäure wird reduziert und es werden körpereigene Purine freigesetzt. Eine zu rasche Gewichtsabnahme kann somit einen Gichtanfall regelrecht provozieren. „Es genügt nicht, den Patienten zu sagen, dass sie abnehmen sollen. Man muss ihnen auch sagen, wie“, betont Gruber.<br /> Nur Purine aus tierischen Lebensmitteln steigern die Harnsäurekonzentration im Serum. Pflanzliche Purine beeinflussen den Harnsäurespiegel nicht. Erhöhte Harnsäurespiegel kommen daher bei Vegetariern seltener vor als bei Fleischessern. Interessanterweise haben aber Veganer im Vergleich zu Vegetariern oder Fleischessern das höchste Gichtrisiko.<sup>3</sup> Man vermutet, dass Milchprodukte für die Regulation des Harnsäurehaushalts essenziell sind.<br /> Gruber informierte auch über die neuesten Therapieoptionen (siehe auch Artikel auf Seite 66ff). Lesinurad ist nun zugelassen, allerdings nur in Kombination mit einem Xanthinoxidasehemmer. In klinischer Entwicklung befinden sich Arhalofenat und Tranilast.</p> <h2>Patientenumfrage</h2> <p>Was bedeutet eine rheumatische Erkrankung für den Patienten? Dieser Frage ging die Online-Umfrage „RA matters“ nach. Dr. Kerstin Brickmann, Graz, präsentierte die Ergebnisse. Frustration, Besorgnis und das Gefühl, ein Versager zu sein – darunter leiden RA-Patienten, wenn sie ihren üblichen Aktivitäten im familiären und sozialen Bereich nicht mehr nachgehen können. Die größte Herausforderung im Berufsleben ist bei 52 % der Befragten die eingeschränkte Beweglichkeit der Hände, gefolgt von Erschöpfung (43 %) und Schmerzen (39 %). Über die Hälfte der Patienten wünscht sich mehr Verständnis für die körperlichen Auswirkungen von RA. Fatigue ist bei allen rheumatischen Erkrankungen ein Hauptproblem.</p> <h2>Morbus Still</h2> <p>Die Fallpräsentation von Prim. Dr. Johann Hitzelhammer, Wien, zeigte, dass der Morbus Still aufgrund seiner Seltenheit oft Schwierigkeiten bei der Diagnose bereitet und unerkannt zu bedrohlichen Komplikationen führen kann. Bei folgenden Symptomen sollte man an Morbus Still denken: abendliche Fieberschübe mit vorübergehenden Hautausschlägen und Gelenksschmerzen. Bei vielen Patienten beginnt der Ausbruch der Erkrankung mit einer Rachenentzündung. Diese ist oft stark schmerzhaft, obwohl die Schleimhaut nur leicht gerötet und geschwollen erscheint. Im Laborbefund kann ein deutlich erhöhtes Serum-Ferritin für Morbus Still sprechen.</p> <h2>Wurm heilt Rheuma?</h2> <p>Prof. Dr. Ludwig Kramer, Wien, sprach über den Zusammenhang von Rheuma und Mikrobiom: „Immer mehr Erkrankungen werden auf eine mangelhafte oder falsch zusammengesetzte Darmflora zurückgeführt, so auch entzündliche Gelenkserkrankungen.“<sup>4</sup> Auch eine orale Dysbiose scheint ein Risikofaktor für RA zu sein.<sup>5</sup><br /> Parasiten wie Peitschen- oder Fadenwürmer bzw. das von ihnen produzierte Glykoprotein ES-62 fördern die intestinale Barrierefunktion und reduzieren die Entzündung im Darm, wie der Infektiologe Prof. Dr. Stefan Winkler, Wien, ausführte: „Sie induzieren über IL-10-Produktion und Unterdrückung der IL-17-vermittelten Inflammation eine immunologische Balance.“ Über die Modulation des Darm-Mikrobioms bieten Würmer einen Schutz vor entzündlichen Erkrankungen wie CED, Asthma und neueren Studien zufolge offenbar auch vor Lupus erythematodes und RA.<sup>6, 7</sup></p> <h2>Guidelines versus Empfehlungen</h2> <p>Im Abschlussvortrag ging Prim. Doz. Dr. Burkhard Leeb, Stockerau, unter anderem auf den Unterschied zwischen Richtlinien und Leitlinien ein: „Richtlinien sind meist von Institutionen veröffentlichte Regeln des Handelns oder Unterlassens, die dem Arzt einen geringen Ermessensspielraum einräumen. Sie haben normativen Charakter, ihre Nichtbeachtung kann dienstrechtliche oder berufsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Leitlinien dagegen sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen über angemessene Vorgehensweisen bei speziellen diagnostischen und therapeutischen Problemstellungen. Der Arzt hat Entscheidungsspielraum und kann in begründeten Einzelfällen von den Leitlinien abweichen.“ Gründe für das Abweichen können z. B. Kontraindikationen oder Nichteignung des Patienten für die Behandlung sein, aber auch ausdrückliche Patientenwünsche oder neuere Forschungsergebnisse, die in den Leitlinien noch nicht berücksichtigt wurden. „Leitlinien sind kein Kochrezept. Wir müssen uns mit dem Patienten auseinandersetzen“, betont Leeb und empfiehlt, die Gründe für eine abweichende Behandlung gut zu dokumentieren und eventuell auch das schriftliche Einverständnis des Patienten einzuholen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s69_gruppenfoto.jpg" alt="" width="400" height="318" /></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s70_3er-foto.jpg" alt="" width="400" height="288" /></p> <p><br /><em>Der 18. Wachauer Rheumatag wird am 25. April 2020 stattfinden.</em></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 17. Wachauer Rheumatag, 27. April 2019, Spitz
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Boehncke W-H et al.: Clinical specialty setting as a determinant for disease management in patients with psoriatic arthritis: results from loop, a cross-sectional, multi-country, observational study. Ann Rheum Dis 2018; 77(Suppl 2): 371 <strong>2</strong> van Mens LJJ et al.: Achieving remission in psoriatic arthritis by early initiation of TNF inhibition: a double-blind, randomised, placebo-controlled trial of golimumab plus methotrexate versus placebo plus methotrexate. Ann Rheum Dis 2019; 78(5): 610-6 <strong>3</strong> Schmidt JA et al.: Serum uric acid concentrations in meat eaters, fish eaters, vegetarians and vegans: a cross-sectional analysis in the EPICOxford cohort. PloSOne 2013; 8(2): e56339 <strong>4</strong> Maeda Y et al.: Dysbiosis contributes to arthritis development via activation of autoreactive T cells in the intestine. Arthritis Rheumatol 2016; 68(11): 2646-61 <strong>5</strong> Schmidt TSB et al.: Extensive transmission of microbes along the gastrointestinal tract. Elife 2019; 8: e42693 <strong>6</strong> Panda AK, Das BK: Diminished IL-17A levels may protect filarial-infected individuals from development of rheumatoid arthritis and systemic lupus erythematosus. Lupus 2017; 26(4): 348-54 <strong>7</strong> Langdon K et al.: Helminth-based therapies for rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Int Immunopharmacol 2019; 66: 366-72</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Bedeutung pulmonaler Symptome zum Zeitpunkt der Erstdiagnose
Bei der Erstdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen können bereits pulmonale Symptome vorliegen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. Eine Studie des Rheumazentrums Jena hat ...
Betroffene effektiv behandeln und in hausärztliche Betreuung entlassen
Bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Gicht ist eine rheumatologisch-fachärztliche Betreuung sinnvoll. Eine im August 2024 veröffentlichte S3-Leitlinie zur Gicht macht deutlich, ...
Gezielte Therapien bei axSpA – und wie aus ihnen zu wählen ist
Nachdem 2003 der erste TNF-Blocker zugelassen wurde, existiert heute für die röntgenologische (r-axSpA) und die nichtröntgenologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) eine ganze Reihe ...