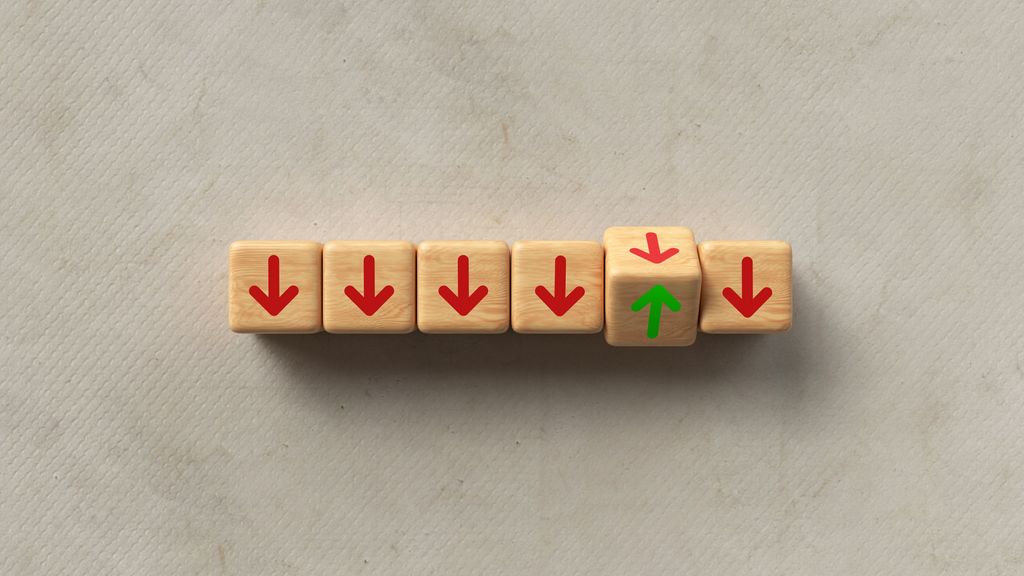
©
Getty Images/iStockphoto
Selbstbestimmt leben – fremdunterstützt sterben?
Jatros
Autor:
Ao. Univ.-Prof. Dr. Eberhard A. Deisenhammer
Universitätsklinik für Allgemeine und Sozialpsychiatrie/Psychiatrie 1<br> Medizinische Universität Innsbruck<br> E-Mail: eberhard.deisenhammer@i-med.ac.at
30
Min. Lesezeit
08.09.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">In den letzten Jahren wurde die Frage, ob es erlaubt sein soll, sich in bestimmten Situationen mithilfe anderer das Leben zu nehmen, auch in Österreich intensiv diskutiert. Das Recht des Individuums auf Selbstbestimmung ist grundsätzlich zu achten, jedoch kann die Fähigkeit, selbstverantwortlich irreversible Entscheidungen zu treffen, in körperlichen oder psychosozialen Extremsituationen beeinträchtigt sein. In Krisen auftauchende Wünsche nach Suizidhilfe werden unter adäquater Behandlung oft von einer würdevollen Annahme des Sterbensprozesses abgelöst. </p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Key Points</h2> <ul> <li>Nimmt man den hippokratischen Eid wörtlich, sind assistierter Suizid oder Tötung auf Verlangen überhaupt kein Diskussionsthema.</li> <li>Die gesetzliche Position Österreichs bezüglich fremdunterstützten Sterbens ist im internationalen Vergleich eher restriktiv.</li> <li>Die Bioethikkommission hat 2015 eine Reform des §78, welcher den assistierten Suizid in Österreich unter Strafe stellt, gefordert.</li> <li>Die Unterscheidung zwischen „Suiziden in der Mitte des Lebens“ und „Suiziden angesichts einer schweren körperlichen Erkrankung“ ist problematisch und aus psychiatrischer Sicht nicht haltbar.</li> <li>Im Rahmen hospiz- und palliativmedizinischer Behandlung werden Wünsche nach Suizidhilfe in vielen Fällen von einer würdevollen Annahme des Sterbensprozesses abgelöst.</li> </ul> </div> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Neuro_1604_Weblinks_Seite53.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <p>Die Frage, ob ein selbstbestimmtes Leben auch die Möglichkeit beinhaltet, Zeitpunkt und Form der Beendigung des Lebens selbst zu bestimmen, wurde im philosophischen, medizinischen, juristischen und theologischen Diskurs immer schon kontroversiell (teil)beantwortet. Dabei wird oft – in fälschlicherweise strenger Abgrenzung – zwischen „Suiziden in der Mitte des Lebens“ und „Suiziden angesichts einer schweren körperlichen Erkrankung“ unterschieden. Erstere seien durch psychische Morbidität bedingt und also für die Allgemeinheit nicht verständlich und müssten deshalb grundsätzlich – allfällig auch durch Beschränkungen des Selbstbestimmungsrechts – verhindert werden. Letztere werden in dieser Sichtweise als allgemein nachvollziehbar und einfühlbar wahrgenommen. Den Betroffenen wird viel eher – im Sinne eines Bilanzsuizides – das Recht zugestanden, in der Abwägung von beeinträchtigter Lebensqualität, Prognose und emotionaler Unterstützung durch das Umfeld, die scheinbar rein rationale Entscheidung zur Beendigung des Lebens zu treffen. Dabei werden die – der Psychiatrie wohlbekannten – vielfachen Überschneidungen von Psyche und Körper übersehen. Eine schwere körperliche Erkrankung ist fast zwangsläufig mit einer emotionalen Reaktion verbunden, die eben die rationale Entscheidungsfähigkeit – etwa bei einer depressiven Symptomatik – massiv beeinflussen kann.</p> <h2>Suizid durch die Hand des Arztes – was Hippokrates sagt</h2> <p>Fortgeschrittene Stadien von als unheilbar eingestuften Erkrankungen sind oftmals mit einer – durch die körperliche Schwäche oder direkte motorische Ausfälle bedingten – Unfähigkeit, selbst die Tötungshandlung durchzuführen, verbunden. Auch sind potenziell letale Substanzen für die meisten Menschen nicht oder nur schwer verfügbar. Dann braucht es jemanden, der – im Sinne des assistierten Suizids – Medikamente besorgt, einen venösen Zugang legt oder in anderer Form den Suizidwilligen unterstützt. Wenn ein Arzt oder auch ein Angehöriger auf Wunsch des Betroffenen die tödliche Handlung durchführt, wird das als aktive Sterbehilfe oder – korrekter – Suizidhilfe bezeichnet.<br /> <br /> Für den ärztlichen Stand ist – wenn man den hippokratischen Eid, der in ärztlichen Sonntagsreden ja gerne zitiert und stolz vor sich hergetragen wird, ernst nimmt – die Sachlage bezüglich der Zulässigkeit solcher Tötungshandlungen eigentlich klar, denn darin heißt es: „… Auch werde ich niemandem ein tödliches Gift geben, auch nicht, wenn ich darum gebeten werde, und ich werde auch niemanden dabei beraten …“ Dass dem hippokratischen Eid heute allerdings in manchen Bereichen nur mehr die Funktion einer nicht so ganz ernst zu nehmenden, oberflächlich glänzenden Worthülse zukommt, zeigt sich, wenn man den Satz weiterliest: „… auch werde ich keiner Frau ein Abtreibungsmittel geben. Rein und fromm werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren.“</p> <h2>Der Fall Sigmund Freud</h2> <p>Der wohl bekannteste Fall ärztlicher Suizidhilfe in der Geschichte ist jener von Sigmund Freud und seinem persönlichen Arzt und Freund Max Schur im Jahr 1939. Freud hatte den Wunsch nach einem „Verschwinden mit Anstand“ bereits viele Jahre zuvor geäußert. 1923 war bei ihm ein Mundhöhlenkarzinom diagnostiziert worden, was eine Serie von mehr als 30 chirurgischen Eingriffen mit Komplikationen, prothetische Rekonstruktionen sowie Bestrahlungen zur Folge hatte. Diese massiven Belastungen und Einschränkungen der Lebensqualität führten letztlich zum tatsächlichen Wunsch Freuds, sein Leben vorzeitig zu beenden.<br /> <br /> Am 21. September 1939 verabreichte Schur seinem Freund und Patienten mehrere Morphiuminjektionen, die am übernächsten Tag zum Tode führten. Es ist umstritten, ob es sich dabei tatsächlich um eine Tötung auf Verlangen (was aus dem beiderseitigen Wunsch, den Tod herbeizuführen, abzuleiten wäre) oder um eine sogenannte „terminale Sedierung“ handelte (wofür die wiederholte Applikation des atemdepressiven, aber auch schmerzstillenden Morphiums mit verzögertem Eintritt des Todes sprechen würde).</p> <h2>Begriffe – was bedeutet was?</h2> <p>Im Begriffsfeld des fremdunterstützten Sterbens werden verschiedene Formen unterschieden. „Sterbehilfe“ bedeutet zum einen die den Sterbeprozess durch psychologische, pflegerische und medikamentöse Maßnahmen erleichternde Begleitung des Sterbens, also Palliativtherapie und -pflege. Allerdings wird der Begriff auch für Handlungen durch Ärzte oder andere Personen verwendet, die den Sterbewunsch eines Patienten unterstützen bzw. umsetzen. „Euthanasie“ (aus dem Griechischen „ευθανασια“ – „das gute Sterben“) bezeichnet eigentlich das Gleiche, ist aber im Deutschen durch die missbräuchliche Verwendung des Begriffs im nationalsozialistischen Faschismus für den vielfachen Mord an psychiatrischen Patienten und Menschen mit geistiger Behinderung diskreditiert.<br /> Die „aktive Sterbehilfe“, auch als „Tötung auf Verlangen“ bezeichnet, unterscheidet sich vom Mord durch das Einverständnis bzw. den Wunsch des Betroffenen, getötet zu werden (und in den meisten Fällen natürlich durch das Motiv). Beim „assistierten Suizid“, der „Beihilfe zur Selbsttötung“, wird im Gegensatz dazu die tatsächliche zum Tode führende Handlung (etwa das Einnehmen der tödlichen Medikamentendosis) vom Betroffenen selbst durchgeführt. Unter diesen Begriff fallen die oben beschriebenen konkreten Vorbereitungen zum Suizid, er könnte aber auch – je nach juristischer Auslegung – die Begleitung eines Suizidwilligen in die Schweiz zu einer Sterbehilfe-Organisation einschließen.<br /> <br /> „Passive Sterbehilfe“ beschreibt das Beenden von lebenserhaltenden Maßnahmen (etwa künstliche Beatmung) mit der sehr wahrscheinlichen Perspektive, damit den Tod herbeizuführen. Der bisherige, irreführende Begriff „indirekte Sterbehilfe“ sollte korrekterweise durch „terminale Sedierung“ ersetzt werden. Dabei handelt es sich um die Inkaufnahme des vorzeitigen Todes als möglicher Nebenwirkung einer therapeutischen Maßnahme. Beispiele dafür sind die hoch dosierte Gabe von morphinhaltigen Schmerzmedikamenten und die intravenöse Applikation von Benzodiazepinen zur Bekämpfung von Unruhe- und Angstzuständen bei moribunden Patienten.</p> <h2>Die gesetzlichen Bestimmungen in Österreich</h2> <p>Der – ohne Fremdunterstützung durchgeführte – Suizidversuch ist in Österreich, wie in den meisten westlichen Ländern, nicht strafbar.<br /> <br /> Die aktive Sterbehilfe/Tötung auf Verlangen (§77 StGB) ist mit einem Strafausmaß von bis zu fünf Jahren bedroht. Die einzigen Länder, in denen aktive Suizidhilfe – unter bestimmten Auflagen – erlaubt ist, sind die Niederlande (seit 2001), Belgien und Luxemburg.<br /> <br /> Während der assistierte Suizid in vielen europäischen Ländern straffrei bleibt (in Deutschland etwa ist erst im November 2015 nach langer Debatte ein gesetzliches Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung beschlossen worden; die individuelle Suizidhilfe ist gesetzlich, wenn auch nicht von der Bundesärztekammer, weiterhin erlaubt), beträgt das Strafhöchstmaß für die „Mitwirkung am bzw. Beihilfe zum Suizid“ (§78 StGB) in Österreich ebenfalls fünf Jahre.<br /> <br /> Die passive Sterbehilfe ist hierzulande – wie in vielen Staaten – straffrei, wenn der Betroffene zuvor in dispositionsfähigem Zustand eine entsprechende Vorgehensweise, optimalerweise schriftlich in Form einer Patientenverfügung, festgelegt hat. Liegt eine solche nicht vor, muss versucht werden, den mutmaßlichen Willen des Betroffenen (also wie er vermutlich in der gegebenen Situation über sich entschieden hätte) zu eruieren.<br /> <br /> Die terminale Sedierung schließlich ist straffrei, da die effektive Behandlung von Schmerzen, Angst und Unruhe allgemein als das höhere Rechtsgut gegenüber der unbedingten Erhaltung des Lebens eines Patienten angesehen wird. Eine nicht ausreichende Schmerzbekämpfung durch den Arzt könnte juristisch sogar als – strafbare – Verweigerung ärztlicher Hilfeleistung angesehen werden.</p> <h2>Änderungsinitiativen in gegensätzliche Richtungen</h2> <p>In den letzten Jahren entstanden in Österreich, aber auch in anderen Ländern politische und gesellschaftliche Initiativen, welche den Diskurs über dieses Thema in die eine oder andere Richtung zu bewegen suchten. Im Jänner 2014 wurde der Verein „Letzte Hilfe – Verein für selbstbestimmtes Sterben“ gegründet, welcher als Vereinsziele zum einen die Beratung bezüglich Suizidmöglichkeiten und die allfällige Begleitung zu Sterbehilfe-Organisationen, zum anderen die Abschaffung des §78 (Verbot des assistierten Suizids) formulierte. Im Oktober 2014 wurde die Vereinsgründung gerichtlich aufgehoben, da das erstere Vereinsziel mit der österreichischen Rechtslage, konkret mit eben jenem §78, nicht kompatibel sei. Mittlerweile liegt die Sache beim Verfassungsgerichtshof, dessen Entscheidung noch ausständig ist.<br /> Neben Petitionen an das österreichische, das deutsche und das EU-Parlament mit dem Ziel, ein so bezeichnetes „Menschenrecht auf Sterbehilfe“ gesetzlich zu verankern, gab es auf der anderen Seite Bestrebungen, das Verbot der aktiven Sterbehilfe in den Rang der österreichischen Verfassung zu erheben. Ende 2014 fand im österreichischen Parlament eine Enquete-Kommission zur „Würde am Ende des Lebens“ statt. Die Parlamentarier konnten sich dabei auf die allgemein unumstrittenen und damit politisch wenig problematischen Forderungen nach Absicherung und Ausbau der Hospizbetreuung sowie einer Attraktivierung von Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht verständigen. Hinsichtlich einer Änderung der Gesetzeslage zum Thema Sterbehilfe wurde keine Einigung erzielt.</p> <h2>Positionspapier der Bioethikkommission und die Antwort der Suizidprävention</h2> <p>Am 9. Februar 2015 veröffentlichte die Bioethikkommission eine Stellungnahme mit dem Titel „Sterben in Würde“, in welcher „Empfehlungen zur Begleitung und Betreuung von Menschen am Lebensende und damit verbundene Fragestellungen“ behandelt wurden. Im Kapitel „Assistierter Suizid“ wurde mehrheitlich für eine Reform des §78 im Sinne einer Aufweichung des Verbotes der Beihilfe zum Suizid plädiert. Dabei tappte man leider wieder in die Abgrenzungsfalle „Suizid aus psychischen versus körperlichen Gründen“, entsprechend wurde verabsäumt, einen Schwerpunkt auf die spezifischen psychoonkologisch-psychotherapeutischen sowie psychopharmakologischen Behandlungsbedürfnisse von Menschen mit schweren somatischen Erkrankungen zu legen. Überhaupt wurde grundsätzlich von einer durchgängigen, vom Krankheitsprozess nicht beeinträchtigten Fähigkeit, nach dem freien Willen zu entscheiden, und einem dauerhaften, stabilen Sterbewunsch ausgegangen.<br /> <br /> Die Österreichische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (ÖGPP), die Österreichische Gesellschaft für Suizidprävention (ÖGS) und die Wiener Werkstätte für Suizidforschung lehnten in einer gemeinsamen Erklärung eine Änderung des §78 ab, da zum einen zu befürchten ist, dass ein solcher Schritt nur den Weg in Richtung „Tötung auf Verlangen“ ebnen soll. Zum anderen ist die Gefahr, dass jemand nur aus altruistischen Gründen (der Familie nicht mehr zur Last fallen wollen) Suizidhilfe verlangen könnte, nicht von der Hand zu weisen. Auch ist nicht klar, wie die von der Bioethikkommission geforderte „angemessene Überlegungsfrist zwischen Aufklärung und Entscheidung“ zu definieren ist. Eine suffiziente antidepressive Therapie kann bekanntlich mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Und wohl jeder in der Psychiatrie Tätige – Gleiches gilt auch für Hospiz- und Palliativmediziner – hat schon des Öfteren die Erfahrung gemacht, dass ein – auch sehr nachdrücklich vorgebrachter – Todeswunsch sich im Rahmen der Therapie relativieren und auflösen kann.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Etablierte Wirkstoffe und neue Ansätze
Die Wirksamkeit zugelassener Substanzen zur pharmakologischen Rückfallprophylaxe bei Alkoholabhängigkeit gilt bei geringen bis moderaten Effektstärken als gesichert. Die Nebenwirkungen ...
Depression: Schneller besser durch Biomarker?
Depressionen gehören zu den häufigsten und teuersten neuropsychiatrischen Erkrankungen. Grund dafür sind vor allem die lang anhaltende Dauer, der rezidivierende Verlauf und das ...
Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie
Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...


