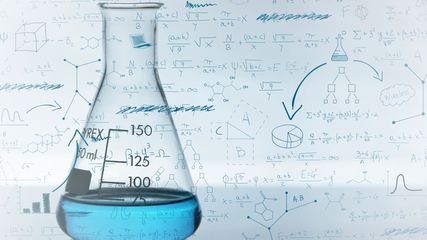Tiefenhirnstimulation im Einsatz gegen nicht motorische Symptome bei Parkinson
Jatros
Autor:
Dr. Gabriele Senti
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die bilaterale subthalamische Tiefenhirnstimulation (STN DBS) verbessert signifikant die motorischen Symptome der Parkinsonkrankheit (PD). Die Behandlung scheint aber auch auf nicht motorische Symptome positiv zu wirken und kann, bei fortgeschrittener PD als Kombinationstherapie eingesetzt, eine zusätzliche Verbesserung der motorischen Symptome bewirken.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Zahlreiche Studien belegen die signifikante Verbesserung der motorischen Symptome bei Patienten mit PD nach der Initiierung einer Therapie durch STN DBS. Über die Effekte der STN DBS auf nicht motorische Symptome ist allerdings relativ wenig bekannt.</p> <h2>Wirkung der STN DBS auf Lebensqualität von Parkinson­patienten</h2> <p>Auch wenn die STN DBS zur motorischen Verbesserung führt, spiegelt dies nicht automatisch auch die allgemeine therapeutische Wirkung für den Patienten in Bezug auf die sozialen und emotionalen Dimensionen der Lebensqualität wider. Górecka-Mazur et al. analysierten in ihrer beim EAN vorgestellten Studie die Auswirkungen der STN-DBS-Therapie auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL; „health-related quality of life“) von PD-Patienten. Dazu behandelten sie 25 PD-Patienten mit STN DBS und beurteilten die HRQoL anhand spezifischer Fragebögen zwei Wochen vor sowie drei, sechs und zwölf Monate nach der Operation.<br />Vor dem Eingriff wurde die HRQoL anhand des Parkinson’s Disease Questionnaire (PDQ-39) im Bereich „tägliche Aktivitäten“ am niedrigsten bewertet, gefolgt von „Mobilität“ und „Stigma der Erkrankung“. Nach drei Monaten STN DBS verbesserte sich die HRQoL in allen durch den PDQ-39 abgefragten Teilbereichen, mit Ausnahme von „sozialer Unterstützung“ und „Kommunikation“. Diese Verbesserungen wurden auch noch 6 Monate nach der Operation und beim 1-Jahres-Follow-up beobachtet. Bei der Bewertung der HRQoL mittels SF-36 („Short Form 36 health survey questionnaire“) und der WHOQol-Bref(„The Word Health Organization Quality of Life Test-Bref“)-Fragebögen zeigte sich eine Verbesserung der physischen und mentalen Dimensionen, wobei sie in der physischen Dimension stärker ausgeprägt war als in der mentalen. Die Autoren schließen aus diesen Ergebnissen, dass die STN DBS die gesundheitsbezogene Lebensqualität verbessert (EP2159).</p> <h2>Beeinflussung nicht motorischer Symptome durch STN DBS</h2> <p>S. Kurcova et al. widmeten sich in ihrer Pilotstudie ebenfalls den nicht motorischen Symptomen der PD. Daten von 24 Patienten mit fortgeschrittener PD, die sich einer STN DBS unterzogen, wurden in einer offenen prospektiven Studie analysiert. Die Patienten wurden präoperativ sowie einen und vier Monate nach der Implantation untersucht und bewertet, um Veränderungen in den gesamtmotorischen und nicht motorischen Symptomen zu bestimmen.<br />Die STN DBS verbesserte bei Patienten mit PD im ersten Monat signifikant die gesundheitsbezogene Lebensqualität (PDQ-39 Score; p=0,018) und reduzierte autonome Dysfunktionen (SCOPAAUT Score; p=0,002). Vier Monate nach der Implantation waren diese Werte jedoch wieder gestiegen. Die NMSS-Werte („non-motor symptoms scale“) verbesserten sich signifikant nach dem ersten Behandlungsmonat (p=0,0001) und blieben auch nach vier Monaten deutlich niedriger als vor der Stimulation (p=0,036). Es gab keinen signifikanten Unterschied bei den Schlafparametern gemessen anhand der Parkinson’s Disease Sleep Scale (PDSS) zwischen Baseline und der Kontrolle nach dem ersten Monat der Behandlung; nach vier Monaten STN DBS konnte jedoch eine Verbesserung in Form eines signifikanten Anstieges der PDSS-Werte beobachtet werden (p=0,026). Die UPDRS-MDS-Part-III-Scores zeigen eine signifikante Verbesserung einen Monat (p=0,0006) sowie vier Monate nach der Implantation (p<0,0001). Signifikante Ver­änderungen der FSFI(„Female Sexual Function Index“)- und IIEF(„International Index of Erectile Function“)-Werte nach einem bzw. vier Monaten STN DBS wurden nicht verzeichnet.<br />Die Autoren schließen daraus, dass STN DBS bei Patienten mit fortgeschrittener PD nicht nur die motorischen Symptome verbessert, sondern auch mehrere nicht motorische Parameter wie Schlaf, autonome Funktionen und Lebensqualität (EP2137).</p> <h2>Cross-over und Dualbehandlung bei fortgeschrittener PD</h2> <p>DBS und kontinuierliche intrajejunale Levodopa-Infusion (CLI) sind wirksame Therapien zur Behandlung von motorischen Symptomen bei fortgeschrittener PD. Sie verbessern die Lebensqualität und reduzieren durch Medikamente induzierte motorische Schwankungen und Dyskinesien. Manchmal hat die gewählte Therapie jedoch nicht die erwartete oder keine nachhaltige Wirkung. Die Patienten erhalten in diesem Fall eine kombinierte Therapie oder Cross-over-Therapien. Die Daten zur Therapiekombination sind jedoch nicht sehr umfangreich.<br />In einer retrospektiven Studie aus den Niederlanden wurden daher Daten von Patienten mit PD, die sich einer DBS unterzogen und eine CLI-Behandlung vor oder nach DBS begonnen hatten, analysiert. Elf Patienten, die zwischen Mai 2001 und Dezember 2015 gleichzeitig oder nacheinander mit DBS und CLI behandelt worden waren, wurden identifiziert. Von diesen waren 7 zunächst mit DBS behandelt worden, 4 hatten CLI als Erstbehandlung erhalten, und alle bis auf einen Patienten hatten beide Therapien fortgesetzt. Die Analysen zeigten, dass keiner der Patienten eine Verschlechterung seines Zustandes nach der zweiten fortgeschrittenen Therapie erfahren hatte. Fünf Patienten verzeichneten keine Verbesserung, während vier Patienten über eine mäßige und zwei Patienten über eine starke Verbesserung der motorischen Symptome berichteten.<br />Die Autoren schließen daraus, dass Patienten, bei denen die Wirkung der ersten fortgeschrittenen Therapie suboptimal ist, vom Wechsel zu einer anderen fortgeschrittenen Therapie oder von der Kombination von Behandlungen profitieren können (PR3060).</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 3. Kongress der European Academy of Neurology (EAN), 24.–27. Juni, Amsterdam
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...