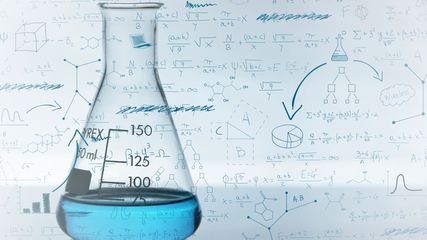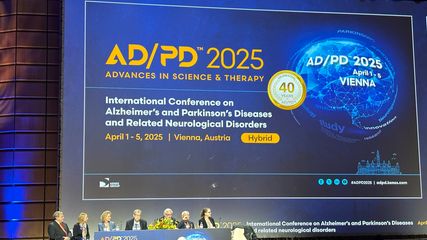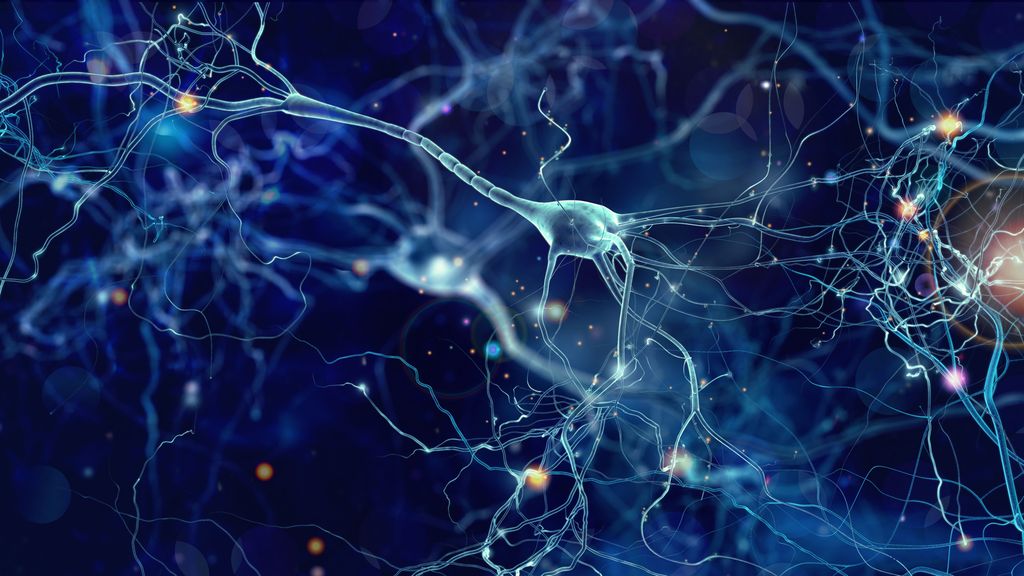
©
Getty Images/iStockphoto
Stolpersteine für die Versorgung von Epilepsie-Patienten
Jatros
30
Min. Lesezeit
14.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie in Leipzig im September 2017 konnte sich der Besucher einen Überblick über viele aktuelle Standards und neue Perspektiven im Fachgebiet verschaffen. Auch problematische, für den praktischen Alltag relevante Fragestellungen wurden diskutiert, zum Beispiel in der Epileptologie.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Anfallstagebücher zur Dokumentation von epileptischen Anfallsereignissen sind ungenau. Nach einer Video-EEGStudie von Priv.-Doz. Dr. Christian Hoppe von der Klinik für Epileptologie der Universität Bonn wird nur jeder zweite Anfall in Tagebüchern dokumentiert und die Anfallskalender sind bei zwei von drei Patienten unvollständig.<sup>1</sup> Dabei werden aufgrund solcher Anfallskalender Therapieentscheidungen getroffen und Einschränkungen hinsichtlich Beruf und Führerschein vorgenommen. Eine ungenaue Dokumentation geben Patienten und Angehörige auch für die Studiensituation an (Abb. 1<sup>2</sup>). Dennoch werden auf Basis von selbst berichteter Anfallsfrequenz Therapiestudien bewertet und Zulassungen erteilt. Selbst eine tägliche Erinnerung an die Anfallsdokumentation löste in einer Studie das Problem der teilweise nicht dokumentierten Anfälle nicht, betonte Dr. Hoppe. Das Problem: Patienten mit Epilepsie realisieren anfallsbedingt einfach nicht, dass sie gerade einen Anfall hatten. Das gilt insbesondere für nächtliche Anfälle. Auch viele Apps auf dem Mobiltelefon können das nicht ändern, weil sie auf die Eingabe des Anwenders angewiesen sind. Wie praxisrelevant das ist, zeigte eine ambulante EEG-Studie: Bei 21 von 57 vermeintlich anfallsfreien Patienten waren doch Anfallsereignisse nachzuweisen, 20 dieser 21 Patienten fuhren regelmäßig Auto.<sup>3</sup></p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1706_Weblinks_jatros_neuro_1706_s24_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="1095" /></p> <h2>Automatische Anfallsdetektion ist weiter Zukunftsmusik</h2> <p>Um Anfälle automatisiert festzustellen, können tonische und klonische Muskelkontraktionen, Atembewegungen und Atemfluss, Herzaktivität oder Schweißsekretion gemessen werden. Erste mobile Geräte sind auf dem Markt. So unterscheidet Epi- Care<sup>®</sup> free mit einem Handgelenkssensor akzelerometrisch normale Bewegungen von solchen bei einem generalisierten tonisch- klonischen Anfall. Die Sensitivität lag in einer Studie bei 89,7 % , die Falschpositiv- Rate war mit 0,2 pro 24 Stunden relativ gering. Allerdings hält Priv.-Doz. Dr. Rainer Surges, Aachen, die Methode noch nicht für ausreichend valid. In der Studie war die Stichprobengröße klein und es traten nur wenige Anfallsereignisse auf. Auch ein Im-Ohr-System mit Photoplethysmographie, Temperatursensor und Akzelerometer, das er selber untersucht, ist noch nicht annährend marktreif, weil viele Artefakte auftreten. Ein Tübinger Team testet ein EKG-Brustgurtsystem, das in einer Vorstudie 73 % der fokalen und 70 % der generalisierten Anfälle in der Nacht identifizieren konnte. Rätsel geben aber individuelle Unterschiede auf: Während bei einer ganzen Reihe von Patienten jeder Anfall von dem System dokumentiert wurde, zeigte es bei anderen Patienten mehrere oder sogar die Mehrzahl der Anfälle nicht an. Auch die Falsch-positiv-Rate war noch zu hoch. Für Dr. Surges ist wegen der fehlenden umfassenden klinischen Evaluation der Geräte zur automatischen Anfallserfassung derzeit noch kein einziges empfehlenswert.</p> <h2>Drohen weitere Einschränkungen für Valproat?</h2> <p>Das Antikonvulsivum Valproat ist einerseits hochwirksam zur Anfallskontrolle bei Epilepsie, auf der anderen Seite nachweislich teratogen. In Frankreich sieht sich das pharmazeutische Unternehmen Sanofi derzeit einer Massenklage von mehreren tausend Betroffenen gegenüber, weil Ärzte und Patienten nicht ausreichend über die Risiken von Valproat in der Schwangerschaft informiert worden seien, berichtete Prof. Dr. Bettina Schmitz vom Vivantes Humboldt-Klinikum Berlin. Nach dem seit 1999 bestehenden EURAP-Register mit inzwischen 12 892 abgeschlossenen Beobachtungen von Schwangerschaften und antikonvulsiver Therapie liegt die Rate für eine große Fehlbildung unter Valproat je nach Dosierung zwischen 5,6 % (<700mg/ Tag) und 24,2 % (≥1500mg/Tag). Zwar erhöhen auch andere Antiepileptika das Risiko für große Fehlbildungen dosisabhängig, jedoch in deutlich geringerem Maße: Für Carbamazepin gab Prof. Schmitz eine Rate von 3,4 % (<400mg/Tag) bis 8,7 % (≥1000mg/Tag) und für Lamotrigin von 2 % bei einer Dosis von <300mg/Tag und 4,5 % bei einer höheren Dosis an. Daneben haben sich die Belege verdichtet, dass Kinder mit Valproatexposition im Mutterleib ein erhöhtes Risiko für Autismus- Spektrum-Störung und Kindheitsautismus, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, Entwicklungsverzögerungen und Intelligenzminderung haben. Auf der anderen Seite gilt Valproat als das Antikonvulsivum mit der höchsten Wirksamkeit bei generalisierten Anfällen, und das auch in der Schwangerschaft, in der Anfallsereignisse nicht nur die Mutter, sondern auch den Fetus gefährden können. Deshalb erwartet Prof. Schmitz kein Aus für das Antikonvulsivum in der EU, vermutet aber weitere Einschränkungen.</p> <h2>Neue EU-weite Maßnahmen nach dem Jahreswechsel erwartet</h2> <p>Seit 2014 empfiehlt die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Einsatz bei Frauen im gebärfähigen Alter wie auch bei Mädchen erst, wenn andere Therapien versagt haben. Es wird seitdem die schriftliche Bestätigung der Zustimmung der Patientin zur Therapie empfohlen.<sup>4</sup> In Deutschland wurde im April 2017 eine mit einer „blauen Hand“ versehene Patientenkarte als weitere Risikominimierungsmaßnahme für Valproat enthaltende Arzneimittel eingeführt.<sup>5</sup> Sie liegt jeder Originalpackung bei, um Schwangere, weibliche Jugendliche und Frauen im gebärfähigen Alter, aber auch Männer an die potenziellen Risiken der Valproattherapie bei Kinderwunsch zu erinnern.</p> <p>Am 24. September fand in London eine öffentliche Anhörung der europäischen Arzneimittelagentur EMA und ihres Pharmakovigilanzkomitees PRAC statt.<sup>6</sup> Zu Wort kamen sowohl Patientenvertreter, Angehörige und Betreuer als auch Ärzte, Pharmazeuten, Wissenschaftler und Pflegekräfte. Dabei wurde ein immer noch sehr unterschiedliches Niveau von Aufklärungsmaßnahmen in den EU-Mitgliedsländern deutlich. Bis Januar 2018 wollen PRAC und EMA Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der Therapie mit Valproat-haltigen Medikamenten beschließen (vgl. Tab. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1706_Weblinks_jatros_neuro_1706_s25_tab1.jpg" alt="" width="1417" height="991" /></p> <h2>Ungeeignete Therapie beim Status epilepticus</h2> <p>Eine Befragung von ambulanten Patienten an Epilepsiezentren in Frankfurt und Marburg deutet darauf hin, dass sehr oft ungeeignete Benzodiazepine mit langsamer Absorption bei oraler Gabe als Notfallmedikament bei Status epilepticus (SE) verordnet werden.<sup>7</sup> Von 481 Patienten berichteten 77 (16 % ) von einem SE in der Vorgeschichte, 134 (28 % ) gaben an, im Vorjahr die Verordnung für ein Notfallmedikament erhalten zu haben. Am häufigsten waren dies Lorazepam-Schmelztabletten sublingual (n=88, 66 % , mittlere Dosis 1,6mg), Midazolamlösung bukkal (n=32, 24 % ; 7,5mg) und Diazepam rektal (n=24, 18 % ; 10,2g). Lorazepam wird als Notfallmedikament bei SE vorrangig in der i.v. Applikation empfohlen, da es bei oraler Gabe eine Vorlaufzeit von etwa 30 Minuten hat. Midazolam bukkal ist nur bis zum 18. Lebensjahr zugelassen, Midazolam intranasal wird häufig angewendet, ist aber gar nicht als Notfallmedikation bei SE zugelassen.<sup>4</sup></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 90. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie,
20.–23. September 2017, Leipzig
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Hoppe C et al.: Epilepsy: accuracy of patient seizure counts. Arch Neurol 2007; 64: 1595-9 <strong>2</strong> Blachtu B et al.: Subjective seizure counts by epilepsy clinical drug trial participants are not reliable. Epilepsy Behav 2017; 67: 122-7 <strong>3</strong> Fattouch J et al.: Epilepsy, unawareness of seizures and driving license: the potential role of 24-hour ambulatory EEG in defining seizure freedom. Epilepsy Behav 2012; 25: 32-5 <strong>4</strong> Elger E et al.: Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter. Entwicklungsstufe S1. Stand 30.04.2017. http://www.awmf.org/leitlinien/ detail/ll/030-041.html <strong>5</strong> Patientenkarte als weitere, die bisherigen Maßnahmen ergänzende Risikominimierungsmaßnahme für Valproat enthaltende Arzneimittel; https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arzneimittel/ Pharmakovigilanz/Risikoinformationen/RisikoBew Verf/s-z/valproat_patientenkarte_anlage.docx;jsessionid =E0D1D7E2AB114A200C99F973305C6024.1_cid329?__ blob=publicationFile&v=4 <strong>6</strong> Öffentliche Anhörung des Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) am 26. September 2017; http://www.ema.europa.eu/ema/ index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/09/ news_detail_002816.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 <strong>7</strong> Kadel J et al.: Einsatz von Notfallmedikamenten bei Erwachsenen mit Epilepsie. DGN 2017, Abstract P 820</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...