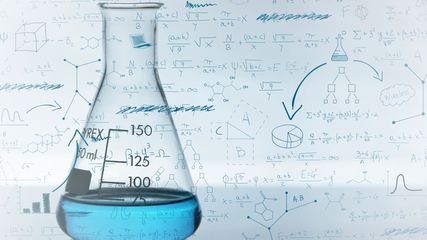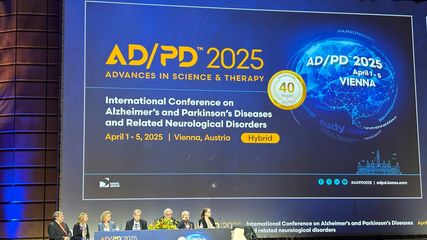©
Getty Images
Sechs aktuelle Themen der Neuroorthopädie
Jatros
Autor:
Prof. h.c. Dr. Walter Michael Strobl
<br>Leiter der Orthopädischen Kinderklinik Aschau im Chiemgau (D)<br>E-Mail: w.strobl@bz-aschau.de
30
Min. Lesezeit
12.07.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Was wissen wir heute? Was wissen wir noch nicht? Und in welche Richtung sollten sich unsere Behandlungs- und Forschungsaktivitäten entwickeln? Das 13. Internationale Symposium für Neuroorthopädie und Rehabilitation, das im Jänner im Orthopädischen Spital Speising, Wien, stattfand, versuchte, eine Standortbestimmung vorzunehmen und Antworten auf die Fragen in sechs aktuellen Themenbereichen zu finden.<br> </p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Vor 35 Jahren stellte das erste Neuro­orthopädie-Symposium eine der ersten Möglichkeiten dar, Fragen zur Verbesserung der Lebensqualität bei schweren neurologischen Erkrankungen, Bewegungsstörungen und Bewegungsbehinderungen gemeinsam mit international bekannten Experten im multiprofessionellen Team zu diskutieren. Seither hat dieses Format an Attraktivität gewonnen und wurde mehrfach kopiert.<br />Die komplexe interdisziplinäre Behandlung stellt nach wie vor eine der größten Herausforderungen der modernen Medizin dar. Trotz der weltweiten Förderung hochdotierter neurowissenschaftlicher Forschungsprojekte ist noch kein Ersatz geschädigter Muskeln, Nervenzellen und neuronaler Funktionen möglich. Jedoch hat das Wissen über die Möglichkeiten motorischen Lernens, darüber, wie menschliche Bewegung entsteht und gesteuert wird, über die Biomechanik des normalen und gelähmten Gangbildes, über die Vorbeugung von zusätzlichen Deformitäten der Muskeln und Gelenke, über die Verminderung von Spastik und die Möglichkeiten des Muskelkraft- und Koordinationstrainings zu einer Vielzahl neuer Behandlungsansätze und therapeutischer Verfahren geführt.</p> <h2>Thema 1 – „Die Muskeln kräftigen“</h2> <p>Das Wissen über den Muskel, seine Pathophysiologie, Adaptationsvorgänge und Wirkung bei neuromotorischen Erkrankungen ist beschränkt, ebenso wie das über die konkreten Auswirkungen aller in der Praxis angewandten Behandlungsverfahren. Neue biomechanische Studien der letzten Jahre zeigen, dass Muskelschwäche als Hauptfaktor für Gangpathologien betrachtet werden muss und Spastik diese Muskelschwäche kompensiert.<sup>1</sup> Schwerkraft, Massenträgheit und Beschleunigung werden auch bei zerebralen Bewegungsstörungen durch muskuläre Hyperaktivität geschickt genutzt, um Energie zu sparen. Neuromuskuläre Kontrolldefizite scheinen nicht für die muskuläre Hyperaktivität verantwortlich zu sein.<sup>2</sup><br />Spastik, Dystonie und das primäre Problem der Muskelschwäche können durch Gewichtsübernahme und Krafttraining positiv beeinflusst werden.<sup>3</sup> Intervalltraining mit Ganzkörpervibrationstherapie zeigt ebenso einen positiven Effekt. Die orthetische oder – noch effektiver – chirurgische Verkürzung von Muskeln führt zu einem Kraftgewinn, der in einer Funktionsverbesserung sichtbar wird. Bei Gehfähigen sind muskelverkürzende Operationen äußerst effektiv. Muskelschwächende Verfahren wie offene oder perkutane Verfahren dürfen – um langfristige Schäden zu vermeiden – nur nach eingehender Analyse (3D-Ganganalyse), punktuell und dosiert an funktionell störenden antagonistischen Muskeln angewandt werden. <br />Häufiger als Eingriffe an den Muskeln ist die Korrektur von knöchernen Fehlstellungen notwendig, um die veränderten Hebelarme für eine effektivere Wirkung der Muskeln zu rekonstruieren. Orthesen können dies nur bei geringen knöchernen Deformitäten und auch nur für die Zeit der Verwendung leisten. <br />Auch bei Nicht-Gehfähigen ist eine genaue Analyse der Muskelschwächen, Muskelverkürzungen, Gelenkkapselkontrakturen und knöchernen Fehlstellungen mit veränderten Hebelarmen für die Muskulatur notwendig, um das Risiko häufiger Rezidive gegen das Risiko funktioneller Verluste abzuwägen. Botulinumtoxin-Programme konnten auch in Kombination mit Orthesen den Prozentsatz der notwendigen Operationen nicht reduzieren und die Hüftgelenkentwicklung bei Kindern nicht verbessern.<sup>4</sup> Botulinumtoxin findet seinen Einsatz immer mehr und äußerst erfolgreich in der derzeit noch Off-Label-Anwendung bei schmerzhafter Spastik und anderen therapieresistenten Schmerzen des Bewegungsapparates im Jugendlichen- und Erwachsenenalter. <br />Aus Sicht der Patienten sind bei diesen Deformitäten (z.B. Hüftluxationen) rekonstruktive Verfahren unbedingt notwendig, um Schmerzfreiheit, mehr Beweglichkeit („erstes Mal allein auskleiden war ein unglaublicher Triumph“) und ein Leben mit neuer Perspektive zu erreichen. Der große Aufwand einer OP stünde in keinem Verhältnis zu dem ungeheuren persönlichen Gewinn.</p> <h2>Thema 2 – „Neuromotorische Gangstörungen: orthetische und operative Gangbildverbesserung“</h2> <p>Die Differenzierung von Gangstörungen entsprechend ihrer Pathophysiologie ermöglicht die Anwendung differenzierter orthetischer und operativer Behandlungsverfahren. Als zugrunde liegendes Evaluationsverfahren hat sich die 3D-Ganganalyse durchgesetzt. <br />Technologische Veränderungen haben in erster Linie das Ziel, die Alltagstauglichkeit der Hilfsmittel für die Betroffenen und Betreuer zu verbessern: Die CAD-CAM-Anpassung funktioniert schon in vielen Fällen und der Start mit 3D-Druck-Orthesen, die dank ihrer materialminimierenden Konstruktionsform eine optimale Akzeptanz bei Kindern und Erwachsenen erreichen, ist erfolgt.<br />Die 3D-Ganganalyse ist bereits Goldstandard für die Neuentwicklung, die individuelle Qualitätskontrolle und die Verlaufsdokumentation von Geh-Orthesen aller Art. So können in neuen Studien die Wirkung der Dorsalsperre, die zu einer Verschlechterung des Gangbildes führt, das Orthesengewicht, das als Leichtbau Vorteile bietet, und die vorteilhafte Überkorrektur eines flexiblen Plattfußes mit einer neuartigen Unterschenkel-Geh-Orthese exakt geprüft werden. <br />Durch die Verbindung von mechanischen mit elektronischen orthopädietechnischen Lösungen werden in Zukunft intelligentere Produkte im Bereich der Orthetik, Prothetik und Reha-Hilfsmittelversorgung entwickelt werden. Aufrechte Mobilität mit Exoskeletten stellt derzeit nur eine für therapeutische Zwecke anwendbare Zwischenlösung dar, bis nach weiteren Fortschritten bei der Entwicklung neuer Materialien, die ihre Eigenschaften thermisch oder elektronisch ändern können, eine neue Soft-Orthesen-Generation entstehen dürfte. Diese kann im Idealfall sogar mit Brain-Machine-Interface willkürlich gesteuert werden. Entwicklungsabteilungen arbeiten bereits daran.</p> <h2>Thema 3 – „Schmerzen: Prävention statt Reparaturmedizin“</h2> <p>Mehrere Studien der vergangenen Jahre zeigen, dass die Lebensqualität von Kindern und Erwachsenen mit Behinderungen hauptsächlich durch unterschätzte Schmerzen des Bewegungsapparates beeinträchtigt wird. Für das Erreichen und Erhalten der Schmerzfreiheit, Mobilität, Selbstständigkeit und Teilhabe werden daher strukturierte Programme zur Prävention von Muskel-Skelett-Deformitäten in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. <br />Im Grundschulalter schätzen Kinder mit Zerebralparesen ihre Lebensqualität als gleich gut ein wie Kinder ohne Erkrankungen.<sup>5</sup> Eltern und Behandler sehen dies grundsätzlich anders, sie beurteilen deren Lebensqualität signifi­kant schlechter.<sup>6</sup> Andererseits werden Schmerzen des Bewegungsapparates im Jugend- und jungen Erwachsenenalter von Eltern und Behandlern unterschätzt. Betroffene schätzen in der Folge ihre Lebensqualität deutlich schlechter ein als angenommen. <br />Mehr als 100 000 Kinder mit einer komplexen Bewegungsstörung aufgrund von Nerven-, Muskel- und Skelettsystem-Erkrankungen leben heute im deutschsprachigen Raum. Dazu zählen Greif-, Gang-, Sitz-, Haltungsstörungen bei der bei Weitem größten Gruppe der Zerebralparesen, aber auch bei angeborenen Fehlbildungen, nach Schädel-Hirn-Verletzungen, Neuropathien, progredienten Muskelerkrankungen, Arthrogryposen, bei chronischen Arm-, Hand-, Wirbelsäulen-, Hüft-, Knie- und Fußerkrankungen. Muskelschwäche, Ungleichgewicht zwischen Muskelgruppen, Gelenkkontrakturen und -luxationen, Fehlstellungen, Arthrosen, Schmerzen und eingeschränkte Mobilität treten bei allen Betroffenen auf. Hüftluxation und Skoliose werden von der WHO den 100 lebensbedrohenden Krankheitsbildern zugeordnet.<br />Die Pathophysiologie dieser Deformitätenentwicklung ist bis heue nicht vollständig geklärt, jedoch scheinen sowohl extrinsische Faktoren, wie Lagerung und Bewegungsmangel zwischen Muskeln und Faszien, als auch intrinsische, wie histologische Veränderung der Muskulatur, dafür verantwortlich zu sein. Kontrakturen entstehen jedenfalls nicht primär durch Spastik, sondern durch Fibrosen.<sup>7</sup> <br />Aus Sicht der Patienten verändern chronische Schmerzen und rasche Ermüdbarkeit bei Kontrakturen und Luxationen das Leben vollständig und rauben subjektiv jede Zukunftsperspektive. Betroffene halten Vorbeugung für extrem wichtig und weisen darauf hin, dass Eltern bei der Entscheidung für eine invasive Behandlung immer in einem Spannungsverhältnis leben, bei dem sie Unterstützung brauchen. Langzeittherapien müssen immer auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden, damit so wenig Zeit für soziale Teilhabe wie möglich verloren geht. <br />Prävention von Deformitäten sollte möglich sein: Erste Patientenregister, Screening- und Präventionsprogramme konnten in Skandinavien die Zahl schwerer Muskel-Skelett-Veränderungen bei Zerebralparesen im Jugendalter zusammen mit früh beginnenden, konservativ-operativen orthopädischen Behandlungsprogrammen auf einen Bruchteil des bei uns noch üblichen Prozentsatzes senken.<sup>8–10</sup> <br />Zur Vermeidung von Hüftluxationen reicht die Hüftampel nicht aus; ein Screeningprogramm, das dem CPUP-Programm Schwedens entspricht und dem Screeningprogramm Australiens ähnelt, sollte implementiert werden. Die zugrunde liegenden Screeningparameter sollten nun nach Vorliegen der Delphi-Studie konsentiert werden. Kriterien für regelmäßige klinisch-radiologische Untersuchungen könnten die Stufen des Gross Motor Function Classification System (GMFCS) sein (Level I: Rö bei Verschlechterung bzw. Einschulung; Level II: im 2., 6., 10., 14. Lj., dann alle 4 Jahre; Level III–V: bei initialer Vorstellung im 1.–2. Lj., dann jährlich bis 7a bzw. bis der Migrationsindex stabil ist). Ab einem Migrationsindex von 30 % müssen die Kinder einem neuroorthopädisch erfahrenen Kinderorthopäden vorgestellt werden. Bis es einen Konsens zu den Screeningparametern gibt, könnten die CPUP-Kriterien als Orientierungshilfe verwendet werden. <br />Die Vermeidung anderer Deformitäten, wie Kontrakturen der Extremitätengelenke und Wirbelsäulenveränderungen, sollte in dieses Screeningprogramm durch strukturierte klinische Untersuchungen integriert werden. Physio- und Ergotherapie sollen in die Schulung der Bewegungsmessungen verantwortlich miteinbezogen werden. Laut der vorgestellten Wirbelsäulenampel sind bei GMFCS IV und V, die ein 70 % iges Skolioserisiko aufweisen, ab dem 3. Lebensjahr zusätzliche regelmäßige Röntgenkontrollen der Wirbelsäule notwendig.</p> <h2>Thema 4 – „Funktionsverbesserung durch neue Ansätze“</h2> <p>Mehrere biomechanische, bewegungsanalytische und neurowissenschaftliche Studien der letzten Jahre stellen die bisherigen konservativen therapeutischen und medikamentösen Ansätze sowie operative Methoden, wie offene Muskelverlängerungen mit postoperativer Immobilisation, infrage. Arbeiten aus Hirnforschung, Neuroradiologie, Schmerztherapie, Materialforschung, Neurorehabilitation, Biomechanik, Bewegungsanalyse und Neuroorthopädie haben neue Ansätze der Behandlung von Kindern und Erwachsenen mit Bewegungsbehinderung aufgezeigt. Die Integration neuer Methoden der Neurorehabilitation, wie repetitive, imaginierte, rhythmisch intendierte Bewegungsbehandlungen in ausreichend hoher Intensität, und neuer Methoden der chirurgischen Neuroorthopädie, wie minimal invasive (weil minimal muskelschwächende) Muskelverkürzungen, Hebelarmoptimierungen und winkelstabile Osteosynthesen, scheint den zukünftigen Behandlungspfad vorzuzeichnen.</p> <h2>Thema 5 – „Rumpforthetik: von Standardhilfsmitteln zur digitalen Anpassung“</h2> <p>Neuromuskuläre Wirbelsäuleninstabilität bedarf einer individuellen Diagnostik und Behandlungsplanung. Das Ziel ist die Balancierung der Kräfte des Rumpfes, um die Kopfkontrolle mit Sensorik und sensomotorischen Aufgaben der oberen Extremitäten zu erleichtern. Pulmonale, kardiale und Ernährungsprobleme müssen sowohl bei der orthetischen als auch operativen Behandlung berücksichtigt werden. Bei der Korsettversorgung ist – im Gegensatz zur Gipstechnik – durch Digitalisierung ein für den Patienten stressfreierer Anpassvorgang erreichbar. Für die Anpassung einer Sitzunterstützung bietet der „Sitability Chair“ inklusive Foto- und Videodokumentation Vorteile gegenüber bisherigen Verfahren. ICF-Fragebögen werden für die Probephase entwickelt. <br />Der Vakuumabdruck behält seinen Stellenwert für gezielte Fragestellungen. Studien zeigen, dass sowohl starre als auch sensoorthetisch durch Kompression wirkende Korsette bei richtiger Indikationsstellung eine sehr gute Rumpfstabilisierung und verbesserte Lungenfunktion erreichen lassen.</p> <h2>Thema 6 – „Versorgungsstrukturen für Transition und Erwachsene“</h2> <p>Die Zahl und somit der Beratungs- und Versorgungsbedarf Erwachsener mit Zerebralparese steigen kontinuierlich. Sowohl Menschen mit leichteren Einschränkungen im Alltag, die einen Beruf erlernen, die Teilnahme am Arbeitsmarkt erreichen und eine Familie gründen können, als auch schwer mehrfachbehinderte Menschen finden derzeit kaum eine strukturierte, für ihre Erkrankung spezifische, multiprofessionelle Betreuung. Für Schmerzfreiheit, Mobilität, Selbstständigkeit und soziale sowie berufliche Teilhabe benötigen sie eine permanente Unterstützung, Beratung und Behandlung durch Experten. <br />Schmerzen sind ein wichtiges Thema und tragen am stärksten zur subjektiven Beeinträchtigung der Lebensqualität bei. Schmerzen, Muskelschwäche, Fuß- und Handfehlstellungen, Kontrakturen der Arm- und Beingelenke, Hüft-, Patella-, Fußgelenk-, Handgelenk- und Schulterluxationen und Wirbelsäulendeformitäten können auch im Erwachsenenalter in den meisten Fällen noch ausreichend behandelt werden. Regelmäßiges Walken, Bewegungstherapie, Krafttraining, gezielter Sport und Rehabilitation sind einfache Verfahren, aber nur bei leichten Problemen ausreichend. Bei Menschen mit schwerer Behinderung regulieren Steh- und Gehtherapie – neben der Förderung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeit – die Neurotransmitterausschüttung und helfen, psychische Stabilität und Motivation zu verbessern. <br />Hilfsmittel können Muskelschwächen oder Lagerungsprobleme beseitigen. Medikamente wie Baclofen oder Botulinum­toxin können bei (schmerzhafter) Muskelüberaktivität unterstützend eingesetzt werden. Operationen können Muskeln entspannen, kräftigen oder eine Hand- oder Fußfehlstellung wie Spitzfuß, Klumpfuß, Plattfuß, Hohlfuß oder eine Gelenk­luxation beseitigen. Operative Muskelverkürzung, neue Nahttechniken und winkelstabile Osteosynthesen ermöglichen eine frühere postoperative Vollbelastung mit geringerem Verlust an Muskelkraft.<sup>11, 12</sup> Wiederentdeckte perkutane Operationstechniken ermöglichen bei vertretbar erhöhtem Risiko einen schmerzfreien Therapiebeginn am ersten postoperativen Tag. Die postoperative Frühmobilisation ist dabei sehr wichtig, um zusätzliche Muskelschwächen zu vermeiden. Neuronale Vernetzung und motorisches Lernen werden besonders durch regelmäßige, rhythmische, akustische, repetitive Übungen gefördert.<sup>13, 14</sup> Robotik-gestützte Bewegungstherapie, Lokomotionstherapie und Vibrationstherapie scheinen besonders dafür geeignet.<sup>15–17</sup> Patientenschulung ermöglicht Fast-Track-Behandlungspläne auch in der Neuroorthopädie mit hoher Akzeptanz und Patientenzufriedenheit. Unterstützte Kommunikation und Smartphone-Apps sind hilfreich einsetzbar. <br />Zugang zu spezialisierten Institutionen ist somit ein wichtiges Thema. Diese sollten den Patienten Möglichkeiten für persönliche Assistenz, Ausbildungs-, Berufs-, Hilfsmittel-, Sport-, Rehabilitations-, psychologische, Gesundheits- und Finanzierungsberatung entsprechend dem Grad ihrer Einschränkungen bieten.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Schweizer K et al.: Gait Posture 2014; 39(1): 80-5 <strong>2</strong> Brunner R, Rutz E: J Child Orthop 2013; 7(5): 367-71 <strong>3</strong> Dodd KJ et al.: Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(8): 1157-64 <strong>4</strong> Willoughby K et al.: Dev Med Child Neurol 2012; 54(8): 743-7 <strong>5</strong> Vinson J et al.: J Dev Phys Disabil 2010; 22(5): 497-508 <strong>6</strong> Ramstad K et al.: Disabil Rehabil 2012; 34(19): 1589-95 <strong>7</strong> Koman LA et al.: Orthop Clin North Am 2010; 41(4): 519-29 <strong>8 </strong>Elkamil AI et al.: BMC Musculoskelet Disord 2011; 12: 284 <strong>9</strong> Robb JE, Hägglund G: J Child Orthop 2013; 7(5): 407-13 <strong>10</strong> Hägglund G et al.: Bone Joint J 2014; 96-B(11): 1546-52 <strong>11</strong> Haefeli M et al.: J Child Orthop 2010; 4(5): 423-8 <strong>12</strong> Thompson N et al.: J Bone Joint Surg Br 2010; 92(10): 1442-8 <strong>13</strong> Bütefisch C et al.: J Neurol Sci 1995; 130(1): 59-68 <strong>14</strong> Sterr A et al.: Arch Phys Med Rehabil 2002; 83(10): 1374-7 <strong>15</strong> Hesse S et al.: Scand J Rehabil Med 1998; 30(2): 81-6 <strong>16</strong> Schroeder AS et al.: Dev Med Child Neurol 2014; 56(12): 1172-9 <strong>17</strong> El-Shamy SM: Am J Phys Med Rehabil 2014; 93(2): 114-21</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...