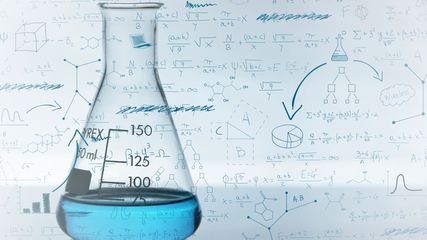<p class="article-intro">Chronische Kopfschmerzen sind eine grosse therapeutische Herausforderung. In der folgenden Übersicht werden die wichtigsten Formen anhand der aktuellen Diagnosekriterien der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft besprochen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der chronischen Migräne.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Ein Medikamentenübergebrauch sollte unbedingt erkannt und behandelt werden.</li> <li>Differenzialdiagnostisch muss auch an eine benigne intrakranielle Druckerhöhung oder andere sekundäre Ursachen gedacht werden.</li> <li>Neue Therapieverfahren stehen für die chronische Migräne zur Verfügung, neben monoklonalen Antikörpern gegen das «calcitonin gene-related peptide» (CGRP) oder dessen Rezeptor auch Neurostimulationsverfahren, welche ebenso bei chronischem Clusterkopfschmerz zum Einsatz kommen.</li> </ul> </div> <p>Viele Patienten verbringen ihr ganzes Leben mit Kopfschmerzen; die meisten Krankheiten würde man bereits aufgrund dieser Tatsache als «chronisch» bezeichnen. Die Klassifikation der Internationalen Kopfschmerzgesellschaft definiert den Begriff jedoch anders (ICHD-3, siehe Tab. 1).<sup>1</sup> Bei Migräne und Spannungstypkopfschmerz liegt die Grenze bei 15 oder mehr Tagen pro Monat über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten. Bei den trigeminoautonomen Kopfschmerzen wird als «chronisch» definiert, wenn die kurz dauernden Attacken über mindestens ein Jahr auftreten, mit maximaler Pause von drei Monaten. Die sekundären Kopfschmerzen gelten wiederum ab drei Monaten als chronisch. Die Prävalenz chronischer Kopfschmerzen liegt bei 3–5 % in der Allgemeinbevölkerung, wobei es sich in etwa der Hälfte der Fälle um Medikamentenübergebrauchskopfschmerz handelt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Innere_1905_Weblinks_lo_innere_1905_s13_tab1_riederer.jpg" alt="" width="550" height="145" /></p> <h2>Differenzialdiagnostik</h2> <p>Bei chronischen Kopfschmerzen sollte eine ausführliche neurologische Abklärung zum Ausschluss sekundärer Ursachen erfolgen. Ein Kopfschmerztagebuch, in dem neben den klinischen Angaben wie Frequenz, Dauer und Intensität auch Medikamente erfasst werden, kann die Diagnose weiter unterstützen. Zusätzlich sollten auch Komorbiditäten wie Angststörung und Depression in Betracht gezogen werden.</p> <h2>Primäre Kopfschmerzen</h2> <p>Beim chronischen Spannungskopfschmerz sind die Schmerzen zumeist moderat, bilateral drückend, ohne Begleitsymptome. Oft steht auch nicht die Beeinträchtigung im Alltag im Vordergrund, sondern die Angst vor einer gefährlichen/ bedrohlichen Ursache.<br />Die neue Definition der chronischen Migräne berücksichtigt, dass nicht alle Kopfschmerztage migränetypisch sein müssen, was der Begriff «transformed migraine» schön beschreibt. Es besteht jedoch eine klare Trennung zum chronischen Kopfschmerz vom Spannungstyp.<br />Beim chronischen Clusterkopfschmerz treten die eher kürzer dauernden (15– 180 min), einseitigen Attacken wiederkehrend über eine lange Dauer auf. Alle Attacken werden von mindestens einem autonomen Symptom oder Unruhe begleitet. Auch von den weiteren trigeminoautonomen Kopfschmerzen sind chronische Formen bekannt. Beim SUNCT-Syndrom («short lasting unilateral neuralgiform headache with conjunctival injection and tearing») liegt die Attackendauer zwischen 1 und 600 Sekunden, bei der paroxsymalen Hemikranie zwischen 2 und 30 min. Die Hemicrania continua beschreibt einen kontinuierlichen halbseitigen Kopfschmerz, oft mit Exazerbationen, begleitet von trigeminoautonomen Symptomen, welcher mindestens 3 Monate dauert. Speziell an den letzten beiden Kopfschmerztypen ist das vollständige Ansprechen auf therapeutische Dosen von Indomethacin (Tagesdosis 150–225 mg).</p> <h2>Sekundäre Kopfschmerzen</h2> <p>Der Medikamentenübergebrauchskopfschmerz («medication overuse headache», MOH) ist der häufigste chronische Kopfschmerz und gehört formal zur Gruppe der sekundären Kopfschmerzen, wenn auch in der Regel ein primärer Kopfschmerz zugrunde liegt und dieser durch vermehrten Bedarf an Akutmitteln transformiert. Entsprechend gilt auch die «15 oder mehr Tage pro Monat seit mindestens 3 Monaten»-Regel für die Kopfschmerzen, welche jedoch durch die Zahl der Behandlungstage pro Monat komplettiert wird. Für einfache Analgetika und NSAR sind dies 15 Tage pro Monat, bei Triptanen, Opiaten und Mischpräparaten bereits 10 Tage pro Monat.<sup>1</sup> Bei Clusterkopfschmerzen entsteht sehr selten ein MOH, wobei meist eine komorbide Migräne vorhanden ist.<sup>2</sup><br />Laut der zweiten Ausgabe der Kopfschmerzklassifikation kann der MOH erst nach einem erfolgreichen Medikamentenentzug diagnostiziert werden, was die Diagnose spezifischer macht, aber für den klinischen Alltag nutzlos ist. In der aktuellen Klassifikation ist die Diagnose sensitiver: Wenn sich ein chronischer Kopfschmerz nicht durch eine Pause des Einsatzes von Akutmitteln bessert, wird die Diagnose im Verlauf angepasst, zum Beispiel auf chronische Migräne.<br />Bei zusätzlicher Lageabhängigkeit der chronischen Kopfschmerzen ist an eine intrakranielle Liquordruckveränderung als Ursache zu denken, entweder eine benigne intrakranielle Hypertension (vormals Pseudotumor cerebri), wobei sich der Kopfschmerz in aufrechter Position bessert, oder aber ein Liquorunterdrucksyndrom, welches meist nach Durapunktion, aber auch spontan auftreten kann. Posttraumatische Kopfschmerzen (z. B. persistierender Kopfschmerz, zurückzuführen auf ein Schädel-Hirn- Trauma) müssen gemäss IHS-Kriterien innerhalb von 7 Tagen nach einem Trauma auftreten. Oft korreliert hierbei das Ausmass der Kopfschmerzproblematik nicht mit der Schwere des Traumas.</p> <h2>Therapeutische Optionen</h2> <p>Eine detaillierte und aktuelle evidenzbasierte Darstellung der Therapie von Kopfschmerzen ist in den Therapieempfehlungen der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft zu finden: www.headache.ch/ DirectLinks/ Therapieempfehlungen.</p> <p><strong>Chronische Migräne<br /></strong>Die evidenzbasierten Möglichkeiten zur prophylaktischen Therapie der chronischen Migräne bestehen aus Topiramat und Botulinumtoxin A, welches gemäss speziellem Schema an 31 Stellen um den Kopf injiziert wird (PREEMPT-Schema).<sup>3</sup> Natürlich können bei fehlendem Ansprechen oder Unverträglichkeit auch die gängigen Migränetherapien, wie Antikonvulsiva, Antidepressiva, Betablocker oder Kalziumantagonisten, eingesetzt werden, wobei die Evidenz mässig ist. Neu gibt es die monoklonalen Antikörper gegen CGRP («calcitonin gene-related peptide») oder dessen Rezeptor, welche auch speziell für die chronische Migräne untersucht wurden und positive Wirkung bei guter Verträglichkeit zeigen.<sup>4</sup> Mehrere Studien der Phasen II und III belegen eine klinische Wirksamkeit mit signifikanter Reduktion der Kopfschmerztage pro Monat. Die Qualität der Studien ist durchwegs exzellent, sodass von einem hohen Evidenzgrad ausgegangen werden kann.</p> <p>Interessante Entwicklungen finden sich im Bereich der Neuromodulation, wie eine kürzlich erschienene Übersichtsarbeit5 zusammenfasst. Es wurden Geräte entwickelt, mit denen die Patienten den Vagusnerv selbst durch Elektrodenkontakt mit der Haut stimulieren können (nicht invasive, transkutane Vagusnervstimulation).<br />Bei der externen Trigeminusstimulation handelt es sich auch um ein nicht invasives Verfahren. Es erfolgt die bilaterale elektrische Stimulation des ersten Trigeminusastes über die Nn. supraorbitales et trochleares. Bei der episodischen Migräne konnte eine Reduktion der Attackenfrequenz durch tägliche präventive Anwendung gezeigt werden.<sup>6</sup> Eine neue Studie belegt zudem die Wirksamkeit als Akutbehandlung bei Migräne,<sup>7</sup> was die Methode – als nicht medikamentöse Option – auch für den Einsatz während der Kopfschmerzphase bei chronischer Migräne interessant macht.<br />Ein weiteres externes Neurostimulationsverfahren untersucht die Wirkung von Gleichstrom (tDCS, transkranielle Gleichstromstimulation). Hierbei soll mit einer geringen Stromstärke von 1–2 mA das Ruhemembranpotenzial der Neuronen modifiziert werden, um somit eine Modulation der kortikalen Erregbarkeit zu erreichen. Eine «Sham»-kontrollierte Studie mit 42 Patienten zeigte bei der episodischen Migräne, dass anodale Stimulation über dem linken Motorcortex im Vergleich zu Placebo zu einer signifikanten Reduktion der Attackenfrequenz und der Einnahme von Akutmedikation führte.<sup>8</sup></p> <p><strong>Chronischer Clusterkopfschmerz<br /></strong>Der chronische Clusterkopfschmerz ist eine der grössten therapeutischen Herausforderungen. In erster Linie können Verapamil oder Lithium eingesetzt werden, Steroidstösse oder eine Infiltration des N. occipitalis major (GONI) mit Lokalanästhetikum und Steroiden sind meist keine Dauerlösungen. Monoklonale Antikörper gegen CGRP werden auch zur Prophylaxe des Clusterkopfschmerzes untersucht, wobei die Studien beim chronischen Clusterkopfschmerz nach interimistisch analysiertem Fehlen einer Wirksamkeit gestoppt wurden. Beim episodischen Clusterkopfschmerz sind die bisherigen Resultate vielversprechender. Auch hier kommen Neuromodulationsverfahren zur Anwendung, sowohl perkutane (Vagusnervstimulation) als auch invasive (Stimulation des Ganglion sphenopalatinum [SPG], bilaterale okzipitale Neurostimulation [ONS] und auch Tiefenhirnstimulation [DBS]). Das Ganglion sphenopalatinum scheint als Teil des efferenten Schenkels des trigeminoautonomen Reflexes eine wesentliche Rolle in der Entstehung von Clusterkopfschmerzen zu spielen. Eine Beobachtungsstudie mit einer Laufzeit von zwei Jahren zeigte ein Ansprechen in der Behandlung von Attacken bei 45 % der Patienten, bei einem Drittel der Patienten kam es zudem zu einer Reduktion der Attackenfrequenz.<sup>9</sup></p> <p>Bei der bilateralen Occipitalis-Stimulation fand sich in einer offenen Studie eine bedeutsame Reduktion der Attacken, bei einigen Patienten über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Eine «Sham»-kontrollierte Studie zur Prophylaxe wird durchgeführt (ICON Study). In einem Konsensus- Papier der European Headache Federation (EHF) wird bei therapieresistenten, chronischen Clusterkopfschmerzen eine SPG- oder Occipitalis-Stimulation vor der Evaluation einer Tiefenhirnstimulation empfohlen, dies vor allem in Anbetracht der geringeren Operationsrisiken.<sup>10</sup></p> <p><strong>Hemicrania continua und SUNCT-Syndrom<br /></strong>Grundsätzlich sollte die Hemicrania continua definitionsgemäss durch therapeutische Dosen von Indomethacin vollständig regredient sein. Falls Indomethacin nicht vertragen wird, kann die ONS eine Therapiemöglichkeit darstellen, wobei diese Studie nicht («Sham»-)kontrolliert war.<sup>11</sup></p> <p>Das SUNCT-Syndrom ist so selten, dass randomisiert kontrollierte Studien fehlen. Pragmatischerweise können Lamotrigin, Gabapentin, Pregabalin oder lokale Nervenblocks (GONI) versucht werden. Eine weitere Option stellt, in Analogie zur Trigeminusneuralgie bei Gefäss-Nerven-Kontakt, die Dekompressions-Operation nach Janetta dar.</p> <p><strong>Multimodale Therapien<br /></strong>Neben den medikamentösen und neuromodulatorischen Therapien ist die multimodale Kopfschmerzrehabilitation12 nicht zu vergessen. Um den Umgang mit der Schmerzproblematik zu verbessern, ist ein multimodaler Therapieansatz anzustreben, welcher neben den Medikamenten auch aerobe Aktivität, aktive Entspannung, Akupunktur und aktive Copingstrategien beinhaltet, um das biopsychosoziale Problem ganzheitlich anzugehen.</p> <h2>Resümee und Ausblick</h2> <p>Chronische Kopfschmerzen bedeuten eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Insbesondere für die chronische Migräne, aber auch für die trigeminoautonomen Kopfschmerzen sind Erfolg versprechende Optionen in Entwicklung oder bereits verfügbar. Allen voran die neuen monoklonalen Antikörper gegen CGRP zur Migräneprophylaxe,<sup>4</sup> aber auch Substanzen zur Attackentherapie (Lasmiditan und eine Wiederbelebung der «Gepants») werden das therapeutische Repertoire der Neurologen und Kopfschmerzspezialisten erweitern. Nicht invasive und invasive Neurostimulationsverfahren sind zusätzliche Therapiemöglichkeiten. Insbesondere die Ersteren überzeugen auch mit einer guten Verträglichkeit. Eine individualisierte individualisierte, falls notwendig auch multimodale Therapie mit Berücksichtigung psychiatrischer Komorbiditäten wird weiterhin einer der wichtigsten Pfeiler in der Behandlung von Patienten mit chronischen (Kopf-)Schmerzen bleiben.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS): The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018; 38: 1-211 <strong>2</strong> Paemeleire K et al.: Medication-overuse headache in patients with cluster headache. Curr Pain Headache Rep 2008; 12: 122-7 <strong>3</strong> Diener HC et al.: OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: results from the double-blind, randomized, placebo-controlled phase of the PREEMPT 2 trial. Cephalalgia 2010; 30(7): 804-14 <strong>4</strong> Gantenbein AR et al.: Migräne und CGRP im Fokus – wo geht die Reise hin? Leading Opinions Neurologie & Psychiatrie 2018; 5: 6-7 <strong>5</strong> Riederer F: Neurostimulationsverfahren bei Kopfschmerz. Schweizer Zeitschrift für Psychiatrie und Neurologie 2018; 2: 13-8 <strong>6</strong> Schoenen J et al.: Migraine prevention with a supraorbital transcutaneous stimulator: a randomized controlled trial. Neurology 2013; 80: 697- 704 <strong>7</strong> Chou DE et al.: Acute migraine therapy with external trigeminal neurostimulation (ACME): a randomized controlled trial. Cephalalgia 2018 [Epub ahead of print] <strong>8</strong> Auvichayapat P et al.: Migraine prophylaxis by anodal transcranial direct current stimulation, a randomized, placebo- controlled trial. J Med Assoc Thai 2012; 95: 1003-12 <strong>9</strong> Jürgens TP et al.: Long-term effectiveness of sphenopalatine ganglion stimulation for cluster headache. Cephalalgia 2017; 37: 423-34 <strong>10</strong> Martelletti P et al.: Neuromodulation of chronic headaches: position statement from the European Headache Federation. J Headache Pain 2013; 14: 86 <strong>11</strong> Burns B et al.: Treatment of hemicrania continua by occipital nerve stimulation with a bion device: long-term follow-up of a crossover study. Lancet Neurol 2008; 7(11): 1001-12 <strong>12</strong> Gantenbein AR et al.: Rehabilitation bei chronischen Kopfschmerzen. Praxis (Bern 1994) 2018; 107(4): 203-7</p>
</div>
</p>