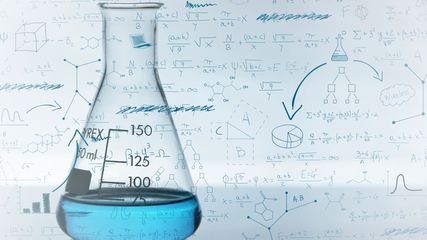©
Getty Images
Neue Entwicklungen in der Migräneprophylaxe und -therapie
Jatros
30
Min. Lesezeit
10.05.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">An einer Migräne zu leiden stellt für die Betroffenen eine große persönliche und soziale Belastung dar. Neue Hoffnung wecken die bisher vorliegenden Daten zur Migräneprophylaxe mit monoklonalen Antikörpern, die am „calcitonin gene-related peptide“ oder seinem Rezeptor angreifen. Daneben zeichnen sich auch in der Akuttherapie einige vielversprechende Optionen ab.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die gemeinsame Tagung der Deutschen Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft (DMKG), der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft (ÖKSG) und der Schweizerischen Kopfwehgesellschaft (SKG) blickt bereits auf eine mehrjährige Tradition zurück. Auf dem Programm standen in diesem Jahr unter anderem neue Entwicklungen in der Migräneprophylaxe und -therapie, mit einem Fokus auf dem Thema der Blockade des „calcitonin gene-related peptide“ (CGRP). Der Vorsitzende der entsprechenden Sitzung, Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Gregor Brössner, Medizinische Universität Innsbruck, erklärte dazu einleitend: „Auch wenn uns die CGRP-Blockade viele neue Möglichkeiten eröffnet, sollten wir andere Optionen darüber nicht vergessen.“</p> <h2>Spannende Neuentwicklungen</h2> <p>Mit diesen Optionen befasste sich denn auch der Vortrag von PD Dr. Tim Jürgens, Universitätsmedizin Rostock. Er sagte zu Beginn: „Bei der Migräne haben wir es mit einer hochkomplexen, multisystemischen Erkrankung zu tun, für die es bisher leider nicht das EINE pathophysiologische Modell gibt.“ Dies erschwere auch die Suche nach therapeutischen Ansätzen.</p> <p>Triptane, wie sie bisher in der Akuttherapie eingesetzt werden, wirken insbesondere am 5-HT-1B- und -1D-Rezeptor.<sup>1</sup> Da die Koronararterien aber ebenfalls 5-HT- 1B-Rezeptoren exprimieren, sind Triptane bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen kontraindiziert. Ein interessanter neuer Ansatzpunkt für eine Akuttherapie der Migräne stellen daher Ditane dar, da sie selektiv am 5-HT-1F-Rezeptor angreifen. Dieser ist unter anderem im Ganglion trigeminale und im Nucleus caudalis des Trigeminusnervs zu finden. Lasmiditan, ein vielversprechender Vertreter der Ditane, hat sich in ersten Phase-IIIStudien als wirksames Migränetherapeutikum erwiesen.<sup>2</sup> „82 % der eingeschlossenen Patienten wiesen kardiovaskuläre Risikofaktoren auf. Bei ihnen zeigte sich keine erhöhte Rate an kardiovaskulären oder zerebrovaskulären Nebenwirkungen“, betonte Dr. Jürgens. Weitere Phase- III-Studien laufen nun.</p> <p>Ein weiterer interessanter Ansatzpunkt stellt PACAP („pituitary adenylate cyclaseactivating polypeptide“) dar. „PACAP38, das 38-Aminosäuren-Peptid, weist im Nervensystem eine wichtige Rolle als Neurotransmitter und Neuropeptid auf. Es kommt in vielen Strukturen vor, die für die trigeminale Nozizeption von Bedeutung sind“, so der Redner. PACAP38 löst bei Migränepatienten ohne Aura eine Migräneattacke aus.<sup>3</sup> Aufgrund der selektiven Affinität von PACAP38 zum PAC<sub>1</sub>-Rezeptor wird dieser als potenzielles Ziel für eine Migränetherapie angesehen.<sup>4</sup> „Ein PAC<sub>1</sub>-Rezeptorantikörper wird aktuell in einer Phase-IIa-Studie untersucht“, erklärte der Redner abschließend.</p> <h2>CGRP: praktisch in jedem Organ vorhanden</h2> <p>Prof. Dr. Karl Messlinger, Universität Erlangen-Nürnberg, präsentierte anschließend einen spannenden Einblick in die Physiologie des CGRP und seines Rezeptors. Dazu erklärte er: „CGRP und CGRPRezeptoren gibt es praktisch in jedem Organ, auch auf allen Ebenen des trigeminovaskulären Systems. Wir wissen, dass CGRP eines der wichtigsten, wenn nicht das wichtigste vasodilatatorische Neuropeptid darstellt“, erklärte er. Prof. Messlinger wies an dieser Stelle darauf hin, dass mittlerweile davon ausgegangen wird, dass die Dilatation der intrakraniellen Gefäße nichts oder nur wenig zum Migräneschmerz beiträgt. Dies wurde auch durch entsprechende Untersuchungen belegt.<sup>5</sup> „Nicht geklärt ist allerdings, weshalb die Injektion von CGRP eine Migräneattacke auslösen kann“, betonte er.</p> <p>Da CGRP und sein Rezeptor fast überall im Körper vertreten sind, könnte eine therapeutische Hemmung des Systems möglicherweise zu verschiedenen unerwünschten Effekten führen. Wie Prof. Messlinger weiter ausführte, wurde im Tiermodell beispielsweise festgestellt, dass die Nasenschleimhaut durch CGRPhaltige Fasern innerviert ist. „CGRP scheint dabei die Riechtransduktion zu hemmen. Möglicherweise könnte also eine langfristige CGRP-Hemmung zu Riechveränderungen führen“, meinte er. Ähnliches ist auch für den Geschmackssinn entdeckt worden.<sup>6</sup> „Über die kardiovaskulären Nebenwirkungen einer Hemmung des CGRPSystems wurde viel diskutiert, denn tatsächlich ist das Herz voller CGRP freisetzender Fasern“, so Prof. Messlinger weiter. Bereits 2008 wurde jedoch am Mausmodell gezeigt, dass eine Blockade des CGRPRezeptors bei Tieren mit gesundem Herz keine negativen Folgen hatte.<sup>7</sup> „Bei Schweinen wurde nach einem experimentell ausgelösten Herzinfarkt die Produktion von CGRP in den Ganglienzellen, die das Herz versorgen, hochreguliert. Es scheint sich hier offensichtlich um einen Kompensationsmechanismus zu handeln. Damit könnten wir womöglich den Zustand nach einem Herzinfarkt verschlechtern, falls wir das CGRP-System über lange Zeit hemmen“, führte der Redner weiter aus. „Trotz dieser möglichen Nachteile bin ich nicht gegen den therapeutischen Einsatz von CGRP-Rezeptorblockern. Denn wir müssen uns bewusst sein, dass wir mit dem CGRP-System ein hochredundantes System hemmen. Es existieren in den verschiedenen Organen also sicherlich Rescue-Systeme, die gegebenenfalls aktiviert werden und die ausfallenden Mechanismen kompensieren können. Der Grund dafür, dass wir trotzdem eine Chance auf einen spezifischen Effekt bei Migräne haben, liegt vermutlich darin, dass das CGRP gerade im trigeminovaskulären System eine besonders wichtige Rolle spielt.“</p> <h2>CGRP-Rezeptor-Blockade in der Migräneprophylaxe</h2> <p>Prof. Gregor Brössner präsentierte schließlich einige Daten zu den monoklonalen Antikörpern in der Migräneprophylaxe. „Kein einziges der Medikamente, die wir schon seit vielen Jahren erfolgreich in der Migräneprophylaxe einsetzen, wurde spezifisch dazu entwickelt“, rief er den Zuhörenden einleitend in Erinnerung. „Für die wenigsten dieser Medikamente können wir erklären, an welcher Stelle in der Pathophysiologie der Migräne sie spezifisch ihre Wirkung entfalten, was uns gegenüber unseren Patienten oft in einen Erklärungsnotstand bringt.“<br /> Aktuell befinden sich vier monoklonale Antikörper in klinischen Tests. Während Erenumab den CGRP-Rezeptor blockiert, setzen Fremanezumab, Eptinezumab und Galcanezumab am CGRP selbst an. In einer Phase-III-Studie bei Patienten mit episodischer Migräne führte Erenumab (monatlich 70 od. 140mg subkutan) zu einer signifikanten Reduktion der Anzahl der monatlichen Migränetage gegenüber Placebo.<sup>8</sup> Die Rate an Nebenwirkungen war mit Placebo vergleichbar. Die Interimsanalyse einer laufenden offenen Studie zeigte, dass der Effekt von Erenumab unter kontinuierlicher Therapie mindestens über ein Jahr erhalten bleibt.<sup>9</sup> „Bisher kann noch niemand sagen, ob es nach Absetzen der Prophylaxe allenfalls zu einem Rebound kommt. Solche Daten liegen uns noch nicht vor“, machte Prof. Brössner deutlich. Bei 40 % der Patienten mit chronischer Migräne, die zu Studienbeginn rund 18 Migränetage pro Monat aufwiesen, führte die Behandlung mit Erenumab 70mg zu einer Halbierung der Anzahl an Migränetagen.<sup>10</sup> „Sieht man sich die bisher vorliegenden Daten aller vier Antikörper an, so liegt der Anteil an Patienten mit einer 50 % igen Reduktion der Anzahl monatlicher Migränetage bei etwa 40 bis 50 % “, so Prof. Brössner. Auf die Frage aus dem Publikum, ob denn jeder Migränepatient einen monoklonalen Antikörper bekommen wird, antwortete er: „Nein, das glaube ich nicht. Der Einsatz wird wohl auf selektierte Patienten begrenzt sein, die durch die Migräne stark beeinträchtigt sind und bei denen eine Wirkung der Prophylaxe zu erwarten ist.“</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Neuro_1802_Weblinks_jatros_neuro_1802_s14_bildistock.jpg" alt="" width="1454" height="1011" /></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 6. Dreiländertagung Kopfschmerzsymposium, 15. bis
17. März 2018, Bad Zurzach, Schweiz
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Rubio-Beltrán E et al.: Is selective 5-HT1F receptor agonism an entity apart from that of the triptans in antimigraine therapy? Pharmacol Ther 2018; [Epub ahead of print] <strong>2</strong> CoLucid Pharmaceuticals, Inc (2016). Verfügbar unter: https://globenewswire.com/news-release/2016/ 09/06/869611/0/en/CoLucid-Pharmaceuticals-Announces- Achievement-of-Both-Primary-and-Key-Secondary-Endpoints- in-the-SAMURAI-Phase-3-Pivotal-Trial-of-Lasmiditan- in-Migraine.html <strong>3</strong> Schytz HW et al.: PACAP38 induces migraine-like attacks in patients with migraine without aura. Brain 2009; 132: 16-25 <strong>4</strong> Vollesen ALH et al.: Targeted pituitary adenylate cyclase-activating peptide therapies for migraine. Neurotherapeutics 2018; [Epub ahead of print] <strong>5</strong> Schoonman GG et al.: Migraine headache is not associated with cerebral or meningeal vasodilatation-- a 3T magnetic resonance angiography study. Brain 2008; 131: 2192-200 <strong>6</strong> Huang AY, Wu SY: Calcitonin gene-related peptide reduces taste-evoked ATP secretion from mouse taste buds. J Neurosci 2015; 35: 12714-24 <strong>7</strong> Zeller J et al.: CGRP function-blocking antibodies inhibit neurogenic vasodilatation without affecting heart rate or arterial blood pressure in the rat. Br J Pharmacol 2008; 155: 1093-103 <strong>8</strong> Goadsby PJ et al.: A controlled trial of erenumab for episodic migraine. N Engl J Med 2017; 377: 2123-32 <strong>9</strong> Ashina M et al.: Erenumab (AMG 334) in episodic migraine: interim analysis of an ongoing open-label study. Neurology 2017; 89: 1237-43 <strong>10</strong> Tepper S et al.: Safety and efficacy of erenumab for preventive treatment of chronic migraine: a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 2 trial. Lancet Neurol 2017; 16: 425-34</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...