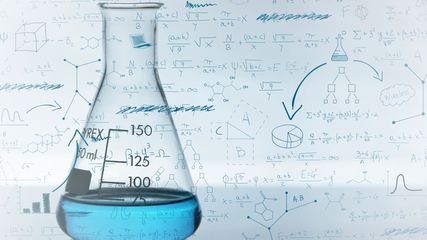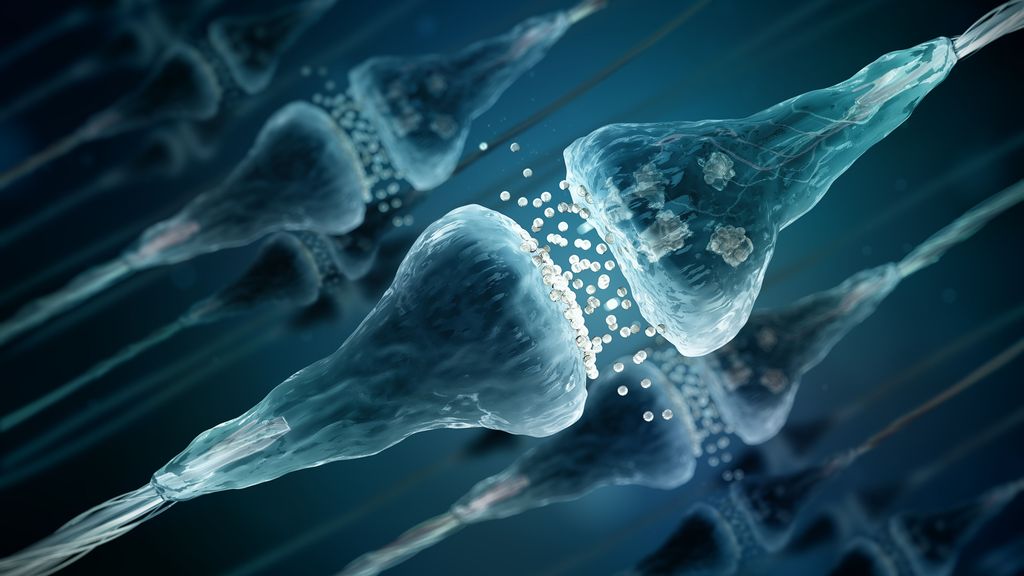
©
Getty Images/iStockphoto
Multimodale Schmerztherapie bei Kopfschmerzen
Jatros
Autor:
Prof. Dr. Dipl.-Psych. Matthias Keidel
Chefarzt<br> Klinik für Neurologie und Neurologische Intensivmedizin<br> Rhön-Klinikum, Campus Bad Neustadt<br> www.campus-nes.de<br> E-Mail: matthias.keidel@campus-nes.de
30
Min. Lesezeit
11.07.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die multimodale Schmerztherapie hat ihren Stellenwert bei ambulant therapierefraktären Kopfschmerzen, die einen chronischen Verlauf zeigen. Der folgende Übersichtsartikel fasst die wichtigsten Einsatzgebiete zusammen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Die Grundpfeiler der multimodalen Kopfschmerztherapie sind die stationäre und teilstationäre Therapie, ein teamorientiertes und interprofessionelles Vorgehen, die Kombination medikamentöser und nichtmedikamentöser Therapiemaßnahmen sowie die hohe Dichte der therapeutischen Leistungseinheiten.</li> <li>Die ärztliche Prävention der Kopfschmerzchronifizierung erübrigt in vielen Fällen eine multimodale Kopfschmerzkomplexbehandlung.</li> <li>Bei Migräne die Triptan-Einnahmefrequenz hinterfragen, Chronifizierungsfaktoren beachten, Komorbiditäten und Begleitkopfschmerzen vom Spannungstyp mitbehandeln, psychosoziale Belastungsfaktoren in die Therapie miteinbeziehen und eine Anleitung zum eigeninitiativen, selbstwirksamen Mitgestalten der allgemeinen Prophylaxemaßnahmen geben.</li> <li>Bei Spannungskopfschmerzen kommt dem „careful watching“ der Analgetika-Einnahme und der Intensivierung des eigenständigen Vorsorgeverhaltens besondere Bedeutung zu.</li> <li>Ärztliche Prävention protrahierter posttraumatischer Kopfschmerzremission</li> </ul> </div> <p>Das interdisziplinäre Behandlungskonzept wird in der Regel stationär oder teilstationär durchgeführt. Die multimodale Kopfschmerztherapie erfolgt durch ein interdisziplinäres Team mit enger interprofessioneller Kooperation. In das interdisziplinäre Team sind ein Facharzt mit spezieller schmerzmedizinischer Expertise, ein Psychiater/Psychosomatiker, psychologischer Psychotherapeut, Physiotherapeut, Ergotherapeut, physikalischer/sportmedizinischer Therapeut, spezialisierte Pflegekräfte und erforderlichenfalls Sozialarbeiter eingebunden. Durch die fachspezifische Integration im Team wird eine Optimierung des Behandlungseffektes erzielt. Aufgrund einer Kombination von medikamentösen und verhaltenstherapeutischen Maßnahmen kann bei chronischen Verläufen eine Kopfschmerzreduktion um mehr als 50 % erreicht werden.<br />Im Rahmen der medizinischen und psychologischen Kombinationsbehandlung im multimodalen Setting sind Einzelgespräche der Patienten mit psychologischen Schmerztherapeuten immer dann besonders angezeigt, wenn eine medikamentöse Kopfschmerzprophylaxe trotz Einsatz unterschiedlicher Pharmaka keinen Erfolg zeigt, wenn medikamentöse Behandlungsansätze mit einer Erprobung von Kombinationsbehandlungen oder mit Einsatz von Medikamenten der zweiten oder dritten Wahl versagen oder aufgrund heftiger Nebenwirkungen nicht möglich sind, wenn bei den Kopfschmerzpatienten ein Medikamentenübergebrauch oder eine Symptomverschiebung bzw. Symptomerweiterung vorliegt, wenn eine Tendenz zur Schmerzgeneralisierung gegeben ist oder wenn der Patient ein progredientes Schmerzvermeidungsverhalten aufweist. Die gesprächstherapeutische Einbeziehung der Angehörigen ermöglicht deren unterstützende Einflußnahme als Kotherapeuten im familiären Umfeld.<br />Die institutionell gebundene multimodale Kopfschmerztherapie wird in einem mehrwöchigen Block durchgeführt. Die Patienten werden täglich visitiert und die Schmerzstärke wird anhand einer numerischen Skala dokumentiert. In wöchentlichen interdisziplinären Teambesprechungen mit den Ärzten, Psychologen, Funktionstherapeuten und dem Pflegepersonal werden der Verlauf und die einzelnen funktionstherapeutischen Fortschritte besprochen und verlaufsabhängig erforderliche Diagnostik und Adaptierung des therapeutischen Procedere sowie die Möglichkeiten der poststationären Weiterbetreuung besprochen. Die Patienten erhalten schmerzpsychotherapeutische Einzelgespräche zur Schmerztherapie und -bewältigung unter Einbeziehung des biopsychosozialen Chronifizierungsmodells. Eine Teilnahme an einer Gruppenbehandlung ist möglich. Funktionstherapeutisch müssen mindestens drei aktive Therapieverfahren im Rahmen einer multimodalen Kopfschmerzbehandlung durchgeführt werden. Muskelzentrierte Entspannungsverfahren nach Jakobson werden erlernt und begleitend durchgeführt. Im Einzelfall wird eine sozialmedizinische Beratung mit der Erörterung der Möglichkeiten einer poststationären Anschlussheilbehandlung oder weiterer Maßnahmen der Rehabilitation und der beruflichen Wiedereingliederung angeboten.<br /> Die multimodale Kopfschmerztherapie ist indiziert bei chronischen Kopfschmerzen, die per definitionem länger als drei Monate mit mehr als 15 Kopfschmerztagen pro Monat anhalten. Sie ist nicht angezeigt bei perakuten sekundären Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen, die von einer multimodalen Kopfschmerzbehandlung profitieren, sind in Tabelle 1 zusammengefasst.<br /> Meist sind die chronischen Kopfschmerzverläufe kompliziert durch schmerzunterhaltende psychische Begleiterkrankungen oder durch gravierende somatische Komorbiditäten (Tab. 2). Im ambulanten Setting ist in der Regel eine unimodale Schmerztherapie ohne ausreichenden Behandlungserfolg geblieben. Gleiches gilt für den Versuch einer ambulanten Behandlung eines den Kopfschmerz chronifizierenden Medikamentenübergebrauchs. In der sozialmedizinischen Vorgeschichte finden sich aufgrund häufiger Fehlzeiten und längerer Arbeitsunfähigkeit Probleme am Arbeitsplatz oder es bestehen anhängige Rentenoder anderweitige Entschädigungsansprüche. Der chronische Kopfschmerz hat zu einer ausgeprägten Beeinträchtigung der Lebensqualität im Alltag geführt. Nicht selten bestehen familiäre Beziehungsprobleme oder anderweitige peristatische psychosoziale Belastungsfaktoren.</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Neuro_1903_Weblinks_jatros_neuro_1903_s10_tab1_keidel.jpg" alt="" width="1417" height="833" /></p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Neuro_1903_Weblinks_jatros_neuro_1903_s10_tab2_keidel.jpg" alt="" width="350" height="679" /></p> <p> </p> <h2>Chronischer Kopfschmerz vom Spannungstyp bei Analgetika-Übergebrauch</h2> <p>1 % bis 3 % der Bevölkerung nehmen täglich Analgetika ein, bis zu 7 % mindestens einmal pro Woche. Ein Übergebrauch der Einnahme besteht bei 5 % der Kopfschmerz-Betroffenen, die Triptane einnehmen. Ein Medikamentenübergebrauch ist nach der Klassifikation der International Headache Society (IHS) gegeben, wenn Schmerzmittel jeglicher Art über drei Monate an mehr als zehn Tagen pro Monat eingenommen werden. Dies gilt für Ergotamine, Triptane, Opioide und Kombinationsanalgetika. Wenn einfache Analgetika an 15 oder mehr als 15 Tagen pro Monat eingenommen werden, liegt für diese Substanzgruppen ein Übergebrauch vor.<br /> Eine multimodale Kopfschmerzbehandlung kann im stationären Rahmen bei anhaltendem Kopfschmerz aufgrund eines Medikamentenübergebrauchs erforderlich werden; darüber hinaus bei Übergebrauch von Opioiden, bei Einnahme psychotroper Substanzen (Schlafmittel, Tranquilizer, Anxiolytika), bei mehrfach erfolglos durchgeführten Selbstentzügen, bei Angst des Patienten vor einem ambulanten Entzug, bei ungünstigen, nicht supportiven familiären Begleitumständen, bei psychiatrischer Komorbidität (wie ausgeprägter Begleitdepression) oder auch bei einem hohen Leistungsanspruch des Patienten mit Bedenken, bei nicht erfolgreichen ambulanten Behandlungsversuchen über längere Zeit arbeitsunfähig zu sein.<br /> Im Rahmen der multimodalen Behandlung wird der Patient über die Chronifizierungsmechanismen des Kopfschmerzes bei Medikamentenübergebrauch aufgeklärt. Es erfolgen ein Absetzen sämtlicher eingenommener Schmerzmedikamente bei begleitender initialer intravenöser Steroid-Pulstherapie mit ausschleichender oraler Gabe unter gastroprotektiver Medikation und erforderlichenfalls eine begleitende medikamentöse Behandlung von Entzugssymptomen und eine Einleitung einer medikamentösen Prophylaxe des in der Regel unterliegenden initialen episodischen Kopfschmerzes vom Spannungstyp. Während der multimodalen Komplexbehandlung wird der Patient psychologisch, verhaltenstherapeutisch betreut und eine ambulante regelmäßige psychologische und neurologische Nachbetreuung in die Wege geleitet. Die psychologische Behandlung im Rahmen der multimodalen Kopfschmerzbehandlung impliziert die Edukation des Patienten zum Thema Medikamentenabusus und Dauerkopfschmerz, die Festlegung individueller Ziele bezüglich des Medikamenteneinnahme-Verhaltens, die Bewusstmachung äußerer Einflüsse für den Übergebrauch (z. B. Verfügbarkeit von Schmerzmitteln), die Bewusstmachung innerer Einflüsse für den Übergebrauch (z. B. gelernte Unbedenklichkeit der Schmerzmitteleinnahme), die Bewusstmachung iatrogener Risikofaktoren (z. B. Doktor-Shopping) sowie die Anleitung zur Medikamenteneinnahme- Selbstkontrolle und zur Nutzbarmachung sozialer Unterstützung (z. B. durch Partner/-in). Eine medikamentöse Prophylaxe des unterliegenden Spannungskopfschmerzes, die während des Medikamentenübergebrauchs nicht wirksam war, zeigt häufig nach dem Entzug eine erneute Effizienz.</p> <h2>Chronische Migräne</h2> <p>Gemäß den diagnostischen Kriterien der internationalen Klassifikation von Kopfschmerzerkrankungen (ICHD III, beta) liegt eine chronische Migräne vor, wenn über eine Mindestdauer von drei Monaten an mindestens 15 Tagen im Monat ein Kopfschmerz vorliegt, davon an mindestens 8 Tagen ein Migränekopfschmerz. Der Nicht-Migränekopfschmerz kann unterschiedlichen Typs sein. Eine Häufung der Migränetage aufgrund eines TriptanÜbergebrauchs und eine Häufung der Spannungskopfschmerztage aufgrund eines Analgetika-Übergebrauchs sind in der aktuellen Definition zugelassen. Jedes Jahr entwickelt sich bei ca. 2,5 % der Patienten mit episodischer Migräne eine chronische Migräne. Ein Risikofaktor für die Entwicklung einer chronischen Migräne ist neben einem Triptan-Übergebrauch das Vorliegen von Komorbiditäten. Hierzu gehören psychiatrische/psychosomatische Erkrankungen wie Depression, Angsterkrankung oder anhaltende Stresssituationen, zudem Übergewicht oder Schlafstörung mit Rhonchopathie. Weitere Risikofaktoren sind in Tabelle 2 aufgeführt.<br /> Neben balneo-physikalischen und vegetativ- roborierenden Maßnahmen und krankengymnastischen Therapieansätzen mit muskelzentrierter Entspannungstechnik werden im Rahmen der multimodalen Schmerzkomplexbehandlung in psychologischen Einzelsitzungen neben der Vermittlung der Migränemodelle (Diathese- Stress-Modell: dysfunktionale habituelle Stressverarbeitung; Modell der Reizverarbeitungsstörung: kortikale Hypersensitivität) Hilfestellungen zum Lifestyle (dynamische Adaptierung des Aktivitätsniveaus) sowie zum Trigger-Management und zum Attacken-Management (Entspannung, Imaginationsverfahren oder Aufmerksamkeitslenkung) gegeben.</p> <h2>Persistierender posttraumatischer Kopfschmerz</h2> <p>Eine Indikation zur multimodalen Erweiterung der Kopfschmerztherapie ist bei protrahierter Remission eines posttraumatischen Kopfschmerzes gegeben. Ein persistierender posttraumatischer Kopfschmerz nach Schädel-Hirn-Trauma oder nach einer HWS-Beschleunigungsverletzung kann sich aus einem akuten posttraumatischen Kopfschmerz entwickeln, der gemäß IHS-Klassifikation innerhalb von sieben Tagen nach dem Trauma auftritt und länger als drei Monate besteht. Zur Vermeidung eines multimodalen Behandlungserfordernisses eines persistierenden posttraumatischen Kopfschmerzes sollte in der posttraumatischen Frühphase auf eine enge Wiedervorstellung zur Vermeidung einer unkontrollierten Patientenführung geachtet werden. Ein zu später Beginn mit einer „Hands on“-Physiotherapie sowie mit vegetativ-roborierenden physikalischen Begleitmaßnahmen sollte vermieden werden. Eine möglichst frühzeitige Klärung psychosozialer Probleme und forensischer Fragestellungen sollte erfolgen. Von besonderer Bedeutung ist die frühe Patientenaktivierung zur eigeninitiativen Therapiemitgestaltung. Die Empfehlungen zur günstigen Beeinflussung des posttraumatischen Kopfschmerzverlaufs sollten schon in der Frühphase der Behandlung beachtet werden (Tab. 3).</p> <p> </p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Neuro_1903_Weblinks_jatros_neuro_1903_s11_tab3_keidel.jpg" alt="" width="350" height="917" /></p> <p> </p> <h2>Chronischer zervikogener Kopfschmerz</h2> <p>Der zervikogene Kopfschmerz ist in der Regel streng unilateral („side-locked“) und ist provozierbar durch eine Halsbewegung, eine längere unphysiologische Kopfhaltung sowie durch äußeren Druck auf die schmerzhafte Nacken- und Hinterkopfseite. Klinisch zeigt sich ein eingeschränkter Bewegungsumfang der Halswirbelsäule, meist mit begleitenden ipsilateralen Nacken-, Schulter- und Armschmerzen, die nicht radikulär bedingt sind. Entwickelt sich ein nahezu täglich auftretender zervikogener Kopfschmerz trotz leitliniengerechter Versorgung, stellt das multimodale Behandlungskonzept eine therapeutisch weiterführende Option dar.</p> <h2>Chronischer Clusterkopfschmerz</h2> <p>Zeigen sich Clusterkopfschmerzattacken länger als ein Jahr ohne attackenfreie Intervalle von mehr als vier Wochen, liegt gemäß der IHS-Klassifikation ein chronischer Clusterkopfschmerz vor. Der Clusterkopfschmerz ist durch sehr starke, einseitig orbital und periorbital lokalisierte Schmerzattacken charakterisiert, die unbehandelt 30 bis 180 Minuten anhalten können und in der Attackenfrequenz von 2 bis 8 Attacken pro 24 Stunden variieren können. Begleitende Charakteristika sind einzeln oder kombiniert: ipsilaterale konjunktivale Injektion, Lakrimation, ipsilaterale nasale Kongestion, Rhinorrhö, ipsilaterales Lidödem, ipsilaterale Miosis und/oder Ptosis (inkomplettes Horner-Syndrom), ipsilaterales Schwitzen und/oder Rötung im Bereich der Stirn oder des Gesichts sowie in der Regel eine körperliche Unruhe oder Agitiertheit, die sich mit körperlicher Aktivität („pacing and rocking around“) bessert.<br /> Im Rahmen der multimodalen Kopfschmerzkomplexbehandlung können Steroid- Infusionen als Pulstherapie zur Durchbrechung der Attackenfrequenz sowie die Einleitung einer medikamentösen Prophylaxe erfolgen, zudem u. a. neben muskelzentrierten Entspannungstechniken der Schulter-Nacken-Muskulatur unter krankengymnastischer Anleitung und neben vegetativ-roborierenden, balneo-physikalischen Maßnahmen supportive schmerzpsychologische Behandlungsansätze.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...