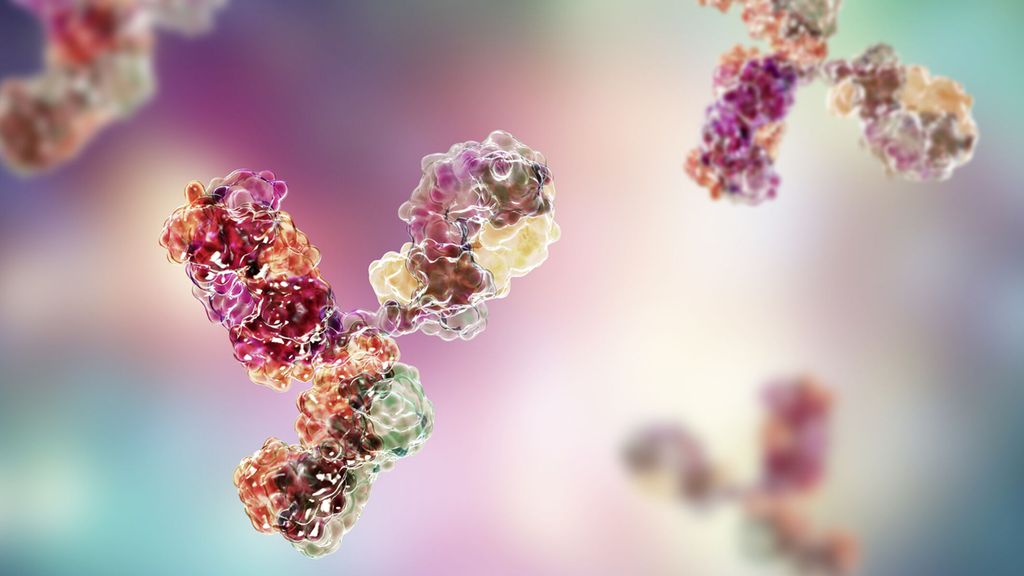Die Migräne erscheint aktuell omnipräsent. Diese Präsenz für die Krankheit, mit der ich mich seit meiner Studienzeit beschäftige, freut mich ganz persönlich. Über viele Jahrzehnte führte sie ein Schattendasein. Die Migräne lässt sich schwer fassen, nicht sicher objektivieren, die Pathophysiologie blieb und bleibt trotz aller Forschung nicht vollständig geklärt, viele therapeutische Ansätze wurden eher durch Zufall gefunden.
Mit der Entdeckung des CGRPs (Calcitonin-Gene-Related Peptide) als eines der Schlüsselelemente in der Schmerzentstehung der Migräne vor gut 30 Jahren öffnete sich jedoch ein Tor zur Entwicklung neuer Substanzen für die Akutbehandlung wie die prophylaktische Anwendung.1 Nach einem Rückschlag in den frühen 2000er-Jahren bei der Entwicklung der «small molecules» CGRP-Antagonisten (Gepants), beweisen nun die monoklonalen Antikörper, aber auch weitere «small molecules» nicht nur in den Studien, sondern auch in der «realen Welt» ihre Wirksamkeit und vor allem gute Verträglichkeit. Die etwas erfahreneren Kollegen durften schon eine erste Welle (dieser Begriff erscheint in Anbetracht der aktuellen Umstände eher negativ konnotiert) mit den Triptanen erleben, die als erste migränespezifischen Akutmittel die Therapiemöglichkeiten für die Patienten optimierten. Nun stehen wir inmitten einer zweiten Welle (auch hier im positiven Sinn) und dürfen äusserst dankbare Patienten erleben, wenn die Therapie greift. Die Zeit ist und bleibt spannend, weitere Mechanismen werden untersucht, andere therapeutische Ansätze geprüft.2 Aber auch in der neuen Ära wird die Therapie, insbesondere der hochfrequenten und chronischen Migräne, immer multimodal bleiben, sodass neben den akuten und prophylaktischen Medikamenten die nicht-medikamentösen Therapien nicht vergessen werden sollten.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Login
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Registrieren
Mit der Entdeckung des CGRPs (Calcitonin-Gene-Related Peptide) als eines der Schlüsselelemente in der Schmerzentstehung der Migräne vor gut 30 Jahren öffnete sich jedoch ein Tor zur Entwicklung neuer Substanzen für die Akutbehandlung wie die prophylaktische Anwendung.1 Nach einem Rückschlag in den frühen 2000er-Jahren bei der Entwicklung der «small molecules» CGRP-Antagonisten (Gepants), beweisen nun die monoklonalen Antikörper, aber auch weitere «small molecules» nicht nur in den Studien, sondern auch in der «realen Welt» ihre Wirksamkeit und vor allem gute Verträglichkeit. Die etwas erfahreneren Kollegen durften schon eine erste Welle (dieser Begriff erscheint in Anbetracht der aktuellen Umstände eher negativ konnotiert) mit den Triptanen erleben, die als erste migränespezifischen Akutmittel die Therapiemöglichkeiten für die Patienten optimierten. Nun stehen wir inmitten einer zweiten Welle (auch hier im positiven Sinn) und dürfen äusserst dankbare Patienten erleben, wenn die Therapie greift. Die Zeit ist und bleibt spannend, weitere Mechanismen werden untersucht, andere therapeutische Ansätze geprüft.2 Aber auch in der neuen Ära wird die Therapie, insbesondere der hochfrequenten und chronischen Migräne, immer multimodal bleiben, sodass neben den akuten und prophylaktischen Medikamenten die nicht-medikamentösen Therapien nicht vergessen werden sollten.