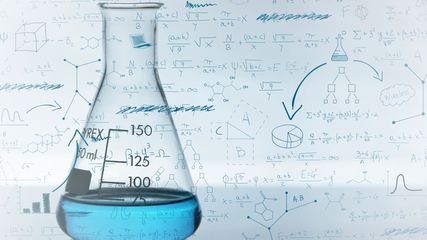©
Getty Images/iStockphoto
Innovationen und Perspektiven
Jatros
Autor:
Dr. Birgit Roser
30
Min. Lesezeit
07.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Seit 2007 findet alle zwei Jahre das London-Innsbruck Colloquium zu Forschung und Behandlung des Status epilepticus und akuter Krampfanfälle statt. Ein Fokus des diesjährigen Treffens lag auf neuen Therapien und Zukunftsperspektiven, die von hochkarätigen Experten aus Europa und den USA vorgestellt wurden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Gemäß den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) ist ein Status epilepticus «ein prolongierter epileptischer Anfall bzw. durch rezidivierende, d.h. mindestens 2 epileptische Anfälle ohne zwischenzeitliche Wiedererlangung des vorbestehenden neurologischen Befundes in einem umschriebenen Zeitraum, gekennzeichnet».<sup>1</sup> Der Status epilepticus stellt einen der häufigsten lebensbedrohlichen Notfälle in der Neurologie dar.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1704_Weblinks_s26.jpg" alt="" width="1450" height="970" /></p> <h2>Freie Radikale und mitochondriales Versagen</h2> <p>Während eines Status epilepticus kommt es zu neuronalen Schäden, die durch freie Radikale induziert werden können. Prof. Matthew Walker vom University College Hospital, London, präsentierte eine Zusammenfassung seiner bisherigen Untersuchungsergebnisse zu diesem Thema: Reaktive Sauerstoffspezies (ROS) entstehen während des Status epilepticus im Zytosol der Mitochondrien und können zu deren Versagen führen. Eine Reduktion der Bildung von ROS kann das Mitochondrienversagen verhindern. Geeignete antioxidative Strategien dafür sind noch in der Entwicklung.</p> <h2>Neue Wege der Administration</h2> <p>In der Initialphase eines Status epilepticus werden Benzodiazepine verabreicht. Bei Nichtansprechen stehen für die Sekundärtherapie Phenytoin, Valproat, Levetiracetam und Phenobarbital zur Verfügung. Entscheidend für einen erfolgreichen Ausgang der Behandlung ist der Zeitpunkt, zu dem die Initialtherapie begonnen werden kann. In der Notfallmedizin eingesetzte Medikamente sollen sich durch ein breites Wirkungsspektrum, schnellen Wirkungseintritt, schnelle Wiederherstellung der physiologischen Funktionen, eine gute Verträglichkeit und sichere Anwendung auszeichnen. <br />Prof. James Cloyd von der University of Minnesota gab eine Übersicht über neue Modelle zur Verabreichung von Wirkstoffen in der Behandlung des Status epilepticus unter dem Gesichtspunkt der Notfallmedizin. Für eine schnelle und sichere Anwendung der Medikamente werden einige Applikationssysteme entwickelt, auch im Hinblick auf die sogenannten „Personal monitoring“-Systeme. Diese sollen beginnende Krampfanfälle erkennen und verhindern und den Patienten bei der Selbstmedikation unterstützen.</p> <h2>Propofol und Ketamin</h2> <p>Auf der Suche nach neuen Therapieoptionen für den Status epilepticus werden auch neue Einsatzmöglichkeiten von bekannten Wirkstoffen untersucht. So berichtete Prof. Michael Rogawski, University of California, über seine Erfahrungen mit Propofol hemisuccinate (PHS), einer Vorstufe des Propofols, das mit dem GABA-A-Rezeptor interagiert. PHS wird im Körper zu Propofol konvertiert und zeigt oral gegeben einen schnellen antikonvulsiven Wirkungseintritt. Der Plasmalevel für den antikonvulsiven Effekt liegt bereits bei 0,7–0,9ng/ml, während der Plasmalevel für die anästhetische Wirkung von Propofol bei 2,3–3,5ng/ml liegt. PHS erhielt 2016 von der FDA den Orphan-Drug-Status. <br />Erfahrungen in der Behandlung des Status epilepticus mit Ketamin wurden von Dr. Julia Höfler, Universitätsklinikum Salzburg, anhand von Daten aus publizierten Studien vorgestellt. Ketamin ist ein Phencyclidinderivat, das als nicht kompetitiver Antagonist am NMDA-Rezeptor, einem Subtyp der Glutamat-Rezeptorgruppe, bindet. Die Ergebnisse zeigen, dass Ketamin in einer Medikamentenkombination (Diazepam, Valproat, Ketamin) effektiver ist als eine i.v. Ketamin-Monotherapie. In der Diskussion nach Höflers Referat wurde festgestellt, dass es keine Evidenz gibt, Ketamin früher als zurzeit üblich in der Behandlung des Status epilepticus einzusetzen.</p> <h2>Valnoctamid, SPD und Brivaracetam</h2> <p>Auch die Amide der Valproinsäure, Valnoctamid und SPD (sec-Butylpropylacetamid), ein Kohlenstoffhomolog von Valnoctamid, werden in der Therapie des Status epilepticus eingesetzt. Valnoctamid bindet wahrscheinlich an einer anderen Stelle am GABA-Rezeptor als Benzodiazepine und zeigt eine bessere Wirkung. Es scheint ein vielversprechendes, nicht teratogenes Nachfolgepräparat für Valproat werden zu können, wie Prof. Meir Bialer, Hebrew University of Jerusalem (Israel), berichtete.<br />Brivaracetam, seit 2016 für die Zusatzbehandlung fokaler Epilepsieanfälle in der EU und den USA zugelassen, ist ein Ligand am synaptischen Vesikelprotein 2A (SV2A) und inhibiert spannungsabhängige Natriumkanäle im Nervensystem. Strukturell leitet sich Brivaracetam von Levetiracetam ab, wobei es aufgrund seiner höheren Affinität zum SV2A-Rezeptor eine stärkere antikonvulsive Wirksamkeit in Tiermodellen aufweist. Außerdem hat es in Kombination mit Diazepam und Ketamin im Tiermodell eine höhere Wirksamkeit und eine geringere Toxizität gezeigt. Brivaracetam tritt schneller über die Blut-Hirn-Schranke als Levetiracetam und zeigt bisher ein gutes Sicherheitsprofil. Prof. Eugen Trinka vom Universitätsklinikum Salzburg berichtete von seinen Erfahrungen mit diesem Wirkstoff. Brivaracetam wurde erst nach mehreren anderen antikonvulsiv wirkenden Medikamenten gegeben. Als häufigste Nebenwirkungen traten Somnolenz, Kopfschmerzen und Schwindelgefühle auf. Laut Trinka sind noch weitere klinische Untersuchungen erforderlich, bevor eine Therapieempfehlung für Bri­varacetam ausgesprochen werden kann.</p> <h2>Perampanel und Neurosteroide</h2> <p>Perampanel ist ein selektiver und nicht kompetitiver Antagonist des ionotropen AMPA-Glutamat-Rezeptors an postsynaptischen Nervenzellen. Es wurde 2012 für die Zusatztherapie fokaler Anfälle mit oder ohne sekundäre Generalisierung bei Epilepsiepatienten ab zwölf Jahren zugelassen. In den präklinischen Untersuchungen zeigte sich: Je früher Perampanel nach dem Beginn eines Status epilepticus gegeben wird, desto besser ist seine Wirksamkeit. Am Universitätsklinikum Salzburg wurden bisher 22 Patienten mit Perampanel als Zusatztherapie behandelt. Hierzu berichtete Dr. med. Alexandra Rohracher, dass im Zusammenhang mit der Perampanel-Gabe keine kardiologischen oder respiratorischen Nebenwirkungen beobachtet wurden. In verschiedenen Laborparametern wurden Veränderungen gesehen, jedoch wurden alle Patienten im Therapieverlauf mit mehreren Medikamenten behandelt, sodass für diese Veränderungen mehrere Gründe infrage kommen können. Perampanel ist für eine Höchstdosis von 12mg zugelassen, in Zukunft sollten höhere Dosierungen von bis zu 37mg angestrebt und eine i.v. Formulierung entwickelt werden. <br />Allopregnanolon, ein endogenes Neurosteroid, ist ein positiver allosterischer Modulator des synaptischen und extrasynaptischen GABA-A-Rezeptors und wird während der Schwangerschaft gebildet. Dr. Andrea Rossetti vom Universitätsspital Lausanne fasste die Ergebnisse der klinischen Studiendaten aus der Literatur zusammen. Für Allopregnanolon gibt es bereits robuste präklinische Evidenz sowie erste klinische Daten. Allerdings ist eine erneute Beurteilung des Sicherheitsprofils notwendig und es gibt bisher noch keinen formellen Beweis der Wirksamkeit von Allopregnanolon in der Behandlung des Status epilepticus. Ganaxolon, ein synthetisches Analogon des endogenen Allopregnanolon mit sedierender, angstlösender und antikonvulsiver Wirkung, befindet sich noch in der Entwicklung. Die dem Vortrag folgende kontroverse Diskussion zeigte, dass viele Fragen im Zusammenhang mit dieser Behandlungsoption noch zu klären und klinische Studien mit größeren Patientenzahlen erforderlich sind, bevor ein endgültiger Therapieplan erstellt werden kann. <br />Im letzten Vortrag wurde über die Planung und den aktuellen Status des ESETT („established status epilepticus treatment trial“) berichtet. Diese Studie ist eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde vergleichende Wirksamkeitsstudie über Fosphenytoin, Levetiracetam und Valproinsäure bei Patienten mit Benzodiazepin-refraktärem Status epilepticus. Probanden werden über zwei nationale Netzwerke der Notfallforschung rekrutiert. Unter <a href="https://nett.umich.edu/">https://nett.umich.edu/</a> können alle Informationen zu dieser Phase-III-Studie abgerufen werden.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 6th London-Innsbruck Colloquium on status epilepticus and acute seizures, 6.–8. April 2017, Salzburg
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie: Status epilepticus im Erwachsenenalter. DGN 2012. <a href="http://www.dgn.org/leitlinien/2303-ll-2a-2012-status-epilepticus-im-erwachsenenalter">www.dgn.org/leitlinien/2303-ll-2a-2012-status-epilepticus-im-erwachsenenalter</a></p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...
Alzheimer: laufende klinische Studien, State of the Art der Biomarkerdiagnostik und gemischte Pathologien
Die Forschung an neuen Therapien für die Alzheimerkrankheit (AD) erfährt ein nie dagewesenes Momentum. Auf der internationalen Alzheimer- und Parkinsonkonferenz AD/PD in Wien gab es ...