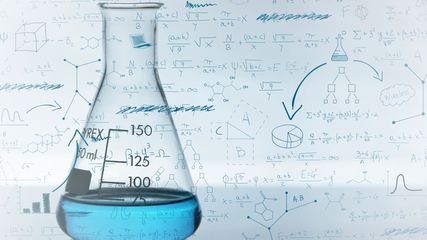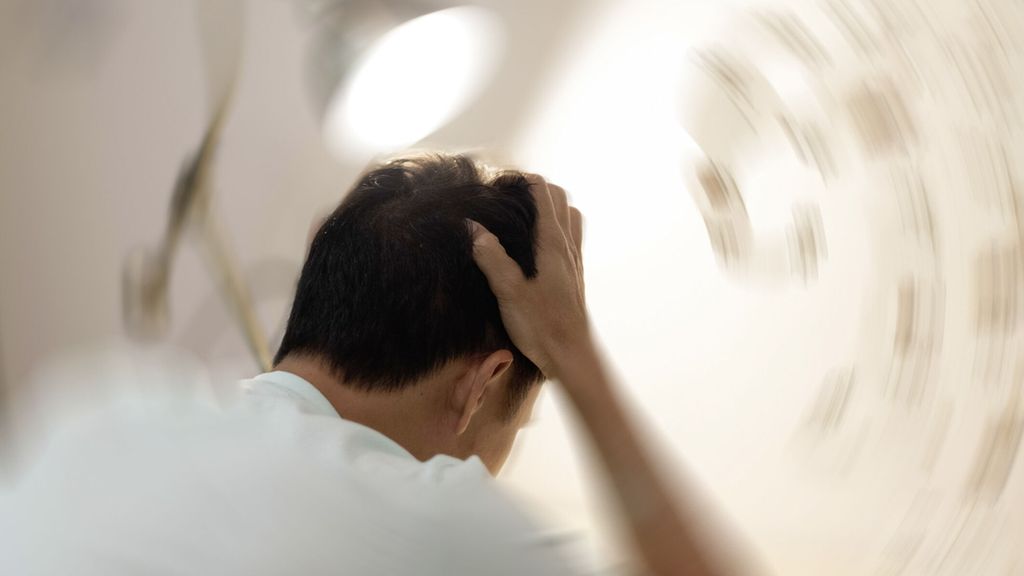
«Eine der schönsten Diagnosen für Neurologen»
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Schwindel ist eines der befriedigendsten Syndrome im klinischen Alltag: allein mit Anamnese und körperlicher Untersuchung zu diagnostizieren und praktisch das einzige Syndrom, das man «heilen» kann. Doch manchmal ist die Diagnose nicht einfach, gerade in der Abgrenzung zu gefährlichen Ursachen. Wir haben den Neurologen Andreas Gantenbein gefragt, was er von einem nationalen Schwindelzentrum halten würde, wo die Fallstricke bei der Diagnose sind und wann man als Niedergelassener den Patienten lieber in ein Schwindelzentrum überweisen sollte.
Eine kürzlich publizierte Studie aus Korea zeigt, dass Vitamin D plus Kalzium bei Schwindel-Patienten mit Vitamin D-Mangel die Rezidivrate senken können. Haben Sie die Ergebnisse der Studie überrascht?
A. Gantenbein: Mich hat schon erstaunt, dass Vitamin D in der Studie1 wirkte und Rezidive verhindern konnte. Zwar liegt ein Zusammenhang zwischen paroxysmalem Lagerungsschwindel und Vitamin-D-Stoffwechsel nicht ganz fern, weil es sich ja bei den Otokonien um kleine Kalksteinchen handelt. Das «Verrutschen» der Steinchen passiert in der Regel aber mechanisch, etwa durch ein (leichtes) Schädelhirntrauma. Vielleicht stimmt aber die Erklärung der Autoren, dass Vitamin D und Kalzium eine allfällige gestörte Zusammensetzung der Otokonien wiederherstellen.
Was sagen Sie als Experte dazu, dass Patienten mit Migräne in der Studie nicht von der Supplementierung mit Vitamin D und Kalzium profitierten?
A. Gantenbein: Es könnte daran liegen, dass der Schwindel dieser Patienten nicht durch «verrutschte» Otokonien verursacht wurde, sondern durch eine vestibuläre Migräne. Es ist nicht immer einfach, diese beiden episodischen Schwindelphänomene zu trennen.
Wie lässt es sich pathophysiologisch erklären, dass Vitamin D als Prophylaxe hilft? Liegt das nur am Vitamin D oder kommt es auf die Kombination mit Kalzium an?
A. Gantenbein: Die Autoren erklären dies damit, dass «gesündere» Otokonien bei Patienten ohne Vitamin-D-Mangel weniger schnell verrutschen würden. Den Unterschied, ob es am Vitamin D allein oder der Kombination liegt, konnten sie mit der Studie nicht klären, da sie nur die preiswertere Kombination verwendet haben. Für Menschen mit Vitamin-D-Mangel wäre eine Substitution am wichtigsten, denn in der Studie wirkte Vitamin D plus Kalzium bei Vitamin-D-Mangel etwas besser.
Meinen Sie, der paroxysmale Lagerungsschwindel entsteht durch einen Vitamin-D-Mangel?
A. Gantenbein: Daran glaube ich nicht. Der Schwindel entsteht mechanisch, nicht nur durch ein Trauma, sondern oft auch nach einer raschen Drehbewegung, zum Beispiel im Schlaf. Die Vitamin-D- und Kalzium-Substitution scheint aber eine Art Schutz zu sein, dass die Otokonien nicht nochmals verrutschen. Vielleicht kann man es sich so vorstellen, dass die Steinchen quasi von innen «stabilisiert» werden.
Würden Sie Patienten zu der Prophylaxe mit Vitamin D/Kalzium raten?
A. Gantenbein: Ich werde mir das überlegen und mich mit den Kollegen aus den Schwindelzentren absprechen. Andererseits wäre es gut, wenn die Ergebnisse in anderen prospektiven Studien bestätigt würden. Ich würde erst einmal 500–1000IE pro Tag verschreiben, aber grundsätzlich sollte die Einstellung individuell, nach Serum-Wert, erfolgen.
Gemäss einer Subgruppenanalyse zeigte die Prophylaxe bei Patienten unter 65 Jahren keinen signifikanten Effekt. Würden Sie Menschen unter 65 kein Vitamin D verschreiben?
A. Gantenbein: Subgruppenanalysen muss man immer kritisch betrachten. Aufgrund der geringen Fallzahlen kann es hier leicht zu einem Bias kommen. Wenn die Patienten einen Vitamin-D-Mangel haben, würde ich auch Jüngeren eine Substitution empfehlen.
Die Studie hat einige Limitierungen: Keine Placebogruppe, der Schwindel könnte falsch klassifiziert worden sein und es könnte sein, dass die Ergebnisse nur für die koreanische Bevölkerung zutreffen. Wie beurteilen Sie diese Limitierungen?
A. Gantenbein: Das kontrollierte Design mit den verblindeten Untersuchern gibt aber einiges her. Eine diagnostische Unschärfe ist natürlich unglücklich, bei der grossen Zahl jedoch weniger ein Problem. Eine placebokontrollierte Folgestudie wäre sicherlich wünschenswert.
Woher wissen wir, dass Vitamin D plus Kalzium besser ist als regelmässige Lagerungsmanöver zur Prophylaxe?
A. Gantenbein: Regelmässige Lagerungsmanöver erscheinen keinesfalls sinnvoll in der Prophylaxe, sondern nur in der Therapie. Denn durch die wiederholten Lagerungsmanöver können die «nicht ganz festsitzenden» Otokonien wieder wegrutschen. Eine medikamentöse Prophylaxe mit Vitamin D könnte sich somit durchaus etablieren.
Deutschland hat ein nationales Schwindelzentrum. Warum die Schweiz nicht?
A. Gantenbein: Ich finde es besser, mehrere Schwindelambulanzen oder -zentren in einem Land zu haben. Schwindel ist ein enorm häufiges Problem und viele Patienten müssten dann lange Wege zurücklegen, um ihr Problem abklären zu lassen.
Achten Kollegen genügend auf das Symptom Schwindel?
A. Gantenbein: Meiner Erfahrung nach kennen sich Neurologen damit gut aus. Mich erstaunt manchmal, dass andere Kollegen – Grundversorger und Spezialisten – die einfachen Tests, wie das Dix-Hallpike-Manöver oder den Kopfimpulstest, nicht häufiger nutzen, um rasch zu der richtigen Diagnose zu kommen. Schwindel lässt sich anhand der genauen Anamnese und einer Aufteilung in unterschiedliche Muster, je nach Auftreten, Art und Auslöser, sowie mit gezielten Tests in der Regel sehr gut und einfach klassifizieren.
Was sind die am häufigsten verkannten neurologischen Ursachen für Schwindel?
A. Gantenbein: Es kann eine Herausforderung sein, einen zentralen, «gefährlichen» Schwindel im Rahmen eines Hirninfarkts zu erkennen. Ein Schlaganfall ist lebensbedrohlich, eine Neuritis vestibularis aber nicht. Ist man sich unsicher, ob Schwindel durch einen Schlaganfall verursacht wird, kann einem die «HINTS»-Strategie helfen. Auf einen Schlaganfall weisen folgende klinische Zeichen: Der Kopfimpulstest ist normal, es ist ein seitenwechselnder Nystagmus zu sehen oder eine Abweichung bei den horizontalen Augenbewegungen. An die vestibuläre Migräne denken manche Kollegen leider auch zu selten.
Wie äussert sich die vestibuläre Migräne und wie unterscheidet man sie vom benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel?
A. Gantenbein: Wenn sich keine andere oder bessere Ursache findet, ist die vestibuläre Migräne eine episodische Störung mit einer Kombination aus Schwindel- und Migränesymptomen. Findet man typische Befunde in der Lagerungsprobe und kann man die Patienten mit dem Befreiungsmanöver nach Epley vom Schwindel erlösen, spricht dies für einen benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel.
Wann sollte man als Niedergelassener Patienten mit Schwindel an eine Schwindelambulanz verweisen?
A. Gantenbein: Immer dann, wenn die eigene Praxis nicht genügend ausgestattet ist. Zum Beispiel wenn eine apparative Diagnostik erforderlich ist oder eine spezielle Behandlung, etwa mit einem Drehstuhl für den komplexeren Lagerungsschwindel. Einen benignen paroxysmalen Lagerungsschwindel kann aber jeder Kollege in der Praxis diagnostizieren und behandeln. Er ist eine der schönsten Diagnosen für uns Neurologen: Nur allein mit Anamnese und körperlicher Untersuchung zu stellen und praktisch die einzige, die wir «heilen» können.
Vielen Dank für das Gespräch!
Unser Gesprächspartner:
PD Dr. med. Andreas Gantenbein
RehaClinic Bad Zurzach
E-Mail:
a.gantenbein@rehaclinic.ch
Das Interview führte
Dr. med. Felicitas Witte
Literatur:
1 Jeong S-H et al.: Neurology 2020; 95: e1117-e1125
Das könnte Sie auch interessieren:
Welchen Beitrag kann therapeutisches Drug-Monitoring leisten?
Bariatrische Operationen sind eine wirksame Strategie zur Gewichts-reduktion bei Adipositas. Die damit veränderte Anatomie kann die Bioverfügbarkeit von Arzneimitteln massgeblich ...
Leichte kognitive Beeinträchtigungin der neurologischen Praxis
Die Diagnostik der leichten kognitiven Beeinträchtigung (MCI) stellt eine Herausforderung in der Praxis dar. Eine korrekte Diagnose bietet aber die Chance, den Krankheitsverlauf durch ...
Wichtige Laborparameter bei Epilepsie: ein aktueller Überblick
Laborkontrollen sind bei Epilepsien aus verschiedensten Gründen erforderlich. Anfallssupprimierende Medikamente können Störwirkungen auf unterschiedliche Organsysteme haben, die unter ...