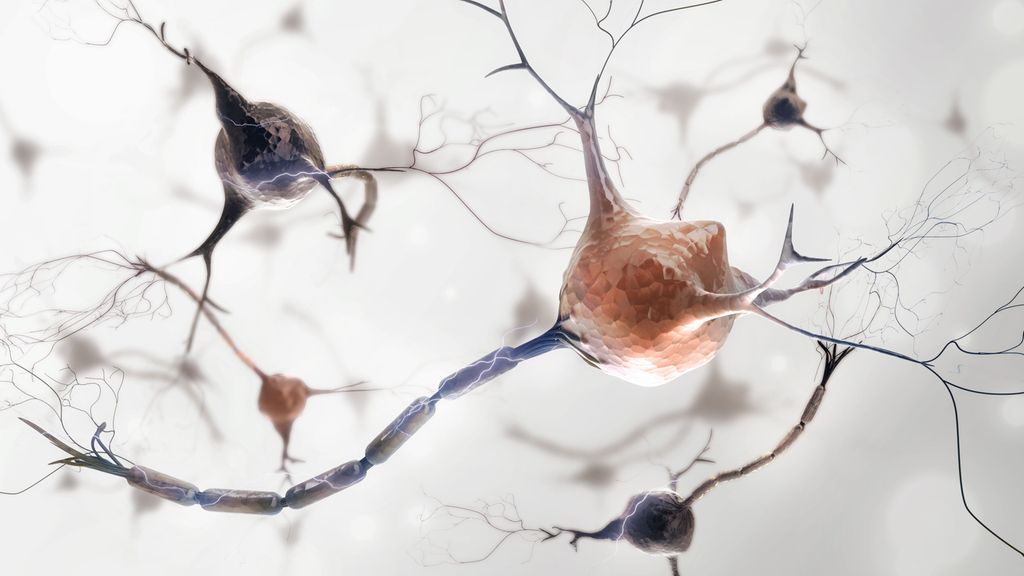
©
Getty Images/iStockphoto
Die therapeutischen Lücken werden kleiner
Leading Opinions
Autor:
Dr. Alexander Kretzschmar
30
Min. Lesezeit
31.08.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN) in Boston war 2017 wieder ein gut besuchter Fortbildungskongress. Neben einigen wissenschaftlichen Highlights wurde deutlich, dass die Forschungspipeline in vielen grossen Indikationen gut gefüllt ist, sich aber der Fortschritt in eher kleinen Schritten vollzieht. Eine Ausnahme ist hier (wieder) die Multiple Sklerose, bei der die therapeutischen Lücken immer kleiner werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Epidemiologische Studien zeigen zwar eine deutliche Assoziation zwischen erniedrigten Blutspiegeln von Vitamin D und dem Risiko der Entwicklung einer MS sowie ihrem klinischen Verlauf. Allerdings gibt es bislang noch keine belastbaren Studiendaten, dass durch eine Vitamin-D-Supplementierung der Verlauf der MS geändert werden kann.</p> <h2>Vitamin D – eine unendliche Geschichte</h2> <p>In der CHOLINE-Studie erhielten die Teilnehmer alle zwei Wochen 100 000IU Vitamin D3 oder Placebo über 96 Wochen. Die ITT-Analyse zeigte jedoch nur einen nicht signifikanten Trend für die Supplementierung zugunsten einer niedrigen jährlichen Schubrate. Hoffnung schöpfen die Autoren aus der Tatsache, dass die Completer-Analyse einen signifikanten Vorteil bei der Schubrate und der Reduktion der MRT-Läsionen zugunsten von Vitamin D3 ergab.<sup>1</sup> Auch in der SOLAR-Studie zeigte sich kein Vorteil der hochdosierten Gabe von Vigantolöl (14 000 IE/d) bei der Schubrate oder dem Erreichen der NEDA-Kriterien, sondern nur bei der Reduktion der kumulativen Läsionslast im MRT um 32 % (p=0,0045).<sup>2</sup><br /> Eindeutige Ergebnisse erhofft man sich laut Prof. Kassandra Munger, Boston, von den fünf weiteren klinischen Studien, in denen zurzeit der Nutzen einer Vitamin-D-Supplementierung untersucht wird. Pessimisten gehen allerdings davon aus, dass sich der Nutzen von Vitamin D allenfalls über sehr lange Zeiträume von fünf bis zehn Jahren nachweisen lässt. Und dann dürften wahrscheinlich auch kleine Dosierungen wie 500–1000IU/d bereits wirksam sein.</p> <h2>Fortschritte bei der SPMS</h2> <p>Bei der PPMS wird nach der FDA-Zulassung von Ocrelizumab kurz vor Beginn des AAN auch die EU-Zulassung in den kommenden Monaten erwartet. Zur Therapie der sekundär progressiven MS (SPMS) wurden in Vancouver jetzt auch positive Daten für Siponimod vorgestellt. Der S1P-Modulator erreichte in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt, das Risiko des Fortschreitens der Behinderungsprogression, bestätigt nach 3 Monaten. Hier verringerte Siponimod gegenüber Placebo das Risiko einer Behinderungsprogression um 21 % (Hazard Ratio [HR]: 0,79; 95 % CI: 0,65–0,95; p=0,013). Das Ergebnis bei dem noch anspruchsvolleren sekundären Endpunkt der Risikoreduktion des Fortschreitens der Behinderungsprogression, bestätigt nach 6 Monaten, fiel mit einer HR von 0,74 (95 % CI: 0,60–0,92; p=0,006; Risikoreduktion: 26 % ) vergleichbar hoch aus. <br /> Das Sicherheitsprofil von Siponimod ähnelte demjenigen von anderen S1P-Modulatoren wie Fingolimod. Dies betraf auch das Auftreten von Bradykardien in den ersten 6 Stunden nach erstmaliger Einnahme mit einem Rückgang der mittleren Herzfrequenz um maximal ca. 5 Schläge (Siponimod: 4,4 % ; Placebo: 2,6 % ) sowie Überleitungsstörungen (Siponimod: 3,0 % ; Placebo: 0,4 % ). Therapiebedürftige Überleitungsstörungen wie ein AV-Block 2. Grades Typ Mobitz II traten nicht auf. Mit einer Dosistitration in den ersten sechs Tagen sollen Inzidenz und Ausmass kardialer Effekte unter Siponimod gesenkt werden. Die Inzidenz von Infektionen mit Ausnahme eines Herpes zoster (Siponimod: 2,3 % ; Placebo: 0,7 % ) sowie das Auftreten von Malignomen (Siponimod: 1,8 % ; Placebo: 2,6 % ) war nicht erhöht. Fälle von opportunistischen Infektionen einschliesslich PML traten nicht auf.<sup>3</sup><br /> Am AAN 2016 wurden für Natalizumab 300mg die Ergebnisse der ASCEND-Studie zur SPMS gezeigt. Darin verfehlte Natalizumab den primären Endpunkt einer signifikanten EDSS-Verbesserung nach zwei Jahren. In diesem Jahr wurde eine Post-hoc-Analyse vorgestellt, in der Natalizumab gegenüber Placebo signifikant besser bei einem Multikomponenten-Endpunkt (Verbesserung im EDSS, P-Hole-Peg Test [9HPT] und im 25-Foot-Walk [T25FW]) abschnitt (adjustierte Odds Ratio [OR]: 1,67; p=0,001). Dieses Ergebnis dürfte vor allem durch die signifikante Verbesserung im T25FW (p=0,018) getrieben worden sein, denn im 9HPT (p=0,089) und im EDSS (p=0,498) erreichte Natalizumab keine statistisch signifikante Überlegenheit.<sup>4</sup></p> <h2>Alzheimer – raus aus der Frustration</h2> <p>Seit 2003, der Zulassung von Memantin, sind mehr als 99 % der klinischen Studien zur Therapie der Alzheimerdemenz fehlgeschlagen.<sup>5</sup> Trotzdem gibt es in dieser Indikation weiterhin spannende Therapieansätze. Der humanisierte Anti-Tau-Antikörper ABBV-8E12 wird derzeit in mehreren Phase-II-Studien, darunter einer Dosisfindungsstudie (NCT02880956) bei Patienten mit progressiver supranukleärer Blickparese (PSP) und früher Alzheimerdemenz (geplant: n=400), untersucht. <br /> Am AAN wurden zu dem Antikörper die Daten einer doppelblinden, placebokontrollierten Phase-I-Studie mit 30 PSP-Patienten (50–80 Jahre, PSPRS-Score 20–50) vorgestellt. Dort erwies sich die einmalige intravenöse Gabe unterschiedlicher Dosierungen (2,5, 7,5, 15, 25 oder 50mg/kg) insgesamt als sicher. Drei Patienten (15, 25 und 50mg) erlitten schwere unerwünschte Nebenwirkungen (subdurales Hämatom, starke Angst-/Depressionssymptome, Hypertonus), die in einem Fall zu einem Studienabbruch führten (25mg). Die Pharmakokinetik war dosisabhängig, die Bildung von Antikörpern wurde nicht beobachtet.<sup>6</sup></p> <h2>Neue Ansätze in der Parkinsontherapie</h2> <p>Nicht nur der Kontakt mit Schwermetallen, sondern auch der mit Pestiziden begünstigt die Entwicklung eines M. Parkinson. In der Studie einer kanadischen Arbeitsgruppe zeigten Bauern bzw. andere Personen mit einem häufigen direkten Kontakt mit Pestiziden eine frühere Parkinsonmanifestation als eine Vergleichsgruppe (ø 50,63 vs. 59,16 Jahre).<sup>7</sup> Auch in Europa arbeiten verschiedene Arbeitsgruppen an dieser Frage unter dem Blickwinkel, dadurch neue Erkenntnisse zur Pathogenese des M. Parkinson zu erhalten.<br /> In der Arzneimittelentwicklung beschäftigt man sich zunehmend mit der Frage, wie man durch geeignete Applikationsformen die Pharmakokinetik von Levodopa unter Umgehung der gestörten enteralen Bioverfügbarkeit glätten und damit motorische Symptome reduzieren kann. Apomorphin ist der erste und stärkste Dopaminagonist und gehört zu den etablierten Parkinsontherapeutika. In der randomisierten, doppelblinden TOLEDO-Studie wurde die subkutane Apomorphin-Pumpentherapie vs. Placeboinfusion bei 53 Patienten (ø 63 Jahre, Erkrankungsbeginn ≥3 Jahre) verglichen. Nach 12-wöchiger Therapie ging die Off-Zeit signifikant um rund zwei Stunden pro Tag zurück (p=0,0025), die On-Zeit ohne beeinträchtigende Dyskinesien stieg ebenfalls signifikant (p<0,05). Das Sicherheitsprofil zeigte keine neuen Signale.<sup>8</sup><br /> Eine weitere Option könnte die kontinuierliche subkutane Applikation von Levodopa/Carbidopa (ND0612) mittels eines Pumpsystems zur Optimierung der Pharmakokinetik von oralem Levodopa/Carbidopa sein.<sup>9</sup> In der Studie ND0612L-003 wurden 0,24ml am Tag bzw. 0,08ml in der Nacht verabreicht. Dies entsprach einer geringen Substanzbelastung von insgesamt nur 4,5ml pro Tag, entsprechend 270mg Levodopa/53mg Carbidopa. Im Ergebnis wurden motorische Komplikationen wie die Off-Zeit signifikant verringert und die Schlafqualität verbessert. Damit einher ging eine Verbesserung der Lebensqualität und des globalen Eindruckes im Arzturteil. Auftretende Hautknötchen waren reversibel und entzündeten sich nicht, so die Autoren. Angesichts der Studiendauer von 21 Tagen sind Langzeitstudien erforderlich.<br /> Auch mithilfe von IPX 203, einer neuen, lang wirksamen Version von Levodopa/Carbidopa (in den USA als Rytary® zugelassen), sollen schwankende Dopaminspiegel geglättet werden. Mehrere Poster zeigen, dass damit gegenüber kurz wirksamem Levodopa/Carbidopa signifikante Verbesserungen auf der UPDRS-III-Skala sowie Verbesserungen der Alltagskompetenz und der Lebensqualität erzielt werden.<sup>10, 11</sup> Das könnte idealerweise bedeuten, dass der Patient pro Tag nur noch 1–2 Levodopa/Carbidopa-Tabletten einnehmen muss.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 69. Jahrestagung der American Academy of Neurology (AAN), 22.–28. April 2017, Boston
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Camu CP et al.: ANN 2017; Abstract S44.004 <strong>2</strong> Hupperts R et al.: ANN 2017; Abstract S44.005 <strong>3</strong> Fox R et al.: ANN 2017; Abstract S33.007 <strong>4</strong> Giovannoni G et al.: ANN 2017; Abstract P5.339 <strong>5</strong> Cummings J et al.: Alzheimer’s Research & Therapy 2014; 6(4): 37-44 <strong>6</strong> Florian H et al.: AAN 2017; Emerging Science Session 006 <strong>7</strong> Gamache PL et al.: AAN 2017; Abstract P6.008 <strong>8</strong> Katzenschlager R et al.: AAN 2017; Emerging Science Session 003 <strong>9</strong> Adar L et al.: AAN 2017; Abstract P1.019 <strong>10</strong> Daneault JF et al.: AAN 2017; Abstract P4.002 <strong>11</strong> Ondo W et al.: AAN 2017; Abstract P1.020</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Menschen mit Demenz: Was beeinflusst deren Überleben nach Diagnosestellung?
Verschiedenste Faktoren beeinflussen die Überlebenszeit nach einer Demenzdiagnose. Das Wissen um Risikofaktoren zum Zeitpunkt der Diagnose einer Demenzerkrankung oder in deren Verlauf ...
Alzheimer: Was gibt es Neues in der Biomarker-Entwicklung?
Schätzungen zufolge leben in Österreich 115000 bis 130000 Menschen mit einer Form der Demenz. Eine Zahl, die sich bis zum Jahr 2050 verdoppeln wird.1 Antikörper-Wirkstoffe könnten in der ...
Kappa-FLC zur Prognoseabschätzung
Der Kappa-freie-Leichtketten-Index korreliert nicht nur mit der kurzfristigen Krankheitsaktivität bei Multipler Sklerose, sodass er auch als Marker zur Langzeitprognose der ...


