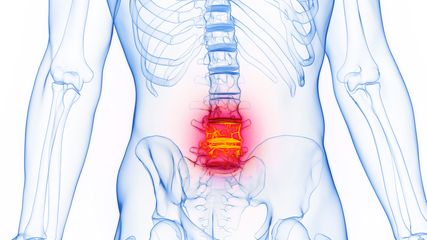Genetische Marker bei Riesenzellarteriitis
Unsere Gesprächspartner:
Prof. Dr. Eicke Latz, Wissenschaftlicher Direktor im Deutschen Rheuma-Forschungszentrum Berlin mit W3-Professur für Experimentelle Rheumatologie in der Charité Universitätsmedizin Berlin
Prof. Dr. Gerhard Krönke, Direktor der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische Immunologie in der Charité Universitätsmedizin Berlin
Das Interview führte Dr. Felicitas Witte
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Forscher aus Granada haben drei neue Genloci gefunden, die mit einer Riesenzellarteriitis assoziiert sind.1 Warum der Ansatz vielversprechend ist, aber eine genetische Testung zurzeit noch nicht sinnvoll ist, erklären Prof. Eicke Latz und Prof. Gerhard Krönke aus Berlin.
Herr Professor Latz, Herr Professor Krönke, haben die Ergebnisse Sie überrascht?
E. Latz: Die Bestätigung bereits bekannter Assoziationen wie der Beteiligung der Angiogenese und der Rolle der HLA-Region war zu erwarten und untermauert frühere Forschungsergebnisse. Die Studie hat allerdings drei neue Genloci identifiziert, die mit Riesenzellarteriitis in Verbindung stehen. Diese neuen Assoziationen, insbesondere in Genen, die mit Angiogenese und neutrophilen extrazellulären Fallen (NETs) verbunden sind, sind überraschend und eventuell richtungsweisend, da sie neue potenzielle Wege für die Behandlung aufzeigen. Die Studie deutet darauf hin, dass einige der identifizierten Gene und ihre Proteine mögliche Ziele für bestehende Medikamente sein könnten, die neu positioniert werden, um eine Riesenzellarteriitis zu behandeln.
Welche Konsequenzen ergeben sich hieraus für den Praxisalltag?
G. Krönke: Die Ergebnisse der Studie könnten langfristig Auswirkungen auf die klinische Praxis haben. Einerseits könnten sie zur Entwicklung eines polygenetischen Risikoscores beitragen, der die Vorhersage verbessern würde, ob ein Mensch eine Riesenzellarteriitis bekommt. Andererseits könnten auf genetischen Tests basierende Diagnostika in Zukunft eine personalisiertere Überwachung und präventive Behandlungen von Hochrisikopatienten ermöglichen. Die Möglichkeit, genetische Prädispositionen frühzeitig zu erkennen, könnte dazu beitragen, präventive Maßnahmen zu entwickeln. Zum Beispiel könnte bei Personen mit einem hohen genetischen Risiko eine engmaschigere Überwachung der Symptome oder eine frühere Intervention mit entzündungshemmenden Medikamenten in Betracht gezogen werden, um die Entwicklung oder Progression der Krankheit zu verhindern oder zu verlangsamen. Die Identifizierung von Genen, die mit Pathomechanismen der Riesenzellarteriitis verbunden sind, könnte zur Entwicklung neuer, zielgerichteter Therapien führen. Zum Beispiel könnten Medikamente, die auf spezifische angiogenetische Pfade oder die Funktion von NETs abzielen, eine Behandlungsoption für die Patienten werden, insbesondere wenn herkömmliche Therapien wie Kortikosteroide nicht wirken oder schwere Nebenwirkungen verursachen.
Was halten Sie vom Studienaufbau?
E. Latz: Es ist die größte bisher durchgeführte genomweite Assoziationsstudie (GWAS) für Riesenzellarteriitis – allein das finde ich beeindruckend. Das Studiendesign ist robust und umfasst eine umfangreiche Kohorte mit Tausenden von Patienten und Kontrollpersonen aus verschiedenen Regionen, was die Validität der Ergebnisse stärkt. Ein wichtiger Aspekt der Studie ist, dass die Erkrankung durch Temporalarterienbiopsie oder Bildgebungstechniken validiert wurde. Diese Bestätigung der Diagnose stellt sicher, dass die in die Studie eingeschlossenen Patienten tatsächlich an Riesenzellarteriitis leiden, was die Zuverlässigkeit der genetischen Assoziationen erhöht.
G. Krönke: Obwohl die Studie bereits eine breite geografische und ethnische Vielfalt aufweist, könnten zukünftige Studien noch stärker darauf abzielen, unterrepräsentierte Populationen einzubeziehen, um die genetische Diversität weiter zu erhöhen. Weiterhin wäre es wünschenswert, wenn die Betroffenen longitudinal über einen längeren Zeitraum beobachtet werden würden. Das böte zusätzliche Einblicke in die Progression der Riesenzellarteriitis und wie sich die genetischen Varianten langfristig auswirken.
Wie interpretieren Sie die gefundenen Genloci?
E. Latz: Wir haben neue Einblicke in mögliche pathophysiologische Mechanismen der Krankheit. Die identifizierten Genloci, die mit Angiogenese und NETs verbunden sind, weisen darauf hin, dass diese biologischen Prozesse offenbar eine wichtige Rolle in der Pathogenese spielen. Zwei der neu identifizierten Genloci, MFGE8 und VTN, sind an Prozessen der Angiogenese beteiligt. MFGE8 spielt eine Rolle bei der Förderung der Phagozytose apoptotischer Zellen und kann auch die Angiogenese beeinflussen, was in Gefäßreparatur und -umbau während Entzündungsprozessen wichtig ist. VTN (Vitronectin) ist ein Glykoprotein, das an der Regulation der Zelladhäsion und der Plasminogenaktivierung beteiligt ist, was ebenfalls kritisch für die Angiogenese ist. Diese Assoziationen könnten darauf hindeuten, dass Störungen in der normalen Angiogenese und Gefäßstabilität zur Pathogenese der Riesenzellarteriitis beitragen. Der dritte neue Genlocus, CCDC25, ist womöglich in die Funktion und Regulation von NETs involviert. NETs sind Netzwerke aus extrazellulärer DNA und Proteinen, die von Neutrophilen freigesetzt werden und bei der Bekämpfung von Infektionen eine Rolle spielen, aber auch bei Autoimmunerkrankungen pathologische Effekte haben können. Die Assoziation von CCDC25 mit Riesenzellarteriitis deutet auf eine Rolle dieser Strukturen bei der Krankheitspathogenese hin, möglicherweise indem Entzündungsreaktionen beeinflusst oder Gewebe geschädigt werden. Die Assoziationen innerhalb der HLA-Region bestätigen die Bedeutung der Immunregulation bei der Riesenzellarteriitis. Spezifische HLA-Allele modifizieren womöglich die Präsentation von Antigenen auf eine Weise, die das Immunsystem dazu bringt, gegen die körpereigenen Gewebe der Blutgefäße zu reagieren, was dann zu Entzündungen und den charakteristischen Symptomen der Riesenzellarteriitis führt.
G. Krönke: Die Modulation von Prozessen wie Angiogenese und NET-Bildung könnte innovative Behandlungsstrategien für Riesenzellarteriitis ermöglichen, insbesondere wenn diese Prozesse in frühen Stadien der Krankheit beteiligt sind. Dies könnte zu zielgerichteteren und potenziell effektiveren Therapien führen als die derzeitigen Standardbehandlungen, die hauptsächlich auf nebenwirkungsreichen Kortikoiden basieren.
Warum konnten bisher nur wenige Genloci identifiziert werden?
E. Latz: Vermutlich weil die Riesenzellarteriitis sehr selten ist und die Stichprobengröße in früheren Studien nicht ausreichte, um einen statistischen Zusammenhang zu zeigen. Aufgrund der Komplexität der genetischen Architektur der Riesenzellarteriitis sind sehr große Stichproben erforderlich, um die nötige statistische Power zu erreichen. Dies ist nötig, um genetische Varianten zu identifizieren, die möglicherweise nur einen kleinen Effekt auf das Krankheitsrisiko haben. Wie viele komplexe Krankheiten zeigt auch die Riesenzellarteriitis eine große genetische Vielfalt, was bedeutet, dass verschiedene Patienten möglicherweise unterschiedliche genetische Risikofaktoren aufweisen. Die Pathogenese der Riesenzellarteriitis wird womöglich auch durch Wechselwirkungen zwischen genetischen Faktoren und Umweltfaktoren beeinflusst. Solche Interaktionen zu identifizieren und zu quantifizieren ist komplex und deshalb ist es schwierig, eindeutige Risikogene zu identifizieren. Traditionelle GWAS sind hauptsächlich darauf ausgelegt, häufige Genvarianten mit kleinen bis moderaten Effekten auf die jeweilige Krankheit zu finden. Seltene Genvarianten oder solche mit größeren Effekten übersieht die GWAS womöglich, insbesondere wenn die zur Genotypisierung eingesetzten Methoden diese nicht abdecken. Diese Faktoren zusammengenommen erklären, warum bisher nur wenige Genloci durch GWAS identifiziert werden konnten. Fortschritte in der Genotypisierungstechnologie, die Integration von umfassenderen genetischen Daten und größere, multizentrische Kollaborationen könnten jedoch dazu beitragen, mehr über die genetischen Grundlagen der Riesenzellarteriitis zu erfahren und so zukünftig mehr relevante Genloci zu identifizieren.
Wird in Zukunft die Riesenzell-arteriitis mit einem Gentest diagnostiziert werden?
G. Krönke: Obwohl die Studie die Möglichkeit eines polygenetischen Risikoscores vorstellt, der das Potenzial hat, Personen mit erhöhtem Risiko zu identifizieren, halte ich es zurzeit für unwahrscheinlich, dass Riesenzellarteriitis in naher Zukunft ausschließlich durch Gentests diagnostiziert wird. Klinische Bewertungen und Bildgebung bleiben entscheidend für die Diagnose und ein solitärer Gentest kann bisher die klinische Betrachtung der Erkrankung nicht ersetzen.
Literatur:
1 Borrego-Yaniz G et al.: Risk loci involved in giant cell arteritis susceptibility: a genome-wide association study. Lancet Rheumatol 2024; 6(6): e374-83
Das könnte Sie auch interessieren:
Bedeutung pulmonaler Symptome zum Zeitpunkt der Erstdiagnose
Bei der Erstdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen können bereits pulmonale Symptome vorliegen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. Eine Studie des Rheumazentrums Jena hat ...
Betroffene effektiv behandeln und in hausärztliche Betreuung entlassen
Bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Gicht ist eine rheumatologisch-fachärztliche Betreuung sinnvoll. Eine im August 2024 veröffentlichte S3-Leitlinie zur Gicht macht deutlich, ...
Gezielte Therapien bei axSpA – und wie aus ihnen zu wählen ist
Nachdem 2003 der erste TNF-Blocker zugelassen wurde, existiert heute für die röntgenologische (r-axSpA) und die nichtröntgenologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) eine ganze Reihe ...