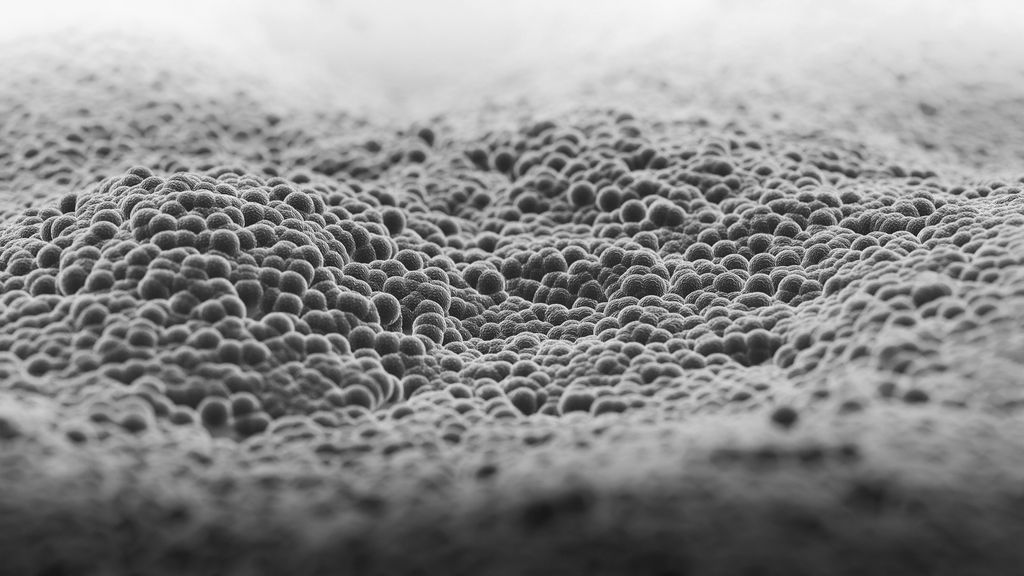
©
Getty Images/iStockphoto
Notfallübung an der MedUni Innsbruck
Jatros
30
Min. Lesezeit
19.12.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ebola, Lassa, Marburg – alles Namen potenziell tödlicher Erkrankungen, die in Österreich kaum vorkommen. Was muss aber geschehen, wenn doch so ein Fall nach Österreich kommt? Über den Notfallplan der MedUni Innsbruck für hochkontagiöse Erkrankungen berichtet Univ.-Prof.<sup>in</sup> Rosa Bellmann-Weiler.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><em><strong>Welche Erreger fallen unter die von Ihnen verwendete Definition von hochkontagiös? </strong></em><br /><em><strong>R. Bellmann-Weiler:</strong></em> Das sind alle Erreger, die auch in die Gruppe 4 der Gefahrenstoffe fallen – also Viren wie Ebola, Lassa, Marburg, Krim-Kongo, im Grunde alle viralen Erreger von lebensbedrohlichen hämorrhagischen Fiebersyndromen aus Afrika und Südamerika, aber auch MERS oder SARS sowie Vogelgrippeviren.</p> <p><em><strong>Wie oft finden Übungen gemäß dem Notfallplan statt? </strong></em><br /><em><strong>R. Bellmann-Weiler:</strong></em> Eine größere Übung machen wir einmal jährlich, aber wir bieten regelmäßig Schulungen an, die über das ganze Jahr verteilt stattfinden.</p> <p><em><strong>Wie viele Personen nehmen an einer größeren Übung teil? </strong></em><br /><em><strong>R. Bellmann-Weiler:</strong></em> An einer Übung sind alle Personalgruppen beteiligt: Sicherheitsdienst, Krisenstab, Transportdienst, Ökologie, Labordiagnostik und natürlich Ärzte und Pflegepersonal. Auch die Krankenhaushygiene und die PRAbteilung sind involviert. Das dürften über 100 Personen sein, denke ich.</p> <p><em><strong>Was muss passieren, damit der Notfallplan in Gang gesetzt wird? </strong></em><br /><em><strong>R. Bellmann-Weiler:</strong></em> Es muss einen dringenden Verdachtsfall geben, wobei der Verdacht von einem dafür kompetenten Facharzt ausgesprochen wird. Der Patient könnte, angekündigt über den Amtsarzt, aus dem niedergelassenen Bereich zugewiesen werden oder direkt an die Notfallaufnahme kommen. Natürlich ist dabei die Reiseanamnese des Patienten wichtig, ebenso wie die Kenntnis über aktuelle Ausbrüche. Diese werden an der Anmeldeleitstelle der Notfallaufnahme angeschlagen. <br />In Innsbruck wird nach Feststellung des Verdachts ein Infektionskonsil eingeholt. Zur Zeit des Ebolaausbruchs in Westafrika wurde sogar ein infektiologischer Bereitschaftsdienst eingerichtet.</p> <p><em><strong>Könnten Sie kurz die wichtigsten Eckpunkte des Notfallplans beschreiben? </strong></em><br /><em><strong>R. Bellmann-Weiler:</strong></em> Das Wichtigste ist, dass der Patient sofort, schon in der Notfallaufnahme, isoliert wird. Pfleger und Ärzte, die dort in Kontakt mit dem Patienten kommen, müssen sich sofort mit einem Schutzanzug ausrüsten. Der Rest der Notfallaufnahme wird geräumt. <br />Gleichzeitig wird über die Telefonzentrale eine Informationskette in Gang gesetzt. <br />Die Sonderisolierstation wird hochgefahren. Das heißt: Zunächst werden die dafür bestimmten Isolationszimmer mit Unterdruck freigeräumt, in weiterer Folge die ganze Station. Eines der beiden Isolationszimmer ist für den Patienten bestimmt, ein zweites wird zum Labor.</p> <p><em><strong>Gibt es zu diesen Notfallmaßnahmen internationale Standards, die einzuhalten sind? </strong></em><br /><em><strong>R. Bellmann-Weiler:</strong></em> Es gibt Standards der WHO, was die Ausrüstung angeht. Und es gibt natürlich auch Vorschriften, was zum Beispiel die Entsorgung des Abfalls in so einer Situation betrifft. Wir haben da mit München und mit Düsseldorf zusammengearbeitet und unsere Abläufe aufeinander abgestimmt. Diese Vernetzung, in der man einander hilft, ist zumindest im deutschsprachigen Raum schon sehr gut etabliert.</p> <p><em><strong>Gibt es solche Übungen und Notfallpläne auch an anderen Krankenhäusern in Österreich? </strong></em><br /><em><strong>R. Bellmann-Weiler:</strong></em> Laut österreichischem Strukturplan Gesundheit sind derzeit drei Zentren für die Behandlung hochkontagiöser Erkrankungen vorgesehen: das KFJ-Spital in Wien, das LKH Graz Süd-West und die Universitätsklinik Innsbruck. Aber darüber hinaus muss jedes Krankenhaus in Österreich in der Lage sein, mit potenziell hochinfektiösen Patienten zumindest so lange umzugehen, bis der Transfer an eines der erwähnten Zentren in die Wege geleitet ist. Da geht es um den Schutz des Patienten, des Personals und der Umgebung. Daher müssten diese Notfälle in allen Krankenhäusern Österreichs geübt werden.</p> <p><em><strong>Wir danken für dieses Gespräch!</strong></em></p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Zytomegalievirus: an die Risiken der Reaktivierung denken!
Infektionen mit dem Zytomegalievirus (CMV) verlaufen bei Gesunden zumeist asymptomatisch, führen jedoch zur Persistenz des Virus im Organismus. Problematisch kann CMV werden, wenn es ...
Medikamenteninteraktionen: hochrelevant im klinischen Alltag
Bei gleichzeitiger Einnahme mehrerer Medikamente ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese einander beeinflussen. Diese Wechselwirkungen können zum kompletten Wirkungsverlust oder auch ...
Update EACS-Guidelines
Im schottischen Glasgow fand im November 2024 bereits zum 31. Mal der KongressHIV Drug Therapy Glasgow, kurz HIVGlasgow, statt. Eines der Highlights des Kongresses war die Vorstellung ...


