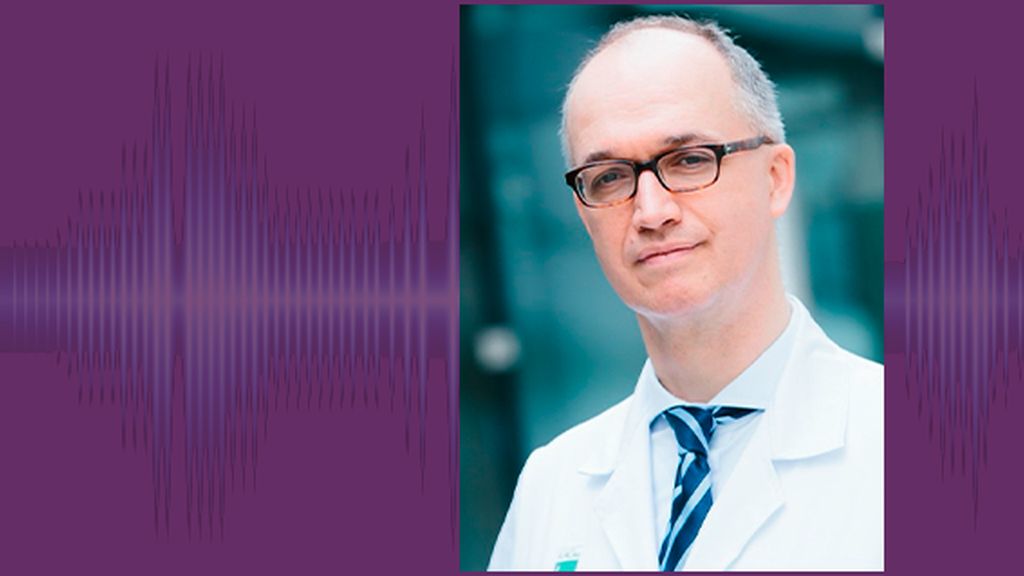
„Das Mund-Rachen-Mikrobiom bietet spannende Ansätze“
Das Interview führte Dr. Katrin Spiesberger
Unser Gesprächspartner:
Univ.-Prof. Dr. Dietmar Thurnher
Leiter der Klinischen Abteilung für Allgemeine HNO
Medizinische Universität Graz
E-Mail:
dietmar.thurnher@medunigraz.at
Ende Mai fand die 93. Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie e.V. (DGHNO-KHC) statt. Auch dieses Jahr waren einige österreichische Experten bei diesem großen Kongress vertreten. Wir durften mit Univ.-Prof. Dr. Dietmar Thurnher, Graz, über seinen Vortrag und weitere aktuelle Themen, die präsentiert wurden, sprechen.
Vom 25. bis 28. Mai 2022 verwandelte sich die Deutsche Messe Hannover in das Epizentrum der deutschsprachigen HNO-Heilkunde bzw. Kopf- und Halschirurgie. Mehr als 2000 Teilnehmende informierten sich über aktuelle Themen aus den Bereichen Rhinologie, Otologie, Phoniatrie, Laryngologie, Kopf-Hals-Onkologie, Schlafmedizin und natürlich war auch Covid-19 vertreten. In diesem Jahr war auch die Österreichische Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie im Rahmen von zwei Joint Meetings zum Thema „Biologika in der regionalen Onkologie“ sowie „Ergebnisse der Cochlea-Implantation bei älteren Patienten mit Single-Sided Deafness“ geladen. Wir durften mit dem Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft, Univ.-Prof. Dr. Dietmar Thurnher, Graz, über seine Eindrücke, seine Highlights und natürlich auch über seinen Vortrag sprechen.
Herr Prof. Thurnher, wie war es denn bei der Jahresversammlung der Deutschen Gesellschaft?
D. Thurnher: Das war nach langer Zeitder erste Kongress für mich, der wieder wiein der Zeit vor der Pandemie stattgefunden hat. Die Leute waren total enthusiastisch, das hat man gemerkt. Es gab mehr als 2500 Besucher – es war also ein richtig großer Kongress – und er war völlig maskenlos und ohne Testkontrollen. Ich bin mit Maske hineingestürmt und habe mir gedacht: Da ist etwas komisch. Trotzdem haben wir von keinen „Katastrophen“ gehört – es hat alles super funktioniert.
Es gab acht Parallelveranstaltungen. Man hat da keine Chance, alles zu hören, sondern muss sich seine Highlights wirklich herauspicken. Ich habe zum Beispiel daher leider keine Zeit gehabt, die zweite Joint Session mit der Österreichischen HNO-Gesellschaft zu sehen, weil ich andere Verpflichtungen hatte. Natürlich war ich bei meiner eigenen, das war am Freitagmorgen die Frühsession von 8 bis 9.30 Uhr. Wir dachten, wir werden dort allein sein – bei acht Parallelsessions und auch weil es um ein „Nischenprodukt“ ging – und haben deshalb auch einen eher kleinen Saal bekommen. Schlussendlich sind dann doch 30 bis 40 Leute gekommen, was für diese Art von Session sehr gut war.
Letztes Jahr haben wir ein Interview mit dem damaligen Kongresspräsidenten Prof. Dietz geführt, der sehr positiv über die Beziehung zwischen der Österreichischen und der Deutschen HNO-Gesellschaft gesprochen hat. Wie gestaltet sich die Beziehung und sind die Österreicher jedes Mal vertreten?
D. Thurnher: Tatsächlich gibt es die deutsch-österreichischen Joint Sessions nicht jedes Jahr. Es gibt ja mehrere HNO-Gesellschaften, mit denen dann gemeinsame Sessions abgehalten werden: die deutsch-spanische, die deutsch-türkische oder die deutsch-chinesische. Dass wir dabei sind, ist also kein Fixum. Aber insgesamt ist die Verbindung zur Deutschen HNO-Gesellschaft sehr gut. Manche von uns sind jedes Jahr am Kongress, auch ich bin jedes Jahr dort. Und umgekehrt ist es auch so: Da war Prof. Dietz ein gutes Beispiel, weil er ein „Dauerabonnent“ ist; er kommt jedes Jahr zum Österreichischen HNO-Kongress. Der österreichische ist natürlich der wesentlich kleinere Kongress. Abgesehen vom Wiener Kongress, wo wir die 1000er-Marke knacken, sind es meistens so 600 bis 700 Teilnehmer. Im Vergleich zum deutschen Kongress oder zu den amerikanischen ist das wirklich klein. Es ist ein kleines, feines Meeting und unseren deutschen Stammgästen gefällt der Kongress immer sehr gut, was unser freundschaftliches Verhältnis zueinander unterstreicht.
Nun zum Joint Meeting bzw. zum Round-Table-Gespräch zu „Biologika in der Onkologie“. Sie haben den ersten Vortrag zum Thema „Einfluss des Mikrobioms im Pharynx auf die Prognose des Plattenepithelkarzinoms“ gehalten. Wollen Sie kurz umreißen, was Sie präsentiert haben?
D. Thurnher: Ein Thema, mit dem wir uns schon länger beschäftigen, ist das Mikrobiom. Da redet jeder relativ viel darüber, egal wo, egal in welchem Themenkreis. Das Mikrobiom im Mund, im Rachen ist nach dem Darmmikrobiom das zweitgrößte Mikrobiom im menschlichen Körper. In diesem Bereich, also bei uns „oben“, sammeln wir allerdings noch Daten: Wie unterscheidet sich das Tumormikrobiom vom normalen Mikrobiom? Machen äußere Einflüsse etwas aus? Macht Rauchen etwas aus? Macht HPV etwas aus? Usw. Dazu sind bislang noch wesentlich weniger Arbeiten publiziert worden als beim Darmmikrobiom. Sprich, es ist momentan noch deskriptiv, das heißt, man kann jetzt noch keine Therapie ableiten. Aber wir befinden uns schon an der Grenze zum Machbaren: Beim Darmmikrobiom hat man z.B. festgestellt, dass man das Mikrobiom von Personen, die gut auf eine Therapie ansprechen, übertragen kann. Auch wir stehen kurz davor – Stichwort personalisierte Medizin.
Welche Themen waren sonst noch in dieser Joint Session vertreten?
D. Thurnher: Prof. Riechelmann aus Innsbruck hat ein Überblicksreferat über die Studienlage bei Immunonkologika gehalten, die natürlich jetzt gerade auch in aller Munde sind. Er hat eher kritisch statistisch die Arbeiten in ihre Details zerlegt und die Pitfalls aufgezeigt, was sehr augenöffnend war. Daran anschließend hat Prof. Burian aus Linz in ähnlicher Art, aber eher mit klinischem Bezug, die Studienlage zu den Immunonkologika und die damit verbundenen therapeutischen Möglichkeiten erörtert. Die Kollegin Runge aus Innsbruck, eine Mitarbeiterin von Prof. Riechelmann, hat über Viren als Vektoren gesprochen. Sie berichtete darüber, welche Agenzien man mit Viren in den Körper bringen kann. Es gibt dazu zwar Phase-I- und -II-Studien, insbesondere Chinesen haben unbemerkt von der westlichen Welt ein paar Vektoren gebracht, die wir nicht verwenden oder verwenden können. Alles in allem ist das aber natürlich noch sehr experimentell.
Den Abschluss hat ein Kollege aus Deutschland, Dr. Linxweiler, zum Tumor-Microenvironment gemacht – ein sehr interessantes Thema. Man hat früher immer gesagt, dass die Tumorzelle alles steuert. Sie gibt ihre Botenstoffe und die Botschaft ab, sich weiter zu teilen. Der Tumor steuert sich selbst und die Umgebung und legt das Immunsystem lahm. Jetzt hat man entdeckt, dass die Fibroblasten im Bindegewebe auch im Tumor anders sind: Die Tumorfibroblasten geben eigene Botenstoffe ab und regulieren so den Tumor mit – ein hochkomplexes und sehr interessantes Thema!
Sind Ihnen sonst noch Präsentationen im Kopf geblieben, spannende Ergebnisse, die Sie für bahnbrechend halten?
D. Thurnher: Wenn ich Zeit habe, gehe ich jedes Jahr zu dem interdisziplinären Tumorboard. In den letzten Jahren hat das immer Prof. Dietz mit seiner Expertenrunde geleitet. Verschiedene Vertreter aus unterschiedlichen Kliniken können „absurde“ Fälle dort vorstellen. Das kommt immer sehr gut an, da sitzen die Leute auf dem Boden, weil der Saal voll ist. Das ist nichts Experimentelles, nichts Neues, sondern das ist „real world“, so läuft es im Tumorboard.
Teilweise konnte ich auch noch an der Session – eigentlich eine Robotersession – teilnehmen, bei der es um die Frage gegangen ist: Brauchen wir den Roboter überhaupt?
Die roboterassistierte Chirurgie ist ja gerade im HNO-Bereich im Kommen, da entwickelt sich viel. Und, brauchen wir die Chirurgie mit dem Roboter?
D. Thurnher: Der Kollege Nagel, Schüler von Michael Hinni von der Mayo Clinic in Scottsdale, hat das Thema vorgestellt. Er war selbst früher ein Laserchirurg, der auf den Roboter umgestiegen ist, und er hat sehr genau expliziert, wo man welche Technologie besser einsetzt. Denn die „ports“, also die Arme des Roboters, sind für unseren Bereich noch relativ grob. Da muss sich noch einiges tun. Wenn ich direkt auf den Kehlkopf hinunterblicke, bin ich mit dem Laser in aller Regel besser bedient. Um mit diesen „ports“ in den Kehlkopf reinzugehen, fehlt es noch an technischen Feinheiten. Die sind derzeit einfach noch zu starr.
Im September findet der österreichische HNO-Kongress, dem Sie dieses Jahr vorstehen, in Graz statt: Was erwartet uns heuer? Können Sie uns bereits ein paar Einblicke geben?
D. Thurnher: Unser Kongressthema 2022 „Visualisierungen und Visionen“ hatten wir eigentlich für 2020 schon vorgesehen. Wir bedienen uns dieses Themas wieder, da der Grazer Kongress 2020 ja kein „richtiger“ Grazer Kongress war, sondern nur online abgehalten wurde. Damals mussten wir aufgrund der Corona-Umstände ultraknapp umsteigen und in kürzester Zeit einen Online-Kongress kreieren. „Visualisierungen und Visionen“ wurde 2020 als Kongressthema gewählt, da in Graz diese Visualisierung in der endoskopischen Chirurgie, der funktionellen endoskopischen Nebenhöhlenchirurgie, durch Messerklinger und Stammberger immer sehr stark war.
Heuer werden wir erstmalig die Säle ein bisschen in Tracks teilen. Sprich, in einem Saal werden hauptsächlich Rhinologie und verwandte Themen behandelt, in einem anderen Saal die Otologie usw. Auch die ARGE YoungHNO wird eine Plattform bekommen. Außerdem haben wir für alle vier Tracks einen Keynote Lecturer eingeladen, der explizit eine Dreiviertelstunde über das jeweilige Thema redet. Wir haben dabei versucht, möglichst keine Parallelveranstaltung abzuhalten. Uns war wichtig, dass die Keynote Lecture theoretisch von jedem gesehen werden kann. In der Rhinologie wird Prof. Simmen aus der Schweiz die Keynote Lecture halten, in der Onkologie Prof. Riechelmann aus Innsbruck, in der Otologie Prof. Plontke aus Deutschland und in der Phoniatrie Prof. Zorowka aus Innsbruck. Da es der Abschlusskongress von Prof. Riechelmann und Prof. Zorowka sein wird – beide sind nach dem Kongress noch sieben Tage im Amt – freuen wir uns, dass sie als Keynote Lecturer dabei sein werden.
Welche Neuerungen werden uns sonst noch erwarten?
D. Thurnher: Man kann sich auf interaktive Sessions freuen, bei denen das Publikum mitvoten kann. Da gibt es jeden Tag ein paar davon – wir werden sehen, wie das ankommt.
Im Gegensatz zum Round-Table-Format, bei dem aufgrund der Vorträge oft wenig Zeit zum Diskutieren bleibt, werden bei diesen interaktiven Sessions Experten eingeladen, um Fragen zu beantworten. Da man als Moderator Fragen und Antworten vorbereiten muss, ist es zwar aufwendiger, aber auch spannend.
Und natürlich wird es dieses Jahr auch wieder die Instructional Courses geben.
Vielen Dank für diesen Vorgeschmack! Gibt es darüber hinaus noch Spannendes von Ihrer eigenen Forschungsarbeit zu berichten?
D. Thurnher: Zurzeit sind wir in Studien involviert, die von Pharmafirmen betrieben werden. Unter anderem haben wir vor einigen Wochen im deutschsprachigen Raum erstmalig einem onkologischen Patienten ein RNA-Compound von Biontech verabreicht. Hier wird ein ähnliches Konzept wie bei der Impfung verfolgt: Ein Tumorpatient wird mittels eines hochspezifischen RNA-Moleküls behandelt. Biontech ist hier ja ganz vorne dabei, konnte die Forschung sozusagen auch über die Impfung absolvieren und kennt sich damit aus. Das ist ein extrem spannendes Projekt. Wir werden sehen, wie es funktioniert, wir erwarten uns auf jeden Fall viel davon.
Und natürlich forschen wir weiter zum Mikrobiom, das wird sicher noch eine Zeit lang unser Fokus sein bzw. unter anderem einer unserer Fokusse bleiben.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie Coaching den Fachärztemangel an medizinischen Abteilungen angehen kann
Hohe Arbeitsbelastung, Stress, schlechte Stimmung: An vielen Spitalskliniken ist das die tägliche Realität. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fachärzt:innen den Weg in die ...
Von „Klassikern“ bis zu „Raritäten“: Einführung in die Radiofrequenztherapie
Die Radiofrequenztherapie ist mittlerweile bei HNO-Eingriffen vielfältig einsetzbar. Aufgrund des steilen Temperaturgradienten wird das umliegende Gewebe geschont und es treten keine ...
AC102: ein vielversprechender Wirkstoffkandidat bei Hörsturz
Hörsturz führt häufig zu dauerhaftem Hörverlust und Begleiterkrankungen wie Tinnitus. Glukokortikoide werden für den Off-Label-Einsatz verschrieben, obwohl es keine klinischen Beweise ...




