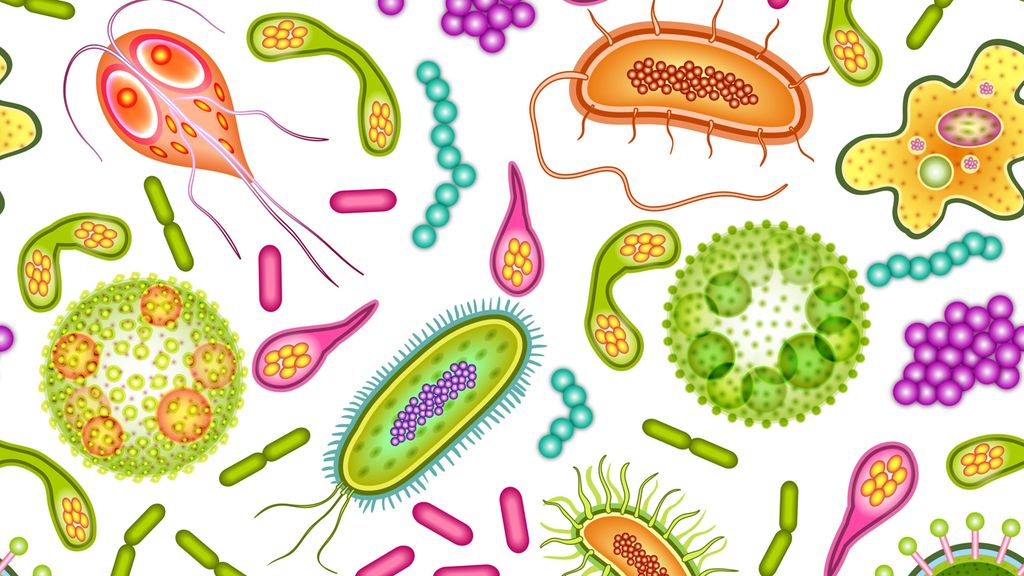
Das nasale Mikrobiom bei Patienten mit chronischer Rhinosinusitis
Autor:
Dr. Thomas Hirsch
Univ.-OA PD Dr. Axel Wolf
Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde
Universitätsklinikum Graz
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Neueste Forschungsergebnisse geben Hinweise, dass das nasale Mikrobiom mit der Pathogenese einer chronischen Rhinosinusitis (CRS) in Zusammenhang steht. Wenngleich die Definition einer „normalen“ Mikrobiomzusammensetzung der Nasenschleimhaut aussteht, zeigen sich deutliche Unterschiede zum CRS-Mikrobiom. Diese könnten neue therapeutische und präventive Ansätze in der CRS-Behandlungeröffnen.
Keypoints
-
Die Dysbiose-Hypothese, also die Veränderung der stabilen mikrobiellen Gemeinschaft, könnte eine Rolle in der Pathogenese der CRS spielen.
-
Viren und Pilze sind in der Forschung noch unterrepräsentiert.
-
Bei CRS-Patienten ist oft ein Übergewicht von Anaerobiern zu beobachten.
-
Die genaue Rolle des Mikrobioms in der Pathogenese der CRS muss noch weiter untersucht werden.
Die chronische Rhinosinusitis (CRS) ist eine häufige, weltweit vorkommende Krankheit mit einer Prävalenz von etwa 10–15%.1,2 Die hohe Prävalenz und die Auswirkungen auf die Lebensqualität, sowie auf die Produktivität des Einzelnen, führen zu hohen direkten und indirekten Behandlungskosten.1–3 Die oberen Atemwege spielen eine essenzielle Rolle in der Aufbereitung und Reinigung der eingeatmeten Luft. In der Nase und den Nasennebenhöhlen sorgt die sinunasale, mukoziliäre Clearance für eine Reinigung und spielt eine Schlüsselrolle in der Abwehrfunktion. Eine Umstrukturierung der mikrobiellen Besiedelung ist oft charakterisiert durch eine beeinträchtigte, mukoziliäre Clearance und kann deshalb die Entstehung und den Krankheitsverlauf der CRS beeinflussen. In den letzten Jahren führte ein besseres Verständnis der Rolle des Mikrobioms bei der Entstehung, Anpassung und Funktion des menschlichen Immunsystems zu einem neuen Forschungsschwerpunkt und einer großen Zahl an Studien, welche die Pathogenese der CRS besser erforschen sollten. Was mit In-vitro-Kulturen begann, kann mittlerweile durch molekulargenetische Methoden erforscht werden und ermöglicht eine genaue Analyse der mikrobiellen Besiedelung von Gesunden und Erkrankten. Neben genetischen und biologischen Mechanismen lässt sich bei vielen entzündlichen Erkrankungen, einschließlich der CRS, eine Veränderung des Mikrobioms beobachten. Diese Dysbiose-Hypothese wird auch bei der Pathogenese der CRS zunehmend diskutiert. Der Artikel soll einen Überblick über die komplexe Rolle des Mikrobioms bei Patienten mit CRS geben.
Die Mikrobiomanalyse
Die repräsentative Probengewinnung mittels standardisierter Methoden zur Mikrobiomanalyse im Bereich der Nasennebenhöhlen stellt aufgrund der komplexen Anatomie und der divergierenden mikrobiellen Zusammensetzung in der Nase beziehungsweise den Nasennebenhöhlen eine besondere Herausforderung dar.4 Heutzutage wird der mittlere Nasengang häufig als repräsentative Probenentnahmestelle für die Nasennebenhöhlen verwendet. Dafür gibt es mehrere Gründe. Er zeigt eine hohe Übereinstimmung von Kulturen des Sinus maxillaris,5 er ist der Drainageweg für die Kieferhöhle, die vorderen Siebbeinzellen und die Stirnhöhle und er ist gut im Rahmen von Routineuntersuchungen für die Probenentnahme zugänglich. Trotzdem variiert die Lokalisation für die Probenentnahme zwischen den Studien weiterhin häufig, was den Vergleich von Ergebnissen sowie Metaanalysen erschwert.6
Derzeit gibt es zwei Methoden zur Gensequenzierung von Mikrobiomen:
-
Gezielte Sequenzierung spezifischer Markergene, zum Beispiel 16S-rRNA-Gen für Bakterien und 18S rRNA oder interne transkribierte Spacer-Regionen für Pilze
-
Shotgun-Sequenzierung des Metagenoms
Was den Nachweis von Bakterien betrifft, sind die molekularen Methoden den kulturbasierten Ansätzen bei CRS deutlich überlegen. Die 16S-rRNA-Gen-Sequenzierung ist die häufigste Methode zur Analyse der Gemeinschaft der bakteriellen Besiedelung. Kulturunabhängige, molekulare Techniken haben aber auch Schwachstellen, deren man sich bei der Analyse und Interpretation bewusst sein sollte. Die 16S-rRNA-Gen-Sequenzierung misst die Gesamtmenge oder die relative Häufigkeit der bakteriellen DNA und keine absoluten Abundanzen. Sie unterscheidet deshalb nicht zwischen aktiv wachsender, ruhender oder toter Biomasse.7
Dysbiose des Mikrobioms bei Patienten mit CRS
Ausgangspunkt für die Mikrobiomforschung im Bereich der Nasennebenhöhlen ist die Definition des gesunden Mikrobioms. Es ist wichtig, den Normalzustand eines gesunden Mikrobioms der Nasennebenhöhlen zu definieren. In den oberen Atemwegen werden im gesunden Zustand häufig Bakteriengattungen wie Staphylokokken, Corynebacterium, Peptoniphilus und Propionibacterium nachgewiesen.8–10 Bei Erwachsenen scheint die Gesamtkeimzahl in gesunden und erkrankten Nasennebenhöhlen überraschend ähnlich zu sein. Es wird darüber hinaus sowohl bei gesunden Kontrollgruppen als auch bei Patienten mit CRS häufig eine hohe interindividuelle Mikrobiomvariabilität beobachtet.11,12 Durch die Möglichkeit der Sequenzierung des 16S-rRNA-Gens konnte gezeigt werden, dass sich die mikrobielle Vielfalt bei CRS-Patienten von jener gesunder Kontrollgruppen unterscheidet.11,13 Opportunistische Krankheitserreger kommen in gesunden Nasennebenhöhlen nur in geringer Menge vor, haben aber bei einer Veränderung der stabilen mikrobiellen Gemeinschaft, also einer Dysbiose, das Potenzial, eine Erkrankung zu verursachen.8,9 So könnte eine Dysbiose zu einer akuten Exazerbation eines chronischen Krankheitsbildes führen, ohne dass eine akute Infektion vorliegt. Im Zustand der Dysbiose können opportunistische Mikroorganismen entzündungsfördernd wirken und Pathogene sich vermehren. Diese Beobachtungen führen zur Annahme, dass die Dysbiose eine Rolle in der Pathogenese der CRS spielt.12,14
Bei Patienten mit CRS zeigte sich eine verminderte Diversität des Mikrobioms im Vergleich zu gesunden Patienten, was in weiterer Folge dazu führen kann, dass Pathogene verstärkt wachsen können.12,15 Eine Forschungsgruppe zeigte, dass eine Mikrobiomprobe aus Nasenspülungen von an CRS erkrankten Patienten bei Leukozyten zur Produktion von proinflammatorischen Zytokinen wie Interleukin 5 (IL-5) führte. Im Gegensatz dazu reagierten gesunde Leukozyten nicht mit einer IL-5-Produktion.16 In einer anderen rezenten Studie zeigte sich eine Korrelation zwischen einer Abnahme der Gesamtzahl der Bakterien und ihrer Diversität und der Stärke der Entzündung sowie Eosinophilie des Gewebes.17 Ob die Dysbiose Folge oder Ursache ist, muss aber noch weiter untersucht werden.
Anaerobier
Bei den Anaerobiern sind Peptoniphilus, Anaerococcus und Prevotella häufig. In Mikrobiomstudien bei CRS-Patienten ist oftmals eine Dominanz von Anaerobiern zu beobachten. Hier ist zu bedenken, dass antimikrobielle Medikamente zu einem Selektionsdruck führen können und hypoxische Bedingungen in den Nasennebenhöhlen ein anaerobes Mikrobenwachstum begünstigen können.18 Üblicherweise wird versucht, diese Sinushypoxie durch FESS („functional endoscopic sinus surgery“) zu beheben. Da in Studien auch nach FESS Anaerobier weiterhin vorhanden sind, könnte dies ein Hinweis auf eine Gewebehypoxie sein, die durch die Bedingungen im Nasensekret oder durch Biofilme entsteht und nicht durch die eigentliche Belüftung der Nasennebenhöhlen.18 Die Rolle der Anaerobier in der Pathogenese bleibt somit ein interessantes Forschungsgebiet für die Zukunft.
Fazit und Ausblick
Obwohl die Mikrobiomforschung in den letzten Jahren große Sprünge gemacht hat, bleiben noch Fragen offen. Ein Ziel ist es, ein gesundes beziehungsweise „normales“ Mikrobiom zu definieren. Dafür ist es notwendig, Verteilungsmuster für Bakterien, Viren und Pilze in den oberen Atemwegen zu analysieren. Neben dem lokalen, nasalen Mikrobiom werden in Zukunft auch systemische mikrobielle Wechselwirkungen weiter untersucht werden.
Untersuchungen bei Patienten mit CRS zeigen oftmals eine Dysbakteriose. Bisher ist aber noch nicht geklärt, ob dies Ursache oder Folge der Erkrankung ist. Weitere Studien sind notwendig, um die Patienten in verschiedenen Krankheitsstadien zu untersuchen und auch die Auswirkungen von unterschiedlichen Therapien auf das Mikrobiom festzuhalten. Da anfängliche Techniken sich primär auf die Analyse der numerisch überlegenen Bakterien konzentrierten, liegt der Fokus immer noch stark auf der Erforschung der Bakteriengemeinschaften, während andere Organismen, wie Pilze oder Viren, unterrepräsentiert sind.
Auch wenn sich durch die größere Anzahl an Studien ein besseres Gesamtbild in Bezug auf das Mikrobiom bei CRS ergibt, bleibt die Rolle des Mikrobioms in der Pathogenese umstritten.19,20 Sollte sich eine ätiologische Rolle spezifischer, mikrobieller Gemeinschaftsstrukturen bestätigen, ergeben sich Möglichkeiten für neue therapeutische Interventionen mit Potenzial für personalisierte, mikrobiombasierte Behandlungsstrategien. Präbiotika oder Probiotika könnten so Möglichkeiten zur Modulation der mikrobiellen Gemeinschaft bilden und damit einen neuen Therapieansatz oder auch Präventionsansatz in der CRS-Therapie bieten.
Literatur:
1 Halawi AM et al.: Chronic rhinosinusitis: epidemiology and cost. Allergy Asthma Proc 2013; 34(4): 328-34 2 DeConde AS, Soler ZM: Chronic rhinosinusitis: epidemiology and burden of disease. Am J Rhinol Allergy 2016; 30(2): 134-9 3 Hastan D et al.: Chronic rhinosinusitis in Europe - an underestimated disease. A GA2LEN study: Chronic rhinosinusitis in Europe. Allergy 2011; 66(9): 1216-23 4 Yan M et al.: Nasal microenvironments and interspecific interactions influence nasal microbiota complexity and s. aureus carriage. Cell Host Microbe 2013; 14(6): 631-40 5 Dubin MG et al.: Concordance of middle meatal swab and maxillary sinus aspirate in acute and chronic sinusitis: a meta-analysis. Am J Rhinol 2005; 19(5): 462-70 6 Ramakrishnan VR et al.: The sinonasal bacterial microbiome in health and disease. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2016; 24(1): 20-5 7 Willis AL et al.: Dead or alive: deoxyribonuclease I sensitive bacteria and implications for the sinus microbiome. Am J Rhinol Allergy 2016; 30(2): 94-8 8 Ramakrishnan VR et al.: The microbiome of the middle meatus in healthy adults. PLoS One 2013; 8(12): e85507 9 Sivasubramaniam R, Douglas R: The microbiome and chronic rhinosinusitis. World J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2018; 4(3): 216-21 10 Gevers D et al.: The human microbiome project: a community resource for the healthy human microbiome. PLoS Biol 2012; 10(8): e1001377 11 Biswas K et al.: The nasal microbiota in health and disease: variation within and between subjects. Front Microbiol 2015; 9: 134 12 Hoggard M et al.: Evidence of microbiota dysbiosis in chronic rhinosinusitis: bacterial dysbiosis in CRS. Int Forum Allergy Rhinol 2017; 7(3): 230-9 13 Gan W et al.: Comparing the nasal bacterial microbiome diversity of allergic rhinitis, chronic rhinosinusitis and control subjects. Eur Arch Otorhinolaryngol 2020; 278(3): 711-8 14 Orlandi RR et al.: International consensus statement on allergy and rhinology: rhinosinusitis: international consensus on rhinosinusitis. Int Forum Allergy Rhinol 2016; 6(S1): 22-209 15 Wagner Mackenzie B et al.: Bacterial community collapse: a meta-analysis of the sinonasal microbiota in chronic rhinosinusitis. Environ Microbiol 2017; 19(1): 381-92 16 Aurora R et al.: Contrasting the microbiomes from healthy volunteers and patients with chronic rhinosinusitis. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 139(12): 1328 17 Rom D et al.: The association between disease severity and microbiome in chronic rhinosinusitis. Laryngoscope 2019; 129(6): 1265-73 18 Brook I: The role of anaerobic bacteria in sinusitis. Anaerobe 2006; 12(1):5-12 19 PuWilson MT, Hamilos DL: The nasal and sinus microbiome in health and disease. Curr Allergy Asthma Rep 2014; 14(12): 485 20 Lee JT et al.: Microbiome of the paranasal sinuses: update and literature review. Am J Rhinol Allergy 2016; 30(1): 3-16
Das könnte Sie auch interessieren:
Wie Coaching den Fachärztemangel an medizinischen Abteilungen angehen kann
Hohe Arbeitsbelastung, Stress, schlechte Stimmung: An vielen Spitalskliniken ist das die tägliche Realität. Es ist daher nicht verwunderlich, dass viele Fachärzt:innen den Weg in die ...
Von „Klassikern“ bis zu „Raritäten“: Einführung in die Radiofrequenztherapie
Die Radiofrequenztherapie ist mittlerweile bei HNO-Eingriffen vielfältig einsetzbar. Aufgrund des steilen Temperaturgradienten wird das umliegende Gewebe geschont und es treten keine ...
AC102: ein vielversprechender Wirkstoffkandidat bei Hörsturz
Hörsturz führt häufig zu dauerhaftem Hörverlust und Begleiterkrankungen wie Tinnitus. Glukokortikoide werden für den Off-Label-Einsatz verschrieben, obwohl es keine klinischen Beweise ...


