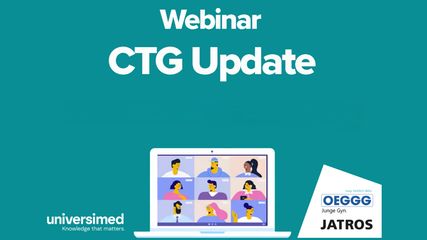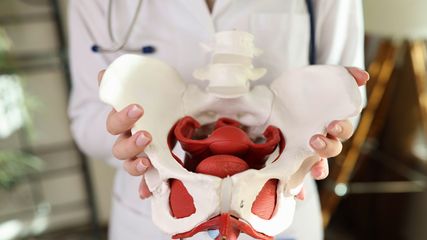©
Getty Images
„Hellseherisch“ ins Jahr 2022
Jatros
30
Min. Lesezeit
30.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">„Prognosen sollte man unbedingt vermeiden, besonders jene über die Zukunft.“ Das Bonmot von Mark Twain – eines der Eingangszitate beim Gynäkologischen Herbstsymposium am Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern in Linz – war für die Vortragenden keineswegs bindend. Nicht „hellseherisch“, wie im Titel der Veranstaltung angeführt, sondern aufgrund wissenschaftlicher Evidenz gaben zahlreiche Experten Einblicke in zukünftige Entwicklungen, insbesondere im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>„Neben dem zentralen Faktor der demografischen Entwicklung muss ein Prognostiker für eine seriöse Gesundheitsplanung auch externe Faktoren wie politische Rahmenbedingungen oder die Änderung von Leitlinien einkalkulieren“, erklärte Prof. Willi Oberaigner vom Department Public Health, Health Service Research & HTA, Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Medizinische Informatik und Technik (UMIT), Innsbruck. Unwägbarkeiten, wie etwa die Migrationswelle des Jahres 2015, können aber sogar die seriösesten Prognosen durcheinanderwirbeln.</p> <h2>Demografische Entwicklung</h2> <p>Die Entwicklung der Bevölkerungsstruktur ist für Prognosen aber durchaus zugänglich: Bis 2030 wird es voraussichtlich 50 000 mehr Frauen in einem Alter von über 80 Jahren geben, die Zunahme bei den 60- bis 70-Jährigen wird bei 10– 15 % liegen. Da in der Altersgruppe über 60 Jahre der Einfluss durch Migrationsbewegungen gering ist, lässt sich dieser Trend prognostisch gut einschätzen. Die statistische Lebenserwartung für eine derzeit 80-jährige Frau liegt aktuell bei 8,8, für eine 85-Jährige bei sechs Jahren. Da die Gruppe der alten Menschen aufgrund von Multimorbiditäten eine zunehmende Herausforderung für das Gesundheitssystem darstellt, sind diese Zahlen von besonderer Bedeutung.<br /> Bei den Geburten wurde der Einfluss der hohen Migration 2015 sofort schlagend: Für das Jahr 2016 wurden gut 80 000 Geburten prognostiziert, tatsächlich waren es 87 747. „Trotz Unsicherheitsintervall, das jeder Prognose innewohnt, rechne ich für das Jahr 2022 mit 91 000 bis 92 000 Geburten“, so Oberaigner. Das Alter der Mutter bei der Erstgeburt ist stetig angestiegen, die Entwicklung blieb in den letzten drei, vier Jahren jedoch relativ konstant und liegt je nach Berechnungsart zwischen 29,6 und 29,8 Jahren. Die Anzahl der Kaiserschnitte nimmt zu, was auch mit dem Trend vermehrter Geburten in den großen Zentren zusammenhängt. Oberaigner rechnet mit einer „relativ konstanten Entwicklung“ des Anteils der Kaiserschnittgeburten, die Prognose für das Jahr 2022 liegt knapp über 30 % .</p> <h2>Krebs</h2> <p>Laut den Daten der Statistik Austria nehmen die absoluten Zahlen der Krebserkrankungen zu, die altersstandardisierte Inzidenzrate in Österreich ist von 1985 bis 2030 aber mit einer Abnahme prognostiziert.<sup>1</sup> Auf Basis der Daten aus Tirol (2014: n=5390) ging diese Rate in den letzten zehn Jahren sogar um 20 % zurück, wobei 80 % der Verschiebung in der Altersstruktur zuzuordnen sind. „Ich würde für Tirol nicht 20, sondern etwa 10 bis 15 Prozent in einem Zeitraum von zehn Jahren schätzen, da man auch den Einfluss der Mammografie einkalkulieren muss. Rechnet man also von jetzt an hoch, dann wird die Zunahme zwischen 8 und 10 Prozent liegen“, sagte Oberaigner.<br /> Nach den Prognosen der Statistik Austria bis 2030 wird es einen Rückgang beim Zervixkarzinom geben, der auch die nachhaltigen Früherkennungsmaßnahmen widerspiegelt. Es wird ein Rückgang der Neuerkrankungen um 58 % und der Sterbefälle um 42 % prognostiziert. Bundesländerspezifische Unterschiede sind nicht zu beobachten, im Unterschied zu anderen Krebsarten sind überdurchschnittlich viele jüngere Frauen (<50 Jahren) betroffen. „Österreichweit waren für 2010 um die 400 Fälle prognostiziert worden, tatsächlich waren es 250. Meiner persönlichen Einschätzung nach wird es einen Rückgang von 20 Prozent in den nächsten zehn Jahren geben“, sagte Oberaigner.<br /> Laut Statistik Austria sind Inzidenz und Mortalität beim Ovarialkarzinom bis 2030 rückläufig, es wird mit einer Abnahme von 20 % gerechnet. Die Zahl der jährlichen Neuerkrankungen sinkt um 36 % , die Zahl der Sterbefälle um 21 % . Es können einheitliche Trends in den Bundesländern beobachtet werden. „Ich persönlich halte 20 Prozent Rückgang für zu hoch, aufgrund der Tiroler Daten rechne ich mit einer relativ konstanten Entwicklung bis hin zu einer leichten Abnahme von etwa 4 Prozent“, so Oberaigner. Eventuell spielen auch unterschiedliche Kodierungsgewohnheiten bei der unterschiedlichen Einschätzung eine Rolle. „Wir sind mit unserem Krebsregister in Tirol sehr gut vernetzt und bekommen durch den direkten Zugang zu allen Krankenhäusern sicher präzisere Daten“, so der Experte.</p> <h2>Versorgungsstrukturen der Zukunft</h2> <p>Der medizinische Fortschritt, der unter anderem mit einem erhöhten Gesundheitsbewusstsein und einer verbesserten Prävention einhergeht, verursacht natürlich Kosten. Die Erfolge sind aber vorzeigbar: Bei den 5-Jahres-Überlebensraten bei einzelnen Krebsarten (Prostatakrebs, Nierenzellkarzinom, Lungenkrebs) liegt Österreich im europäischen Spitzenfeld. Ähnliches gilt für die Mortalitätsraten nach Schlaganfall und Herzinfarkt. „Wir haben ein Gesundheitswesen, das zwar teurer ist als der EU-Schnitt, dafür aber gute Ergebnisse und hohe Qualität erzielt“, erklärte Dr. Michael Heinisch in seinem Eingangsreferat. Heinisch ist Geschäftsführer der Vinzenz-Gruppe, eines Verbundes von Ordenskrankenhäusern, Pflegehäusern und ambulanten Diensten, und einer der großen Player in der Branche. Die Diskussion über Kostenreduzierung durch Strukturveränderungen sei, laut Heinisch, weniger eine von Patientenbedürfnissen denn von Kosten getriebene.<br /> Einer der Gründe der hohen Kosten in Österreich ist die mangelnde Prävention, die Heinisch am hohen Zigaretten- und Alkoholkonsum sowie an den geringen Durchimpfungsraten festmacht. Beim Zigarettenkonsum befindet sich Österreich europaweit im oberen Spitzenfeld. Daneben konsumiert der Österreicher durchschnittlich 16 Liter reinen Alkohols jährlich, nur noch übertroffen von Litauen und Irland. Und die Durchimpfungsrate liegt in Österreich bei lediglich 80 % , dahinter nur mehr Dänemark und Island (WHO, HFA-Database, September 2015). „Anscheinend schaffen wir es nicht, die Menschen wirklich für einen gesunden Lebensstil zu sensibilisieren, durch den im Endeffekt auch das Gesundheitssystem in seinen Leistungen entlastet wird“, erklärte Heinisch.<br /> Bei den Veränderungen in den Strukturen drückt der zusätzliche Versorgungsbedarf am besten die Leistungszunahme aus, die vom Gesundheitswesen abzudecken ist. Die Umstellung der Pflegetag-finanzierten zur leistungsorientierten Behandlung etwa hat die durchschnittliche Verweildauer eines Patienten im Krankenhaus, die im Jahr 1960 noch bei 25 Tagen lag, bis heute auf sechs bis acht Tage reduziert. Im Wesentlichen blieben aber, trotz Einführung von Tages- und Wochenkliniken und des verstärkten IT-Einsatzes, die Prozesse von der Aufnahme bis zur Entlassung gleich. Angesichts der kurzen Verweildauer besteht – auch wenn die Evidenz noch nicht gegeben ist – eine Option aus alternativen Versorgungsstrukturen, wie etwa den neuen Primärversorgungszentren.<br /> Heinisch plädierte außerdem für die Schaffung von Netzwerken, in denen die Eigenständigkeit der einzelnen Bereiche gewährleistet bleibt, sowie für attraktive Strukturen in, aber auch außerhalb von Krankenhäusern, in denen alle Menschen integrativ und möglichst an einem Ort versorgt werden können.</p> <h2>Kontrazeption 2022 – von der Pille zum Chip</h2> <p>Bei der Kontrazeption gilt allgemein als einzig relevantes Risiko die Thrombose. Die Kombination von Ethinylöstradiol (EE) mit Dritt- und Viertgenerationsgestagenen wie Drospirenon, Gestoden oder Desogestrel geht vermutlich mit einer leicht erhöhten Thromboserate – etwa 9 bis 12 Fälle bei 10 000 Frauenjahren – einher. „Obwohl in absoluten Zahlen gering, stellt es ein bedeutsames Problem dar“, erklärte Univ.- Prof. Dr. Christian Egarter, Leiter der Klinischen Abteilung gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, Medizinische Universität Wien.<br /> Estetrol (E4, 15-α-OH-Estriol), das ausschließlich in der fetalen Leber durch 15- α- und 16-α-Hydroxylase synthetisiert wird, kann ab der 9. Schwangerschaftswoche im maternalen Serum nachgewiesen werden (ca. 1ng/ml). Dieses Estetrol bindet sehr selektiv an ER-α, führt im Gegensatz zu EE und 17-β-Estradiol zu keiner signifikanten Erhöhung von SHBG und birgt ein geringes bis gar kein Thromboserisiko.<sup>2</sup><br /> Zu den rezenten Entwicklungen bei der Empfängnisverhütung gehören die Long- Cycle-Kontrazeptiva, die in Österreich mit Seasonique® (EE 30mcg/150mcg LNG) vor eineinhalb Jahren eingeführt worden sind. Zu den Vorteilen einer länger dauernden Einnahme gehören die geringe Anzahl an Zyklen und die Möglichkeit der Wahl des tablettenfreien Intervalls zwischen 25 und 120 Tagen.<sup>3</sup><br /> Da es durch die Einnahme der Pille bei manchen Frauen zu Libidoproblemen kommt, wird es möglicherweise in Zukunft auch Kombinationen mit androgenen Stereoidhormonen geben (orale Kontrazeptiva + DHEA). Ein Vergleich einer Gruppe EE/Drospirenon (n=37) mit EE/ Levonorgestrel (n=36) und DHEA-Zugabe zeigte, dass dies der Unterdrückung des Testosteronspiegels entgegenwirkt.<sup>4</sup> „Ob dies klinisch tatsächlich zu weniger oder gar keinen Libidoproblemen mehr führt, ist jedoch noch nicht in größeren Kollektiven evaluiert“, so Egarter.<br /> Die Kombination einer x-beliebigen Pille mit Myo-Inositol, das auf drei Monate additiv hinzugegeben wird, bewirkt eine wesentlich stärkere Supprimierung der Androgenspiegel. Darüber zeigte sich ein zusätzlicher, positiver Effekt auf Insulinsensitivität und Lipidprofil.<sup>5</sup><br /> In den USA wird eine Kontrazeption durch einen Kaugummi (Femcon Fe<sup>®</sup>, Bristol Myers Squibb) untersucht, in dem neben 35μg EE und Norethindron 0,4mg auch Eisen (75mg) enthalten ist. In Australien wurde 2004 die Kontrazeption mittels Spray (Nestorone<sup>®</sup> Metered Dose, Transdermal System<sup>®</sup> [MDTS<sup>®</sup>]) getestet. „Aufgrund der schlechten transdermalen Resorption ist hier jedoch die Zulassung in Österreich fraglich“, erklärte Egarter. In Zukunft wird es auch eine Kombination von natürlichem Östrogen und natürlichem Progesteron geben, das wahrscheinlich transdermal oder transvaginal zugeführt wird und ebenfalls mit einem geringen Thromboserisiko einhergehen dürfte.<sup>6</sup><br /> Ein Chip, der von der israelischen Firma Teva Pharmaceutical Industries Ltd. gemeinsam mit der US-amerikanischen Firma Microchips Biotech entwickelt wird und für 16 Jahre implantiert werden kann, gibt täglich Levonorgestrel (ca. 30μg) ab und kann jederzeit mittels Fernsteuerung deaktiviert werden.<sup>7</sup> Mit globalen und individuell abgestellten Genexpressionsprofilen von Steroidhormonen wird man in Zukunft das Risiko einer Schwangerschaft individuell modellieren können. Die Entwicklung von Algorithmen wird die Integration von großen Datenmengen („big data“) ermöglichen, womit etwa bei chronischen Erkrankungen das individuelle Risiko einer Schwangerschaft kalkuliert werden kann.</p> <h2>Precision Medicine und translationale Forschung</h2> <p>Der Begriff personalisierte Medizin hat einen Paradigmenwechsel in der Medizin eingeläutet. Personalisierte Medizin beinhaltet eine gezielte Diagnostik und Prävention sowie den Einsatz maßgeschneiderter Therapiekonzepte, um langfristig Nebenwirkungen und unnötige Therapien in einem großen Kollektiv zu reduzieren. Der klassische Ansatz, bei dem primär die Tumorbiologie mittels Zell- oder Mausmodellen erforscht wurde, wird ersetzt durch einen personalisierten Ansatz, dem folgend das Genom, das Transkriptom (die Summe aller zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer Zelle transkribierten Gene, also die Gesamtheit der RNA-Moleküle) und das Proteom erforscht werden.<br /> Im Bereich der gynäkologischen Onkologie kann man in Zukunft beispielsweise einer Patientin mit einem fortgeschrittenen Tumorleiden eine Probe des Tumors entnehmen und diesen mittels der „Multiomics“-Methode (basierend auf der Analyse von Genom, Proteom, Transkriptom, Epigenom und Mikrobiom) genau kategorisieren. Die Suche nach Genmutationen bzw. Biomarkern soll Angriffspunkte für eine eventuell bereits vorhandene Therapie liefern. Öffentliche Datenbanken, in die man seine Marker einspielen kann, liefern eine „Hitliste“ der dazupassenden Medikamente. Zusätzlich werden in den neuen molekularen Tumorboards nicht nur medizinische Experten, sondern auch Molekularbiologen, Informatiker, Pharmakologen und natürlich die jeweiligen Studienkoordinatoren die Therapieoptionen besprechen. „Dies führt unweigerlich zur translationalen Forschung, als dem Verbinden dieser Bereiche mit der angewandten und der klinischen Forschung, wobei Teamdenken und Vernetzung als Voraussetzung gelten, um neue Erkenntnisse zu erhalten“, erklärte Dr. Stefanie Aust, Gynäkologische Onkologie, Medizinische Universität Wien.<br /> Die durch Precision Medicine und Translation Research anfallenden Daten werden gesammelt und verarbeitet (vgl. Genom-Atlas). In eigenen Online-Datenbanken sollen diese komplexen onkologischen Informationen zugänglich gemacht und durch kontinuierliche und rezente Informationen aus dem klinischen Alltag ergänzt werden (Health-IT). „Was noch fehlt, ist ein globaler systemischer Ansatz, bei dem auch die Signalwege und regulatorischen Netzwerke, welche in Wirklichkeit die Funktionen untereinander steuern, berücksichtigt werden“, sagte Aust.<br /> Ein Masterplan der Medizinischen Universität Wien für das Jahr 2025 sieht die Errichtung von drei Zentren vor: eines für translationale Medizin und Therapeutika, ein Technologietransferzentrum und ein Zentrum für Precision Medicine. Damit soll in Österreich die Basis für die wichtigsten medizinischen Trends des 21. Jahrhunderts gelegt werden. Die Finanzierung soll mittels Crowd-Funding erfolgen, Baubeginn ist 2018.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: „Basierend auf wissenschaftlicher Evidenz 2017 und hellseherischen
Fähigkeiten von renommierten Experten: Wie
wird sich unser Fach Gynäkologie und Geburtshilfe im
Jahr 2022 präsentieren?“ Gynäkologisches Herbstsymposium
2017, Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern
Linz, 13. Oktober 2017, Linz
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Trends der Entwicklung von Krebserkrankungen in Österreich. Eine Prognose bis 2030. Statistik Austria 2015 <strong>2</strong> Visser M et al.: In vitro effects of estetrol on receptor binding, drug targets and human liver cell metabolism. Climacteric 2008; 11(Suppl 1): 64-8 <strong>3</strong> Han L, Jensen JT: Expert opinion on a flexible extended regimen of drospirenone/ ethinyl estradiol contraceptive. Expert Opin Pharmacother 2014; 15: 2071-9 <strong>4</strong> Coelingh Bennink HJT et al.: Maintaining physiological testosterone levels by adding dehydroepiandrosterone to combined oral contraceptives: I. Endocrine effects. Contraception 2017; 96: 322-9 <strong>5</strong> Minozzi M et al.: The effect of a combination therapy with myo-inositol and a combined oral contraceptive pill versus a combined oral contraceptive pill alone on metabolic, endocrine, and clinical parameters in polycystic ovary syndrome. Gyn Endocrinol 2011; 27: 920-4 <strong>6</strong> Helbling IM et al.: The optimization of an intravaginal ring releasing progesterone using a mathematical model. Pharm Res 2014; 31: 795-808 <strong>7</strong> Sutradhar KB, Sumi CD: Implantable microchip: the futuristic controlled drug delivery system. Drug Deliv 2016; 23: 1-11</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Webinar „CTG-Update“
Webinar „CTG-Update“ mit Dr. Elisabeth D’Costa: Aktuelle Leitlinien, praxisnahe Tipps und neue Standards kompakt zusammengefasst. Jetzt ansehen und Wissen auffrischen!
Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie
Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...
Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News
Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...