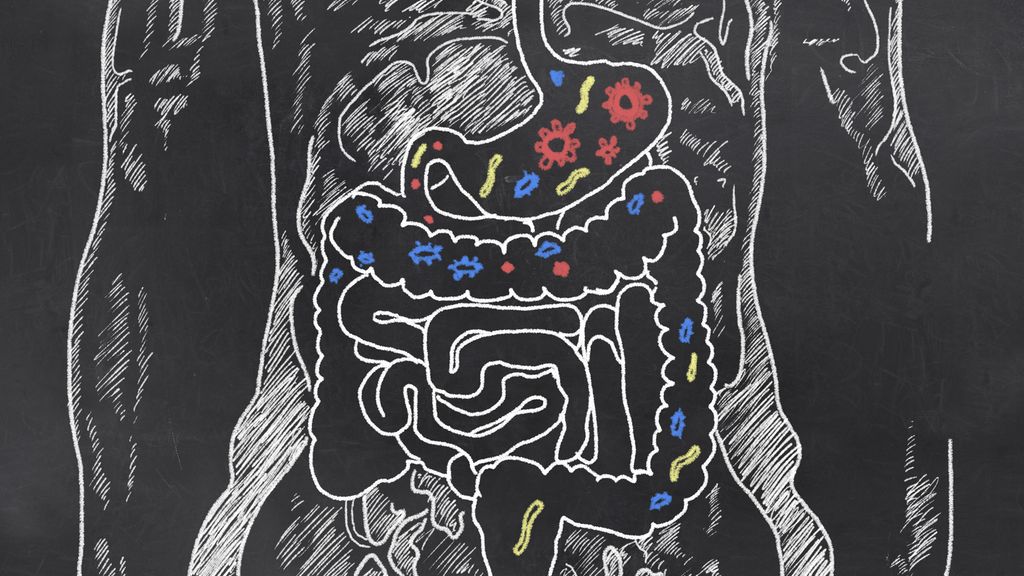
©
Getty Images/iStockphoto
Gastritis und Oberbauchschmerzen
Jatros
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Michael Gschwantler
4. Medizinische Abteilung, Wilhelminenspital Wien<br> E-Mail: michael.gschwantler@wienkav.at
30
Min. Lesezeit
08.06.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Zahlreiche Erkrankungen können zu akuten Oberbauchschmerzen führen. Um bei der differenzialdiagnostischen Abklärung von Patienten mit akuten Oberbauchschmerzen nichts zu übersehen, ist es zu empfehlen, systematisch vorzugehen.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li><span xml:lang="de-DE">Grundsätzlich können Oberbauchschmerzen Anzeichen für drei Erkrankungsarten sein: ­Erkrankungen von Oberbauch­</span><span xml:lang="de-DE">organen, thorakale Erkrankungen</span><span xml:lang="de-DE"> und Stoffwechselerkrankungen.</span></li> <li><span xml:lang="de-DE">Bei der Diagnose einer Gastritis sind die Autoimmungastritis (Typ A), die Helico­bacter-Gastritis (Typ B) und die chemische ­Gastritis (Typ C) voneinander zu unterscheiden.</span></li> <li><span xml:lang="de-DE">Aufgrund häufiger Clarithromycin-</span><span xml:lang="de-DE">Resistenzen sollte eine 7-Tage-Tripeltherapie ohne vorherige Resistenztestung in Österreich nicht mehr zur H.p.-Eradikation eingesetzt werden.</span></li> </ul> </div> <p>Die möglichen Ursachen von akuten Oberbauchschmerzen lassen sich primär in drei Gruppen von Erkrankungen einteilen:</p> <p>1. Erkrankungen von Oberbauchorganen: Zu dieser Gruppe zählen unter anderem Erkrankungen des Magens (z.B. Ulcus ventriculi, Gastritis, Reizmagensyndrom), des Duodenums (z.B. Ulcus duodeni), der Leber (z.B. akute Hepatitis, Stauungsleber), der Gallenblase (z.B. akute oder chronische Cholezystitis), des Gallengangsystems (z.B. Choledocholithiasis, Cholangitis), des Pankreas (z.B. akute und chronische Pankreatitis), der Milz (z.B. Milzinfarkt), des Dünndarms (z.B. Ischämie, Ileus), des Dickdarms (z.B. ischämische Kolitis) und des Gefäßsystems (z.B. Aorten­aneurysma).</p> <p>2. Thorakale Erkrankungen, die in den Oberbauch ausstrahlen können: Zu dieser Gruppe zählen potenziell lebensbedrohliche Erkrankungen wie der akute Hinterwandinfarkt oder das Aneurysma dissecans sowie Erkrankungen, die zu einer Affektion der basalen Pleura führen können (z.B. basale Pneumonie, Pleuritis oder Pulmonalinfarkt).</p> <p>3. Stoffwechselerkrankungen, die zu akuten abdominellen Schmerzen führen können: Zu dieser Gruppe von Erkrankungen zählen akute Porphyrien, das familiäre Mittelmeerfieber, Pseudoperitonitis diabetica sowie Urämie.</p> <p>Eine erschöpfende Diskussion der genannten Erkrankungen würde ein ganzes Lehrbuch füllen. In weiterer Folge soll lediglich die Differenzialdiagnose der Gastritis diskutiert werden.</p> <p>Der Begriff Gastritis beschreibt eine entzündliche Affektion der Magenschleimhaut, die sehr unterschiedliche Ursachen haben kann. Die drei häufigsten Ursachen für eine chronische Gastritis sind eine Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori (H.p., sogenannte Gastritis Typ B), die Autoimmungastritis (Gastritis Typ A) sowie die chemische Gastritis (Gastritis Typ C), hervorgerufen meist durch die Einnahme nichtsteroidaler Antirheumatika oder einen Reflux von Galle in den Magen. Andere Ursachen einer Gastritis wie lymphozytäre Gastritis, Morbus Crohn, Sarkoidose, eosinophile Gastritis oder Gastritis im Rahmen einer Vaskulitis sind selten.</p> <p>Bei der Diagnose Gastritis handelt es sich im Wesentlichen um eine Diagnose, die nur histologisch gesichert werden kann und die klinisch lediglich vermutet werden kann. Von Gastritiden müssen funktionelle Störungen des oberen Verdauungstraktes wie das Reizmagensyndrom abgegrenzt werden. Eine Gastritis ist nicht notwendigerweise mit Symptomen wie Oberbauchschmerzen, Völlegefühl oder Übelkeit verbunden. Ganz im Gegenteil sind viele Patienten mit Gastritis klinisch völlig asymptomatisch. Da das Reizmagensyndrom sehr häufig ist, sind Oberbauchbeschwerden bei bestehender Gastritis häufig nicht durch die Gastritis, sondern durch ein gleichzeitig bestehendes Reizmagensyndrom verursacht, sodass eine kausale Therapie der Gastritis nicht immer zu einem Verschwinden der Symptome führt.</p> <h2>Helicobacter-Gastritis (Typ-B-Gastritis)</h2> <p>Nach einer Infektion mit H.p. entwickelt sich zunächst bei allen Patienten eine Antrumgastritis, die auch als B-Gastritis bezeichnet wird. Diese verläuft meist asymptomatisch oder verursacht nur unspezifische Symptome wie leichte Oberbauchschmerzen. Nur ein kleiner Teil aller Infizierten entwickelt im weiteren Verlauf Folgeerkrankungen der H.p.-Infektion wie eine gastroduodenale Ulkuskrankheit, ein MALT-Lymphom des Magens oder ein Magenkarzinom (Abb. 1 und 2). Der Nachweis einer H.p.-Infektion kann im Rahmen einer Gastroskopie mittels Urease-Schnelltest, Histologie oder H.p.-Kultur oder nicht invasiv durch C13-Atemtest oder Antigenbestimmung im Stuhl erfolgen. Idealerweise sollte ein Patient vor einem geplanten H.p.-Nachweis mindestens vier Wochen lang keine Antibiotika und mindestens zwei Wochen lang keinen Protonenpumpenhemmer (PPI) eingenommen haben, da andernfalls durch eine Suppression von H.p. falsch negative Testergebnisse auftreten können. Serologische Tests auf H.p. sind zur Bestimmung des Eradikationserfolges nicht geeignet, da auch nach erfolgreicher H.p.-Eradikation Antikörper gegen H.p. noch jahrelang im Serum persistieren können.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Infekt_1702_Weblinks_s20.jpg" alt="" width="2150" height="1108" /></p> <p>Mit der Etablierung effizienter Antibiotikaregime zur H.p.-Eradikation wurde eine kausale Therapie sowohl der H.p.-Gastritis als auch zahlreicher Folgekrankheiten der H.p.-Gastritis möglich. Die viele Jahre hindurch angewandten 7-Tage-Tripeltherapien (Clarithromycin + Amoxicillin + PPI bzw. Clarithromycin + Metronidazol + PPI) sollten in Österreich nicht mehr (ohne vorhergehende Resistenzbestimmung) zur H.p.-Eradikation eingesetzt werden, da Clarithromycin-Resistenzen in Österreich inzwischen sehr häufig sind (21,1 % ). Vom aktuellen Maastricht V/Florence Consensus Report und vom amerikanischen Toronto Consensus werden für Länder mit einer Resistenzsituation wie in Österreich als First-Line-Therapie entweder eine „concomitant therapy“ (bestehend aus Amoxicillin, Clarithromycin, Metronidazol und PPI) oder eine Bismuth-basierte Quadrupeltherapie jeweils über 14 Tage empfohlen.</p> <h2>Autoimmungastritis (Typ-A-Gastritis)</h2> <p>Aufgrund einer Autoimmunreaktion kommt es bei der Autoimmungastritis zu einer chronischen Entzündung der Magenschleimhaut hauptsächlich im Korpus- und Fundusbereich, die nach jahrelangem Verlauf zu einer Schleimhautatrophie in den proximalen Magenabschnitten führt. Da im Magenkorpus und Magenfundus Magensäure und der für die Vitamin-B12-Resorption nötige „intrinsic factor“ gebildet werden, kommt es zu einer Abnahme der Magensäureproduktion und zum Auftreten eines Vitamin-B12-Mangels mit Ausbildung einer hyperchromen makrozytären Anämie und anderer Symptome wie neurologischer Störungen (z.B. funikuläre Myelose). Die Diagnose kann durch typische Laborveränderungen (hyperchrome makrozytäre Anämie, erniedrigter Vitamin-B12-Spiegel, LDH-Erhöhung u.a.) vermutet werden und wird gastroskopisch/histologisch sowie mittels serologischen Nachweises von Parietalzell-Antikörpern und Antikörpern gegen den „intrinsic factor“ gesichert. Da die Vitamin-B12-Resorption gestört ist, muss dieses Vitamin lebenslänglich parenteral substituiert werden. Patienten mit Autoimmungastritis sind mit einem deutlich erhöhten Risiko für das Auftreten von Magenkarzinomen und neuroendokrinen Tumoren des Magens belastet. Regelmäßige endoskopische Kontrollen sind daher zu empfehlen.</p> <h2>Chemische Gastritis (Typ-C-Gastritis)</h2> <p>Die häufigste Ursache einer chemischen Gastritis ist die Einnahme nichtsteroidaler Antirheumatika (NSAR). Als Komplikation können Ulcera duodeni und Ulcera ventriculi auftreten, die – bedingt durch die analgetische Wirkung dieser Substanzen – nicht selten erst durch Komplikationen wie Blutung oder Perforation klinisch manifest werden. Die Diagnose einer durch NSAR-Einnahme verursachten Schädigung der Magenschleimhaut kann bereits durch die Anamnese vermutet werden. Allerdings gestaltet sich die Anamnese im Hinblick auf die Einnahme von NSAR in der Praxis oft sehr schwierig, da viele Patienten NSAR nicht als Medikamente empfinden und daher erst auf wiederholte und gezielte Nachfrage über den Gebrauch von NSAR berichten. Die Therapie besteht im Absetzen der verursachenden NSAR. Ergänzend können zur rascheren Symptomlinderung bzw. zur Beschleunigung der Abheilung eventuell bestehender NSAR-Ulzera PPI verordnet werden. Es ist wichtig zu wissen, dass NSAR nicht nur zu Schäden im oberen Verdauungstrakt, sondern auch zu Entzündungen, Ulzerationen und Stenosen im Bereich von Dünndarm und Dickdarm führen können.</p></p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Behandlung der Sigmadivertikulitis
Die Divertikulitis gehört zu den häufigsten Krankheitsbildern bei akuten Bauchschmerzen. Die Inzidenz nimmt mit dem Alter stark zu und immer mehr jüngere Patienten erkranken an einer ...
Therapie des Morbus Crohn: bewährte Konzepte und neue Strategien
Welche Behandlungsziele haben Ärzt:innen, die Patient:innen mit Morbus Crohn (MC) behandeln, und haben die Betroffenen die gleichen Ziele? Lassen sich die Therapieziele erreichen, wenn ...
Therapie des Morbus Crohn: Biologikabehandlung optimieren
Prof. Dr. med. Iris Dotan, Rabin Medical Center, Petah Tikva, und Universität Tel Aviv (Israel), zeigte im Rahmen des 9. Postgraduate Course des IBDnet Möglichkeiten auf, wie die ...


