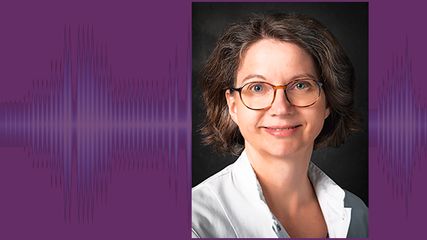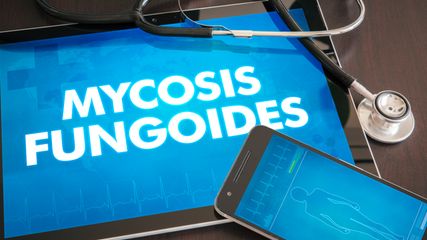©
Getty Images/iStockphoto
Den Blick für chronisch-entzündliche Autoimmunerkrankungen schärfen
Jatros
30
Min. Lesezeit
20.09.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ein Frauenkongress, konzipiert von und für Frauen, gestaltet von deutschsprachigen Referentinnen aus Dermatologie, Rheumatologie und Gastroenterologie: Pfizer veranstaltete zum 3. Mal die i-FemMe, diesmal in Hamburg, und das Feedback war hervorragend. Nicht nur die Wissenschaft, auch das interaktive, soziale Element kam nicht zu kurz, neue Kontakte konnten geknüpft, alte intensiviert werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>„Unter Medizinmännern“</h2> <p>Genderaspekte sind wichtig und sollten nicht in einer männlich dominierten Karrierestruktur untergehen. An der Universitätsklinik Charité in Berlin kümmert sich die zentrale Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Dr. Christine Kurmeyer, um Geschlechtsunterschiede in Lehre und Forschung, aber auch um ganz wesentliche Punkte im Klinikalltag wie Vereinbarkeit von Familie und Job, Kinderferienbetreuung u.Ä. Schriftliche Gleichstellungskonzepte liegen dazu vor und werden regelmäßig monitiert. „Wir machen es den Männern zu einfach“, stimmte Prof. Dr. Tanja Kühbacher, Lehrstuhlinhaberin für Gastroenterologie in Hamburg, Ehefrau und Mutter von 2 Kindern, ein. „Frauen sind, weil sie es müssen, besser organisiert, klüger, strebsamer. Karrierekiller sind Partner, die nicht mitmachen. Oftmals kommt es zu Misskommunikation zwischen Mann und Frau im Spitalswesen. Sie will es verstehen, er fühlt sich kritisiert.“ Kühbacher plädierte für Mentoring für Frauen, um sich mehr zuzutrauen.</p> <h2>Infektion im Fokus</h2> <p>Neue Herausforderungen in der Gastroenterologie sind mehr opportunistische Infekte und paradoxe Inflammationen. Kühbacher erwähnte die Sicherheit von TNF-a-Blockern in der Behandlung und neue Behandlungsoptionen wie das Biologikum Ustekinumab, in Deutschland seit einem Jahr in der Gastroenterologie in der Dosierung 6mg/kg KG zugelassen, sowie den in Kürze oral verfügbaren Januskinasehemmer( JAK)-Hemmer Tofacitinib bei Colitis ulcerosa. Das aus der Rheumatologie bekannte Konzept des „treat to target“ wird nun auch in der Gastroenterologie angewendet. Was fehlt, sind interdisziplinäre Konferenzen zur Entzündung, in welchen Fragen diskutiert werden wie unter anderem: Wann ist der richtige Behandlungszeitpunkt? Wie bekommt man die Patienten rechtzeitig in die Klinik?</p> <h2>Ernährung bei chronischentzündlichen Krankheiten</h2> <p>Über die metabolischen Komorbiditäten und die Inflammation bis zu einem ausgewogenen Lebensstil und genussvoller Ernährung referierte Dr. Anja Waßmann- Otto, Ernährungstherapeutin in Hamburg. Diätische Interventionen können bei Psoriasis protektive und therapeutische Effekte erzielen. Bekanntlich erhöht Adipositas das Risiko für das Auftreten von Psoriasis und rheumatoider Arthritis (RA), beeinflusst die Schwere der Erkrankung negativ, verschlechtert die Therapieresponse, erhöht das Risiko für begleitende kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen. Charakteristische Veränderungen der Adipositas nehmen vermutlich Einfluss auf die Entstehung und den Verlauf der Psoriasis, wobei TNF-a als Bindeglied zwischen Adipositas und Insulinresistenz agiert, so die Referentin. Psoriasispatienten haben ein deutlich erhöhtes Risiko für metabolisches Syndrom im Vergleich zu Nichtpsoriatikern: OR 2,66 (Milicic et al., An Bras Dermatol 2017), zudem ein erhöhtes Risiko für Hyperurikämie (OR: 1,83, p<0,05) und Gicht (OR: 1,37, p=0,04) (Lai et al., Clin Exp Dermatol 2016). Studien belegen weiters, dass die pathologischen metabolischen Veränderungen Einfluss auf die Wirksamkeit der Psoriasistherapien nehmen. Auch ein schlechteres Ansprechen auf die Therapie bei einem BMI >40 ist belegt (Strober et al. 2006). Dass der BMI als Kofaktor die Wirksamkeit von Adalimumab negativ beeinflusst, zeigten Cassandro et al. 2008. Patienten mit chronisch-entzündlichen Erkrankungen sollten ihre Ernährung modifizieren, so die Therapeutin. Alkohol und zuckerreiche Lebensmittel sollten nur in Maßen verzehrt werden. Zu bevorzugen sind pflanzliche Fette mit hohem Gehalt an Omega- 3-Fettsäuren sowie fettreicher Fisch (Wildlachs, Hering, Makrele) und mageres Fleisch. Hochwertige pflanzliche Fette, enthalten in Nüssen, Ölsaaten, Oliven und Avocados, sollten in den Speiseplan integriert werden. Zu meiden sind fruktosehaltige Obstsorten wie Weintrauben, Äpfel, Mangos, Ananas und Bananen. Fruktosearme Fruchtsorten sind Beeren, Marillen, Orangen, Papayas. Es ist sinnvoll, den Anteil an Omega-3-Fettsäuren in der Kost zu erhöhen und den Anteil an Omega-6-Fettsäuren zu reduzieren (kein Schweineschmalz und Suppenhuhn, keine Schweinsleber, kein Eigelb, kein Putenfleisch; besser sind Rindfleisch, Wild, Kaninchen). Die Frage der Nährstoffsubstitution bei Psoriasis und RA ist noch nicht geklärt. Die Vitamin-D3-Substitution bei Psoriasis erscheint vielversprechend, bedarf jedoch weiterer Untersuchungen. Ein vorliegender Vitamin-D3-Mangel ist zu substituieren.</p> <h2>Wandelnde Aliens</h2> <p>Die Rolle des Mikrobioms bei chronisch- entzündlichen Erkrankungen beleuchtete die Rheumatologin Dr. Gabriela Eichbauer-Sturm, Linz. So wurden bei Psoriasis vulgaris, Pemphigus vulgaris und Epidermolysis bullosa acquisita Veränderungen des Hautmikrobioms am gesamten Körper beobachtet. Eine höhere Diversität des Hautmikrobioms schützt. Die bakterielle Besiedelung der Haut unterscheidet sich von der bei Neurodermitispatienten und Gesunden deutlich. Neurodermitis führt zu Veränderungen des gesamten Hautmikrobioms, nicht nur der betroffenen Stellen, so Eichbauer-Sturm. Im Mausmodell wurde die Gabe von Lactobacillus reuteri getestet, und dies führte zu einer geringeren Autoinflammation (He et al., J Exp Med 2016). Die FODMAPDiät, basierend auf der Reduktion von Fruktooligosacchariden, Galaktosacchariden, Monosacchariden, Disacchariden und Polyolen, führte bei 10 Patienten mit Reizdarmsyndrom zu einer Veränderung des Mikrobioms des Darms. Klinisch war eine Verringerung von Bauchschmerzen, Flatulenzen und Diarrhö zu beobachten (Reiner et al., J Gastroenterol Hepatol 2017).</p> <h2>Atopische Dermatitis und ihre Hürden</h2> <p>Prof. Dr. Beatrix Volc-Platzer, Wien, Primaria der Dermatologischen Abteilung im Donauspital – SMZ Ost, referierte über die diffuse Neurodermitis, eine Erkrankung mit großer sozialmedizinischer Bedeutung, die hohen Leidensdruck verursacht. Immerhin ist sie die häufigste chronische Hauterkrankung der westlichen Welt (10–20 % ) und betrifft hauptsächlich Kinder. 10 % der Europäer haben einen heterozygoten Defekt (Carrier) und eine „Loss of function“-Filaggrin-Mutation mit 50 % reduzierter Expression des Proteins, 42 % der Carrier leiden an einer atopischen Dermatitis (AD) (Irvine et al., NEJM 2011). Patienten mit AD weisen ein erhöhtes Risiko für Asthma, Rhinitis allergica, Erdnussallergie und Kontaktallergie auf. Zwei wesentliche Mechanismen tragen zur AD bei: eine defekte Barrierefunktion der Haut und eine Störung der Immunantwort. Durch die defekte Haut von Atopikern dringen mehr Erreger und Allergene als durch die gesunde Haut. Das Immunsystem der Patienten reagiert darauf mit der vermehrten Ausschüttung von Interleukin (IL) 4 und 13. Es kommt zur Inflammation mit starkem Juckreiz, der Patient kratzt sich, wodurch die Haut geschädigt wird und Allergene noch leichter eindringen können. 80–90 % der Patienten weisen eine Staphylococcusaureus- Besiedelung in den Hautläsionen auf und 50 % der Patienten sogar in der nicht läsionalen Haut, so Volc-Platzer.<br /> Die externe Behandlung besteht aus Basis-, aktiver und proaktiver Therapie. Therapeutisch reicht das Armamentarium mittlerweile von topischen Kortikosteroiden, topischen Calcineurininhibitoren, Antihistaminika bis zu systemischen immunmodulierenden Therapien wie dem ersten zielgerichteten Wirkstoff Dupilumab. Dupilumab blockiert die Signalgebung von IL-4 und IL-13 und durchbricht so den Teufelskreis bei der AD. Derzeit in Phase II der klinischen Prüfung befindlich ist der Anti-Interleukin- 31-Rezeptor-A-Antikörper Nemolizumab. Es handelt sich hierbei um eine randomisierte, placebokontrollierte Dosisfindungsstudie mit 264 Patienten, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von Nemolizumab s.c. 0,1mg vs. 0,5mg vs. 2,0mg/kg KG, alle 4 Wochen verabreicht, gegenüber 2,0mg/kg KG alle 8 Wochen untersucht werden. Eine konsequente Basistherapie der AD senkt die Schubfrequenz und steigert die Lebensqualität, aber auch die Patientenschulung sollte als wichtiger Erfolgsfaktor, um die „Adliance“ (Compliance + Adherence) zu erhöhen, nicht außer Acht gelassen werden, so die Expertin zusammenfassend.</p> <h2>Interdisziplinarität zählt</h2> <p>„Inflammatorische Erkrankungen haben viele Facetten. So können zum Beispiel zusätzlich zu einer im Vordergrund stehenden Symptomatik auch andere Erscheinungen aus dem rheumatologischen, dermatologischen, gastroenterologischen oder einem anderen Bereich auftreten. Daher ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf diesem Gebiet so enorm wichtig“, meinte Prim. Dr. Gabriele Eberl, Wien. Denn z.B. sind 10 % der Patienten mit Spondyloarthritiden auch von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa betroffen, 16 % von ihnen leiden an Psoriasis, 30 bis 40 % zusätzlich an einer Uveitis und 30 bis 40 % an einer Enthesitis. „Wir haben auf der i- FemMe daher auch immer eine interdisziplinäre Fallkonferenz, die einen oder mehrere Fälle aus der Sicht der Rheumato-, der Dermato- und der Gastroenterologie beleuchtet. Dies ist besonders wichtig, um den fächerübergreifenden Blick zu schärfen, und wird immer auch besonders gut angenommen.“<br /> „Auch wenn die Tagung von Ärztinnen für Ärztinnen konzipiert ist, kommen die männlichen Kollegen natürlich nicht zu kurz. Sämtliche Vorträge wurden mitgefilmt und stehen interessierten Ärzten online zur Verfügung“, so Kühbacher abschließend.</p> <h2>Starke österreichische Repräsentanz</h2> <p>Abgesehen von den renommierten österreichischen Referentinnen, zu denen auch die Rheumatologin Dr. Maya Thun zählte, die über ihr Lieblingsthema – Medizin und Kunst – sprach, war auch die Zahl der Teilnehmerinnen aus Österreich in Relation zu denjenigen aus Deutschland und der Schweiz beachtlich. Auf die nächste Veranstaltung in zwei Jahren freut sich die Verfasserin.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: i-FemMe, Hamburg 2018, Ärztinnen unter einem D-A-CH,
13.–14. April 2018, Hamburg
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neues vom EADV-Kongress 2025
Welche late-breaking News beim Kongress präsentiert wurden, erörtert Univ.-Prof. Dr. Gudrun Ratzinger, Innsbruck, im Videointerview.
Im Fokus: VEXAS-Syndrom
Es tritt vermutlich viel häufiger auf als bisher angenommen: das autoinflammatorische VEXAS-Syndrom. Die chronisch progressiv verlaufende Erkrankung wird zumeist sehr spät diagnostiziert ...
Kutane Lymphome: zielführende Therapie trotz klinischer Mimikry
Kutane Lymphome treten mit einer Inzidenz von 1:100000 relativ selten auf. Es lohnt sich, sich mit ihnen zu befassen, da sie zum Teil schwer erkennbar, zu einem erheblichen Anteil ...