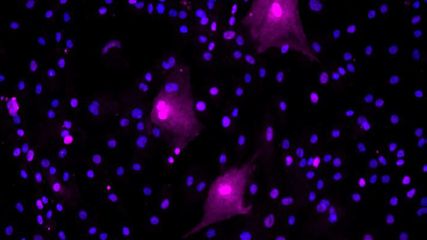©
Getty Images/iStockphoto
Was kommt nach den biologischen DMARDs?
Jatros
Autor:
Prof. Dr. Christoph Fiehn
Praxis für Rheumatologie und klinische Immunologie, Baden-Baden<br>E-Mail: c.fiehn@rheuma-badenbaden.de
30
Min. Lesezeit
16.11.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Mit den JAK-Inhibitoren hat ein neues und offensichtlich sehr effektives Wirkprinzip in die Therapie der rheumatoiden Arthritis Einzug gehalten. Dieses wird nun bei einer Reihe anderer Indikationen rheumatischer Erkrankungen getestet. Die Zukunft wird zeigen, wie groß der Schritt wirklich ist, den wir in der Behandlung von rheumatischen Erkrankungen damit werden machen können. Bislang vorliegende Ergebnisse geben Hoffnung, vor allem denjenigen Patienten, die auf die bisherigen Therapieformen nicht ausreichend angesprochen haben.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Im Jahre 2019 werden zwei Jahrzehnte vergangen sein, seit erstmals biologische DMARDs zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen außerhalb von Studien eingesetzt werden konnten. Biologische DMARDs sind ohne Ausnahme molekularbiologisch hergestellte Proteinmoleküle, die auf unterschiedliche Weise in der Lage sind, Proteinstrukturen zu binden, die auf der Zelloberfläche oder aber in der interzellulären Flüssigkeit vorhanden sind. Deren Bindung durch das Medikament unterbricht einen pathologischen Prozess, welcher die rheumatische Erkrankung unterhält.<br />Biologische DMARDs sind überwiegend monoklonale Antikörper, aber auch Rezeptorkonstrukte wie Etanercept oder Abatacept. Ebenfalls dazu gehören rekombinante Formen natürlicher inhibitorischer Proteine, wie Anakinra. Sie blockieren die Wirkung von löslichen Zytokinen oder membrangebundenen zellulären Aktivierungsstrukturen, oder aber sie führen – im Fall von Rituximab – zur Lyse von Zielzellen. Alle diese Wirkprinzipien greifen gezielt, als sogenannte „targeted therapy“, in zelluläre und humorale Prozesse der Autoimmunität und der Entzündung ein. Dies unterscheidet sie von den konventionellen DMARDs, wie z.B. Methotrexat, deren Wirkung pleiotrop ist und deren Wirkprinzip meist erst sekundär – und auch nur teilweise – verstanden wurde.<br />Die Entwicklung der biologischen DMARDs ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Fast jährlich kommen neue Substanzen mit neuen Zielstrukturen hinzu, wie z.B. im vergangenen Jahr Secukinumab als Antikörper gegen Interleukin 17 (IL-17); oder aber schon länger eingesetzte Substanzen bekommen neue Indikationen, wie z.B. Rituximab bei den ANCA-assoziierten Vaskulitiden oder Adalimumab bei den Uveitiden.</p> <h2>Neue Phase in der Behandlung der rheumatoiden Arthritis</h2> <p>Mit den kürzlich erfolgten Zulassungen von Baricitinib und Tofacitinib zur Behandlung der RA hat inzwischen eine neue Phase begonnen. Die beiden Substanzen gehören zu den Januskinase(JAK)-Inhibitoren und sind Medikamente, die wie die biologischen DMARDs gezielt in pathophysiologische Prozesse eingreifen („targeted therapy“), aber kleine Moleküle sind, welche intrazellulär wirken.<br />Von der Systematik her unterscheiden wir nun die konventionellen synthetischen DMARDs (csDMARDs), wie Methotrexat, Leflunomid, Sulfasalazin u.v.m., die biologischen DMARDs (bDMARDs) und – als neueste Gruppe – die „targeted synthetic DMARDs“ (tsDMARDs), deren erste Vertreter die JAK-Inhibitoren sind.</p> <h2>Tofacitinib</h2> <p>Tofacitinib war der erste JAK-Inhibitor, der bei der RA zum Einsatz kam. Er wurde u.a. in den USA und der Schweiz schon 2012 zur Behandlung der RA zugelassen und von dort liegen bereits umfangreiche Erfahrungen zu Sicherheit und Wirksamkeit vor. Die Zulassung in der EU war damals nicht erfolgt, weil Bedenken bezüglich Auslösung von Tumoren und einer erhöhten Rate von Infektionen, vor allem Herpes zoster, bestanden. Eine aktuelle Langzeitsicherheitsanalyse der klinischen Studien<sup>1</sup> zeigt, dass die Bedenken bezüglich der Auslösung von Tumoren entkräftet worden sind, das Risiko für schwere Infektionen und speziell Herpes zoster jedoch gegenüber Kontrollen auf das 2,7- bzw. 3,9-Fache erhöht ist. In einer Vielzahl von Arbeiten wurde jedoch gezeigt, dass Tofacitinib einen guten und anhaltenden Effekt zur Behandlung der RA hat und sowohl mit als auch ohne eine begleitende Therapie mit Methotrexat gegeben werden kann (Tab. 1).<br />Tofacitinib, seit Ende März 2017 in der EU zur Behandlung der RA zugelassen, konnte schon 2012 in einer Vergleichsstudie zeigen, dass es nach nicht ausreichender Wirkung von csDMARDs in Kombination mit Methotrexat gleichwertig zu Adalimumab die Krankheitsaktivität der RA senken kann.<sup>2</sup> Auch für fortgeschrittene Fälle, nach nicht ausreichender Wirkung von bDMARDs, wurde die gute Wirkung von Tofacitinib auf die RA in einer Metaanalyse gezeigt.<sup>3</sup> Allerdings liegen auch bei dieser Indikation ausreichende Daten nur für die Kombination mit Methotrexat vor.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1706_Weblinks_s68.jpg" alt="" width="2151" height="1286" /></p> <h2>Baricitinib</h2> <p>Der zweite verfügbare JAK-Inhibitor ist Baricitinib, der seit Anfang 2017 in der EU zugelassen ist. Baricitinib ist neuer als Tofacitinib, sodass Langzeiterfahrungen nicht im gleichen Maße vorliegen. 2016 und 2017 sind jedoch mehrere große Studien mit Baricitinib publiziert worden, welche sehr eindrucksvoll zeigen, welches Potenzial in der Behandlung der RA für diese Substanz besteht.<sup>4, 5</sup> Im direkten Vergleich mit Adalimumab bei Patienten mit einer mittleren Krankheitsdauer von zehn Jahren und kontinuierlicher Gabe von Methotrexat zeigte Baricitinib eine signifikant bessere Wirkung auf die Krankheitsaktivität, aber auch auf den Funktionsparameter des Health Assessment Questionnaire (HAQ). Das Risiko für unerwünschte Infektionen, auch das für Herpes zoster, war in dieser Studie unter Baricitinib gegenüber Adalimumab nicht signifikant erhöht.<sup>4</sup><br />Eine andere Studie untersuchte Patienten mit fortgeschrittener RA, welche biologische DMARDs nicht vertragen oder auf diese nicht ausreichend angesprochen hatten.<sup>5</sup> Auch in dieser klinischen Situation zeigte Baricitinib eine gute Wirkung auf die Krankheitsaktivität der RA wie auch auf „patient-reported outcomes“ (PROs), beispielsweise Fatigue oder Lebensqualität.<sup>6</sup></p> <h2>Gemeinsamkeiten und Unterschiede</h2> <p>Die beiden JAK-Inhibitoren sind daher Substanzen, die durch eine sehr gute Wirksamkeit wichtige und wertvolle Impulse in der Behandlung der RA geben können. Beide Medikamente haben für folgende Indikationen die Zulassung bekommen: „Patienten mit mittelschwerer bis schwerer aktiver RA, die auf ein oder mehrere krankheitsmodifizierende antirheumatische Arzneimittel (DMARDs) unzureichend angesprochen oder diese nicht vertragen haben.“<br />Während Baricitinib mit oder ohne Methotrexat als Begleitmedikation gegeben werden kann, ist Tofacitinib primär in Kombination mit Methotrexat zugelassen, das aber im Falle von Unverträglichkeiten gegen Methotrexat oder wenn andere Gründe dagegen sprechen, weggelassen werden kann (Tab. 1).<br />Die beiden Substanzen sind nicht identisch, denn auf biochemischem Niveau unterscheiden sie sich in ihrer hemmenden Wirkung. So ist Baricitinib spezifischer für JAK1 und JAK 2, während Tofacitinib eine stärkere hemmende Wirkung auf JAK3 innehat. Da die verschiedenen JAK-Unterformen unterschiedlich in der Signalübertragung von Zyotokinrezeptoren involviert sind, kann dies potenziell Auswirkungen auf deren Effekt auf die Entzündung und auch die Infektabwehr haben. Ob sich die beiden Substanzen dadurch in ihrer klinischen Wirkung und Sicherheit unterscheiden, lässt sich aus den gegenwärtigen Studien noch nicht klar eruieren. Vor allem das Problem der höheren Rate an Herpes zoster und auch anderer Infektionen sollte weiter sehr genau beobachtet werden. <br />Nachdruck aus „arthritis + rheuma“: Fiehn C: Was kommt nach den biologischen DMARDs? arthritis + rheuma 2017; 37: 124–5. Mit freundlicher Genehmigung des Schattauer Verlages</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Cohen SB et al.: Long-term safety of tofacitinib for the treatment of rheumatoid arthritis up to 8.5 years: integrated analysis of data from the global clinical trials. Ann Rheum Dis 2017; 76(7): 1253-62 <strong>2</strong> Van Vollenhoven RF et al.; ORAL Standard Investigators: Tofacitinib or adalimumab versus placebo in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2012; 367: 508-19 <strong>3</strong> Singh JA et al.: Biologics or tofacitinib for people with rheumatoid arthritis unsuccessfully treated with biologics: a systematic review and network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2017; 3:CD012591 <strong>4</strong> Taylor PC et al.: Baricitinib versus placebo or adalimumab in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2017; 376: 652-62 <strong>5</strong> Genovese MC et al.: Baricitinib in patients with refractory rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2016; 374: 1243-52 <strong>6</strong> Smolen JS et al.: Patient-reported out­comes from a randomised phase III study of baricitinib in patients with rheumatoid arthritis and an inadequate response to biological agents (RA-BEACON). Ann Rheum Dis 2016; 76: 694-700</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...