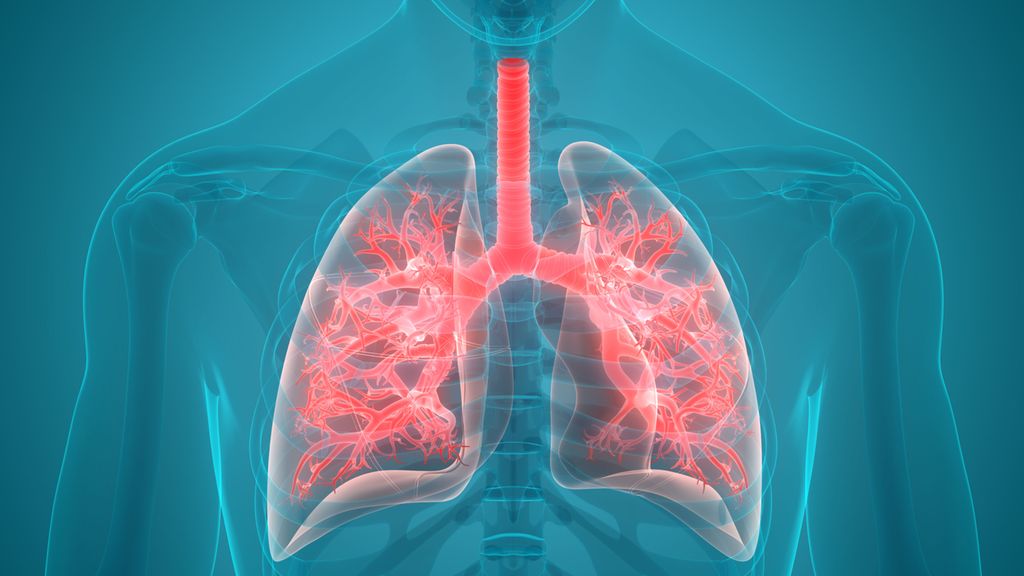
©
Getty Images/iStockphoto
Spezielle Hygienemaßnahmen bei Problemkeimen in Langzeitpflegeeinrichtungen
Jatros
Autor:
OA Dr. Kurt Eigner
Hygienebeauftragter Arzt im Pflegewohnhaus<br> Donaustadt des KAV (bis 31. 1. 2017), 1220 Wien,<br> Langobardenstr. 122a<br> Derzeit interimistischer Ärztlicher Direktor<br> im Pflegewohnhaus Donaustadt mit<br> sozialmedizinischer Betreuung, Zentrum für<br> Lungenerkrankungen und Langzeitbeatmung,<br> Zentrum für Wachkomabetreuung,<br> Alois-Stacher-Haus
30
Min. Lesezeit
15.03.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Am Beispiel der pulmologischen Abteilung des Pflegewohnhauses Donaustadt mit langzeitbeatmeten Patienten sollen die spezielle Problematik der multiresistenten Keime und der Umgang mit „infektiösen“, besser „MRE-Träger“ genannten Patienten gezeigt werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die „Keimerfassung“ im PDO umfasst das Screenen aller neu aufgenommenen/ wieder aufgenommenen Patienten auf Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA), ein erweitertes Screening auf multiresistente Erreger (MRE) bei entsprechenden (Vor-)Befunden bei allen Risikopatienten (seit Beginn 2018) sowie zusätzliche mikrobiologische Probenabnahme bei Infektionsverdacht. Alle „infektiösen“ Patienten (MRE, Hepatitis/HIV, CD) werden monatlich erfasst und laufend evaluiert. Weiters erfolgt eine Infektionserfassung zu einem Stichtag laut Kriterien des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC; zuletzt November 2016). Auch der Antibiotikaeinsatz der bettenstärksten Abteilung wird monatlich erfasst und der Desinfektionsmittelverbrauch (Hand-KISS) aufgezeichnet. In Ergänzung zu den bestehenden Richtlinien des Krankenanstaltenverbundes der Gemeinde Wien (KAV) wird im Pflegewohnhaus Donaustadt (PDO) fallweise auch ein Wasserstoffperoxidvernebler eingesetzt.</p> <h2>Welche Keime sind gemeint?</h2> <p>Es handelt sich vor allem um MRSA, Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) und multiresistente gramnegative Stäbchen mit Resistenz gegen 3 bzw. 4 von 4 Antibiotikagruppen (3/4MRGN; am häufigsten sind dies Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Proteus mirabilis, seltener Acinetobacter baumanii und Morganella morganii).<br /> Exemplarisch sind hier Eckdaten der pulmologischen Abteilung im PDO zu einem Stichtag 2017 angeführt: Von 64 Patienten, von denen 94 % bettlägerig bzw. nur passiv mobilisierbar waren, wurden 86 % mit Cystofix oder DK versorgt. Dabei fanden sich bei 31 Patienten 8x MRSA, 23x 3MRGN, 9x 4MRGN, 0 VRE. Die angeführten Keime waren vor allem im Tracheal-/ Bronchialsekret (17), im Harntrakt (13) sowie in Nasen-/Rachen- und Hautabstrichen nachzuweisen. Somit sind ca. 48 % der betreuten Patienten mit MRE besiedelt (Tab. 1) – zum Vergleich: 19 % an der neurologischen Abteilung des PDO und 6 % in der Langzeitpflege.</p> <h2>Vorgesehene Maßnahmen</h2> <p>Dem MRE-Plan 2017/2018 des KAV zufolge sind bei MRE-Nachweis die folgenden zusätzlichen Maßnahmen durchzuführen:</p> <ul> <li>Informationsweitergabe: Alle involvierten Mitarbeiter müssen informiert werden (z.B. Ambulanzen, andere Fachabteilungen usw.). Die Zieleinrichtungen müssen bereits im Vorhinein informiert werden, um notwendige Maßnahmen treffen zu können. MRE müssen im Entlassungs- und Transferierungsbericht des Patienten bei den Entlassungsdiagnosen angeführt werden.</li> <li>Räumliche Unterbringung: Die Notwendigkeit einer Isolierung ist vom Erreger, Übertragungsweg, von der Patienten-Compliance und vom Risikoprofil der Mitpatienten abhängig.</li> <li>Pflege- und Behandlungsutensilien sind patientenbezogen zu verwenden und bis zur Aufhebung der Isolation im Zimmer zu belassen.</li> <li>Laufende Desinfektionsmaßnahmen: Mindestens 2x täglich ist eine Wischdesinfektion der patientennahen Flächen sowie der Sanitäreinrichtungen vorzunehmen, bei sichtbarer Kontamination hat dies umgehend zu erfolgen, mindestens 1x täglich ist eine Wischdesinfektion des Fußbodens durchzuführen.</li> <li>Schlussdesinfektion: nach Aufhebung der Isolierung sowie nach Entlassung/ Transferierung oder Tod des Patienten.</li> </ul> <p>Außerdem sind Untersuchungsintervalle (inkl. Kontrollkulturen) bis zur Entlassung vorgeschrieben. Bei einer Aufenthaltsdauer von bis zu mehreren Jahren muss in Kenntnis der Unmöglichkeit einer Eradikation insbesondere von 3/4MRGN und VRE im Langzeitpflegebereich (inkl. Neurologie mit Wachkomapatienten, Pulmologie mit Langzeitbeatmeten) eigentlich von Dauerträgern gesprochen werden.<br /><br /> So wird die Aufhebung der strikten Isolierungsmaßnahmen unter speziellen Auflagen die Regel sein, um eine Isolierung bis zum Lebensende zu vermeiden, wobei auf das Streurisiko besonderes Augenmerk gerichtet werden sollte (Versorgung mit IKP, Tracheostomaabdeckung bzw. Mund-/Nasen-Schutz, Händedesinfektion der Betroffenen, …).<br /><br /> Bezüglich MRSA wird entgegen den Richtlinien im Einzelfall doch eine Dekolonisierung durch systemische Antibiotikagabe versucht – insbesondere bei kooperationsunfähigen Patienten (Demenz) und vor geplanten Operationen, Transferierungen in Rehabilitationszentren oder Entlassungen in private Heime, die eine Übernahme bei bekanntem MRE-Trägerstatus verweigern.</p> <h2>Spezielle Herausforderungen</h2> <p>Im Rahmen der vorgesehenen Reinigung und Desinfektion gibt es im Vergleich zu Akutkrankenhäusern einige Problemstellen. Dazu zählt die Oberflächendesinfektion technischer Geräte und Monitore, schwer zugängliche/erreichbare/desinfizierbare Oberflächen wie Anschlüsse, Steckdosen, private Gegenstände (AVGeräte, Bilderrahmen etc.).<br /><br /> Bei laufendem Betrieb sind Reinigung und Desinfektion 2x täglich sehr zeitaufwendig. Eine eventuell gelungene Dekolonisierung kann durch den Verbleib des Patienten gefährdet werden. Bei notwendiger Wiederbelegung, bei Zimmertausch etc. besteht ein Zeitdruck, der gegebenenfalls zu Nachlässigkeit führen kann.<br /><br /> Ohne wissenschaftlichen Beweis, dass eine Rekontamination durch die obgenannten Gegenstände passieren kann, haben wir den Eindruck, dass speziell bei MRSADekolonisierung trotz (bemühter) Endreinigung im laufenden Betrieb oft schon nach einem Monat MRSA am gleichen Patienten wieder auftritt. Weiters haben wir an Touchscreenmonitoren schon MRSA gefunden, obwohl 2x pro Tag wischdesinfiziert wurde.<br /><br /> Es ist außerdem bekannt, dass VRE trotz gründlicher Endreinigung offenbar auf Nachfolgepatienten übertragen wurde.<br /><br /> Im Einzelfall erfolgt im PDO deshalb als Versuch zur Ergänzung und Unterstützung der Desinfektionsleistung der Einsatz der sogenannten Nocolyse<sup>®</sup> mit Nocospray<sup>®</sup> (Tab. 2). Das Ziel ist die Ermöglichung einer raschen Wiederbelegung des Zimmers nach Endreinigung wegen MRSA, VRE, MRGN oder nach gelungener MRSA-Dekolonisierung, da im laufenden Betrieb bei bestehender Zimmereinrichtung (Privatgeräte, Problemstellen) eine länger dauernde intensive Endreinigung kaum möglich ist.<br /><br /> Zum Nachweis der Wirksamkeit gibt es nur wenige Studien bzw. einzelne Erfahrungen der Hygieneteams des DSP/PDO. Der Nachweis der H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Konzentration erfolgt derzeit nur durch Indikatorstreifchen mittels Farbumschlag. Die maximale Arbeitsplatzkonzentration (MAK-Wert) von Wasserstoffperoxid darf in Österreich 2ppm oder 2,8mg/m<sup>3</sup> innerhalb von 15 Minuten (Kurzzeitwert, MAK-KZW) bzw. 1ppm oder 1,4 mg/m<sup>3</sup> im Tagesmittel gemessen über 8 Stunden (MAK-TMW) nicht überschreiten.<br /> Problematisch aus unserer Sicht ist, dass eine H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Konzentrationsmessung von außen derzeit nicht möglich ist (vor dem Betreten des Raumes zur Lüftungsherstellung). Auch der Arbeitsschutz (wer darf wann was und wie?) ist fraglich. Das Verfahren ist auch personal- und zeitaufwendig und es bedarf bei laufendem Betrieb guter Planung. Obwohl diesbezügliche Untersuchungen laufen, fehlt letztendlich noch der Nachweis, dass nosokomiale Infektionen reduziert werden.</p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Ziel des standardisierten Umgangs mit Problemkeimen ist die Verhinderung von nosokomialen Infektionen bzw. von Keimübertragung. Dies gelingt einerseits durch die Einhaltung der Standardhygienemaßnahmen und der erweiterten Maßnahmen eines MRE-Hygieneplans, andererseits durch sinnvoll modifizierte Richtlinien, die das Streurisiko und die Lebensqualität (Stichworte „Isolierung“ und „Kontrollintervalle“) berücksichtigen. Darüber hinausgehende Maßnahmen wie systemische Antibiotikatherapie und Raumdesinfektion (Nocolyse<sup>®</sup>) sind im Einzelfall eine sinnvolle Ergänzung.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Jatros_Pneumo_1801_Weblinks_s33_tab1_2.jpg" alt="" width="1417" height="1763" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


