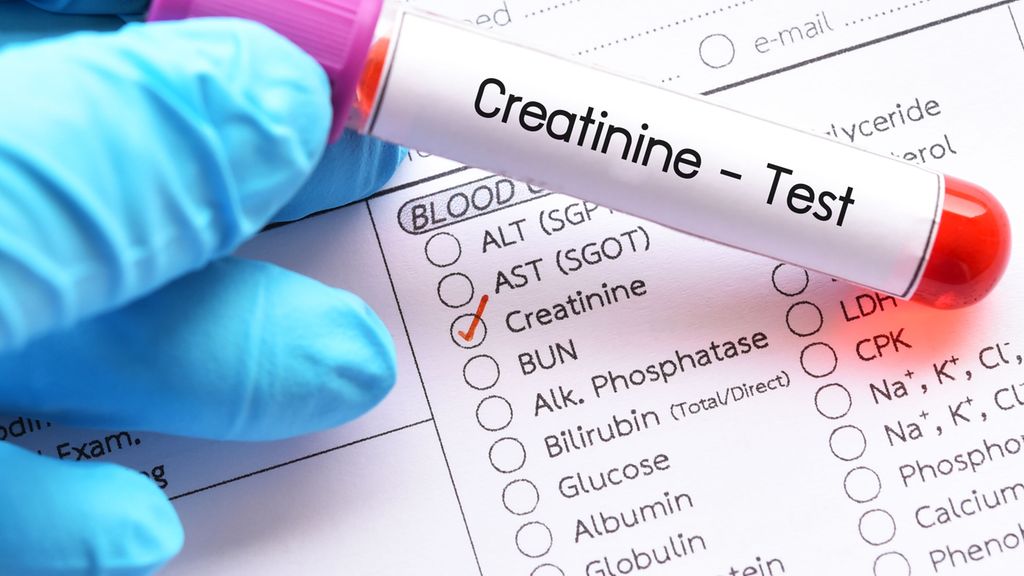
©
Getty Images/iStockphoto
Neues vom Knochen- und Mineralstoffwechsel bei chronischer Niereninsuffizienz
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
21.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der Knochen- und Mineralstoffwechsel bei chronischer Niereninsuffizienz ist komplex. Am Nephro Update Europe in Wien berichtete Prof. Dr. med. Adrian Covic aus Rumänien, was man für die Praxis wissen muss und welche neuen Therapieansätze es in Zukunft geben könnte.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>FGF-23 sei zurzeit einer der «grössten Feinde» der Nephrologen, führte Prof. Dr. med. Adrian Covic, Direktor der nephrologischen Klinik und des Zentrums für Dialyse und Transplantationen in Iasi (Rumänien), in das Thema ein. «Hohe Level von FGF-23 sind assoziiert mit einer erhöhten Mortalität bei chronischer Niereninsuffizienz,<sup>1</sup> aber wir haben die Mechanismen noch nicht genau verstanden», so Covic.<br /> Fibroblastenwachstumsfaktor («fibroblast growth factor») FGF-23 ist ein Hormon, das von den Osteoblasten sezerniert wird und bei der Regulation des Phosphatund Vitamin-D-Stoffwechsels eine wichtige Rolle spielt.</p> <h2>Erhöhte FGF-23-Spiegel mit höherer Mortalität assoziiert</h2> <p>Bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz (CKD) hält der Körper die normalen Serum-Phosphatspiegel konstant, obwohl die Zahl der Nephrone abnimmt. Zum Teil gelingt ihm dies durch die stetige Erhöhung des FGF-23-Spiegels, was die übrig gebliebenen Nephrone anregt, mehr Phosphat auszuscheiden. Ausserdem bremst FGF-23 die Absorption von Phosphat aus dem Darm, indem es die Synthese von 1-25-Dihydroxyvitamin D hemmt.<sup>2</sup> Erhöhte FGF-23-Spiegel scheinen bei Patienten, die mit der Hämodialyse beginnen, unabhängig mit einer erhöhten Mortalität assoziiert zu sein.<sup>1</sup> Im Vergleich zu normalen Phosphatwerten (3,5–4,5mg/ dl resp. 1,1–1,4mmol/l) gingen Spiegel >5,5mg/dl (1,8mmol/l) mit einer um 20 % erhöhten Mortalität einher. Hohe Spiegel von PTH, 1,25-Dihydroxyvitamin D, Phosphat und Kalzium stimulieren die FGF-23-Produktion. «Das erklärt aber nicht allein den Anstieg von FGF-23 in einem frühen Stadium der Niereninsuffizienz », sagte Prof. Covic.<br /> Dies könnte durch die zugrunde liegende Entzündung und durch den Eisenmangel bei CKD vermittelt werden, was zu einem Anstieg von FGF-23 führt. Normalerweise wird in dieser Situation gleichzeitig der Abbau von FGF-23 in den Osteozyten hochreguliert, um den Spiegel an zirkulierendem FGF-23 konstant zu halten. Bei CKD-Patienten scheint der Abbau von FGF-23 in den Osteozyten aber gestört zu sein, was zu den erhöhten FGF-23-Spiegeln beitragen könnte.<sup>3</sup> Eine Entzündung – erkennbar an erhöhten Konzentrationen von IL-6 und CRP – und zu viel FGF-23 stellen unabhängige Risikofaktoren für eine erhöhte Mortalität bei CKD dar, so fassten es Forscher aus den USA kürzlich zusammen.<sup>4</sup> «Wir haben Hinweise darauf, dass FGF-23 direkte pathologische Effekte auf Herz und Gefässe ausübt», kommentierte Dr. med. Daniel Zickler, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie an der Charité in Berlin. «Die Wirkungen von FGF-23 sind aber komplex. FGF-23 ist zwar grundsätzlich der ‹bad guy›, aber eine komplette FGF-23-Antagonisierung führte im Tiermodell zu verstärkter Gefässverkalkung.»<sup>5</sup> FGF-23 sei ein interessantes therapeutisches Ziel bei CKD und werde derzeit evaluiert. Welche Bedeutung es in der Klinik haben könnte, lasse sich aber aktuell noch nicht abschätzen.</p> <h2>Alpha-Klotho als neues therapeutisches Ziel</h2> <p>Manche Forscher versprechen sich viel von alpha-Klotho als therapeutisches Ziel. Alpha-Klotho wird zu einem hohen Masse in den Nieren exprimiert und fungiert als Korezeptor von FGF-Rezeptoren, um den FGF-23-Signalweg zu aktivieren. Die extrazelluläre Domäne von transmembranösem Klotho wird durch Enzyme gespalten und gelangt als lösliches Klotho in die Zirkulation. Lösliches Klotho übt diverse biologische Funktionen aus, unter anderem wirkt es antifibrotisch und antioxidativ. Bei CKD herrscht ein Mangel an Klotho, was sich negativ auf das Herz-Kreislauf- System auswirken kann. So lassen sich im Tiermodell bei Mäusen mit CKD geringere Konzentrationen von löslichem Klotho nachweisen, was zu einer linksventrikulären Hypertrophie und Fibrose führt. Durch die i.v. Gabe eines für lösliches Klotho kodierenden Gens konnte die kardiale Hypertrophie bei den Klotho-defizienten Mäusen verbessert werden.<sup>6</sup> Dies weist darauf hin, dass die niedrigen Klotho-Spiegel bei CKD eine wichtige Ursache der urämischen Kardiomyopathie sein könnten – unabhängig von FGF-23 und Phosphat. «Die Erkenntnisse über Klotho könnten zu neuen therapeutischen Ansätzen führen», so Covic. So konnte gezeigt werden, dass die Verabreichung von rekombinantem Klotho das Fortschreiten einer akuten zu einer chronischen Niereninsuffizienz und das kardiale Remodeling verhinderte.<sup>7</sup> Zickler findet die Studien zwar interessant, warnt aber vor übertriebener Euphorie. «Studien bei Menschen gibt es hierzu aber noch keine und der klinische Einsatz von Klotho beim Menschen ist daher nicht absehbar.»</p> <h2>Vitamin-D-Substitution beeinflusst Outcome nicht</h2> <p>«Mit fortschreitender Niereninsuffizienz sinken die Vitamin-D-Spiegel ab, daher wird die Supplementation von Ergocalciferol empfohlen», sagte Dr. Zickler. «Aber auch wenn wir mit der Supplementierung den Kalzium-Phosphat-Haushalt in Balance bringen und die Parathormonspiegel senken können, haben wir bisher keinen Vorteil im Hinblick auf Morbidität und Mortalität gesehen.» Die aktuellen KDIGO-Leitlinien<sup>8</sup> empfehlen den routinemässigen Einsatz von Calcitriol oder Vitamin-D-Analoga bei chronischer Niereninsuffizienz im Stadium G3a bis G5 daher nicht mehr. Die KDIGO-Arbeitsgruppe erreichte diesbezüglich allerdings keinen Konsens. Eine Therapie mit Calcitriol oder Vitamin-D-Analoga ist in Erwägung zu ziehen bei Patienten mit progressivem und schwerem sekundärem Hyperparathyreoidismus.<sup>9</sup> Wegen möglicher Nebenwirkungen sollte man – unabhängig von der PTH-Konzentration – mit einer geringen Dosis beginnen und je nach PTH-Antwort auftitrieren. Eine Hyperkalzämie sollte vermieden werden. Bei Dialysepatienten hält sich die neue Leitlinie bedeckt, weil es keine neuen Studien gibt, die einen klaren Benefit gezeigt hätten.<br /> Eine Alternative könnten Kalzimimetika wie Cinacalcet (Mimpara<sup>®</sup> und Generika) oder das neue Etelcalcetid (Parsabiv<sup>®</sup>) sein, so Covic. Etelcalcetid ist ein synthetisches Peptid, welches den kalziumsensitiven Rezeptor in der Nebenschilddrüse aktiviert. In zwei parallelen randomisierten Studien senkte Etelcalcetid bei 1023 Hämodialysepatienten mit mildem bis schwerem sekundärem Hyperparathyreoidismus nach 26 Wochen die PTH-Spiegel deutlich mehr als Placebo.<sup>10</sup> In einer anderen Studie mit 683 Patienten war Etelcalcetid Cinacalcet in Bezug auf die Reduktion der PTH-Werte nicht unterlegen; es erfüllte sogar die statistischen Kriterien für Überlegenheit.<sup>11</sup>, «Wir haben mit Etelcalcetid ein neues Medikament, das mindestens genauso effizient ist wie Cinacalcet oder sogar besser», kommentierte Covic. «Das gastrointestinale Nebenwirkungsprofil ist aber ähnlich wie bei Cinacalcet, und wir haben noch keine Daten zu harten Endpunkten.»<br /> Kurz ging Covic auch auf die neuen Phosphatbinder ein. «Studien haben gezeigt, dass sie den Phosphatspiegel effektiv senken. Es gibt aber noch keine Belege dafür, dass durch die Phosphatreduktion das Überleben verlängert wird. Darauf haben wir nur indirekte Hinweise, wie zum Beispiel die Assoziation von Hyperphosphatämie mit erhöhter Mortalität», sagte Covic. «Die neuen Phosphatbinder haben eine Reihe von Vorteilen, die Auswahl muss aber weiterhin für jeden Patienten individuell getroffen werden, unter Berücksichtigung von Begleiterkrankungen, individuellen Nebenwirkungen, aber auch der Compliance », so das Fazit von Zickler.</p> <div id="fazit"> <h2>Fazit</h2> Der Kalzium-Phosphat-Haushalt bei Patienten mit CKD ist komplex. «Vor jeder Behandlung sollte man Kalzium, Phosphat, Parathormon und gegebenenfalls auch Vitamin D bestimmen. Und es kann nicht schaden, immer mal wieder in die aktuellen KDIGO-Leitlinien zu schauen», resümierte Zickler.</div></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Nephro Update Europe, 6.–7. Oktober 2017, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Gutiérrez OM et al.: Fibroblast growth factor 23 and mortality among patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med 2008; 359: 584-92 <strong>2</strong> Gutiérrez O et al.: Fibroblast growth factor-23 mitigates hyperphosphatemia but accentuates calcitriol deficiency in chronic kidney disease. J Am Soc Nephrol 2005; 16: 2205-15 <strong>3</strong> David V et al.: Inflammation and functional iron deficiency regulate fibroblast growth factor 23 production. Kidney Int 2016; 89: 135-46 <strong>4</strong> Munoz Mendoza J et al.: Inflammation and elevated levels of fibroblast growth factor 23 are independent risk factors for death in chronic kidney disease. Kidney Int 2017; 91: 711-9 <strong>5</strong> Razzaque MS et al.: Hypervitaminosis D and premature aging: lessons learned from Fgf23 and Klotho mutant mice. Trends Mol Med 2006; 12: 298-305 <strong>6</strong> Xie J et al.: Soluble klotho protects against uremic cardiomyopathy independently of fibroblast growth factor 23 and phosphate. J Am Soc Nephrol 2015; 26: 1150-60 <strong>7</strong> Hu MC et al.: Recombinant a-klotho may be prophylactic and therapeutic for acute to chronic kidney disease progression and uremic cardiomyopathy. Kidney Int 2017; 91: 1104-14 <strong>8</strong> KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD). Kidney Int Suppl 2017; 7: 1-59 <strong>9</strong> Ketteler M et al.: Executive summary of the 2017 KDIGO Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder (CKDMBD) Guideline Update: what´s changed and why it matters. Kidney Int 2017; 92: 26-36 <strong>10</strong> Block GA et al.: Effect of etelcalcetide vs placebo on serum parathyroid hormone in patients receiving hemodialysis with secondary hyperparathyroidism: two randomized clinical trials. JAMA 2017; 317: 146-55 <strong>11</strong> Block GA et al.: Effect of etelcalcetide vs cinacalcet on serum parathyroid hormone in patients receiving hemodialysis with secondary hyperparathyroidism: a randomized clinical trial. JAMA 2017; 317: 156-64</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Klassifikation soll für mehr Klarheit sorgen
Die Glomerulonephritis ist eine komplizierte Angelegenheit. Das liegt auch daran, dass die immunvermittelten Erkrankungen anhand von histopathologischen Mustern beschrieben werden, die ...
Einblicke in die aktuelle Forschung
Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen gaben an ihrem Jahreskongress 2024 in Basel spannende Einblicke in ihre aktuelle Forschung. Wir stellen Ihnen hier einige dieser Arbeiten vor.
Spannende Fälle
Neben ihren Forschungsergebnissen stellten Schweizer Nephrologinnen und Nephrologen am Jahreskongress 2024 in Basel auch einige spannende und lehrreiche Fälle vor. Wir präsentieren Ihnen ...


