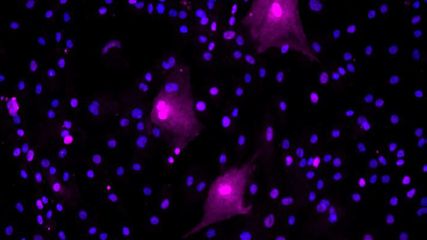©
Getty Images/iStockphoto
Möglichst rasche Basistherapie, neue Medikamente gezielt einsetzen
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
02.03.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Vor Kurzem ist in Deutschland eine neue S2e-Leitlinie zur Gichtarthritis herausgekommen. LEADING OPINIONS Orthopädie & Rheumatologie sprach mit Dr. med. Andreas Krebs vom UniversitätsSpital Zürich über die wichtigsten Empfehlungen. Seine Tipps für die Praxis: Früh Allopurinol einsetzen, einschleichend und individuell dosieren, bei Unverträglichkeit oder Nebenwirkungen Febuxostat wählen und vor allem: den Patienten gut aufklären, um die Therapieadhärenz zu gewährleisten.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p><strong>Die deutsche Gesellschaft für Rheumatologie hat kürzlich eine neue S2e-Leitlinie zur Gichtarthritis herausgegeben.<sup>1</sup> Was sind für Sie die wichtigsten Neuerungen?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Ich sehe vier: Erstens eine harnsäuresenkende Basistherapie möglichst früh verschreiben. Zweitens Allopurinol einschleichend dosieren und langsam steigern. Drittens Allopurinol individuell dosieren. Viertens: Febuxostat ist eine gute Alternative.</p> <p><strong>In welchen Fällen sollte man früh therapieren?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> In der Leitlinie heisst es: «Eine Indikation liegt dann vor, wenn mindestens ein sicherer Gichtanfall aufgetreten ist oder bereits eine chronische Arthritis vorliegt. Harnsäureablagerungen in Form von Tophi sowie eine Nierensteinanamnese sollten ebenfalls zur Einleitung einer harnsäuresenkenden Therapie führen.» Sie wird auch dann empfohlen, wenn der Patient schon einmal Gichtanfälle hatte und eine Hyperurikämie bei eingeschränkter Nierenfunktion vorliegt (ab eGFR <90ml/ min/1,73m<sup>2</sup>). Die aktuell überarbeitete, bisher noch nicht in der Langversion publizierte EULAR-Leitlinie empfiehlt eine harnsäuresenkende Therapie bereits nach dem ersten gesicherten Gichtanfall.<sup>2</sup></p> <p><strong>Warum empfehlen die Kollegen eine frühe Therapie?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Vermutlich weil die Wahrscheinlichkeit gross ist, dass es nicht bei dem einen Anfall bleiben wird. Umgekehrt gibt es aber manchmal auch Patienten, die nur einen Anfall oder alle paar Jahre einen einzelnen haben. Bei diesen scheint es mir vertretbar zu sein, zu warten. So empfiehlt auch das ACR eine harnsäuresenkende Behandlung erst ab dem zweiten oder dritten Anfall. Wenn aber jemand eine Niereninsuffizienz hat, beginne ich nach dem ersten Anfall mit der Therapie. Denn es gibt Hinweise darauf, dass man damit die Progression aufhalten kann.</p> <p><strong>Warum sollte man Allopurinol einschleichend dosieren?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Weil mit einschleichender Dosierung die gefürchteten Allopurinol- Nebenwirkungen seltener auftreten. Das Einschleichen entspricht auch dem neuen Konzept von «treat to target». Das bedeutet, dass das Therapieziel bei der Behandlung der Gicht die stabile klinische Remission ist, die als Freiheit von Gichtanfällen und der Rückbildung von Tophi definiert ist.</p> <p><strong>Was bedeutet individuelles Vorgehen?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Man dosiert individuell, bis die Harnsäure zuverlässig im Zielbereich liegt, also sicher unter 360μmol/l, beim Vorliegen von Tophi unter 300μmol/l. Man fängt bei normaler Nierenfunktion in der Regel mit 100mg Allopurinol täglich an und steigert alle 2–4 Wochen um 100mg.</p> <p><strong>Wie oft sollte man den Zielwert kontrollieren?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Anfangs etwa monatlich und – wenn man den Zielwert der Harnsäure erreicht hat – halbjährlich. Gegebenenfalls muss man die harnsäuresenkende Medikation erhöhen, um den Therapieerfolg sicherzustellen.</p> <p><strong>Welchen Stellenwert haben die neueren Medikamente?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Febuxostat ist eine gute Alternative zu Allopurinol, wenn ein Patient es nicht verträgt oder wenn er eine Niereninsuffizienz hat. Wir fürchten als Nebenwirkung vor allem das Allopurinol- Hypersensitivitätssyndrom und das Stevens-Johnson-Syndrom, die zwar selten sind, aber mit einer hohen Letalität einhergehen. Sie treten häufiger bei Niereninsuffizienz auf, deshalb muss man, wenn sie eintreten, unbedingt die Anfangsdosis reduzieren, je nach Nierenfunktion. Bei Febuxostat muss man bei leichter bis mittelschwerer Beeinträchtigung der Nierenfunktion, also einer Kreatinin- Clearance von 30–80ml/min, die Dosis nicht anpassen.</p> <p><strong>Patienten mit Gicht haben oft andere Krankheiten, die den Einsatz von NSAR, Colchicin oder Glukokortikoiden im akuten Anfall einschränken. Welche Alternativen gibt es?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Hier kommen Interleukin- 1-Antagonisten in Frage, ebenso wenn man die Anfälle mit den üblichen Medikamenten nicht unter Kontrolle bringen kann. Gemäss Leitlinie sollte man bei Patienten mit rezidivierenden Gichtanfällen – also drei oder mehr pro Jahr –, bei denen die Vortherapie mit Colchicin, NSAR oder Glukokortikoiden nicht ausreichend wirksam war, bzw. bei Kontraindikationen gegen diese Substanzen den Interleukin-1-Antagonisten Canakinumab einsetzen. Interleukin-1-Antagonisten sind allerdings in der Schweiz weder offiziell für diese Indikation zugelassen noch werden sie von den Kassen vergütet.</p> <p><strong>Was gibt es Neues im Bereich Harnsäuresenkung?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Ein relativ neues Reservemedikament ist Pegloticase, ein Urolytikum. Es kann bei Patienten eingesetzt werden, die auf eine Behandlung mit der Höchstdosis von Xanthinoxidasehemmern nicht angesprochen haben oder bei denen diese kontraindiziert sind und die einen schweren Verlauf mit Bildung von Gichtknoten und erosiven Gelenkveränderungen aufweisen. Pegloticase kann unter anderem bei tophöser Gicht rasch zur Reduktion und Auflösung der Tophi führen und verbessert die Lebensqualität.<sup>3–5</sup> Aber auch Pegloticase ist nicht offiziell zur Gichtbehandlung zugelassen.</p> <p><strong>Was unterscheidet die deutsche Leitlinie von anderen?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> In fast allen Punkten stimmen die deutschen Leitlinien mit den Guidelines des American College of Rheumatology (ACR) und den EULAREmpfehlungen überein. Einzig bei der Empfehlung, bereits beim ersten Gichtschub eine Basistherapie zu beginnen, gibt es eine Differenz: Das ACR empfiehlt das erst beim dritten Schub, ausser bei Niereninsuffizienz.</p> <p><strong>In einer Pressemeldung vom Deutschen Ärzteblatt<sup>6</sup> heisst es, die neue Leitlinie richte sich nicht nur an Ärzte, sondern auch an nicht ärztliche Berufsgruppen, Patienten und Angehörige. Kann man die Leitlinie Patienten einfach so empfehlen?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Ich denke, einigermassen gebildete und interessierte Laien können die Leitlinie auch verstehen. Allerdings ist sie sehr umfangreich und ausführlich. Für die meisten Patienten eignet sich eine einfachere, kurze Informationsbroschüre besser. Es gibt zum Beispiel eine von der Rheumaliga Schweiz.</p> <p><strong>Werden Sie sich auch in der Schweiz nach der neuen Leitlinie richten?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Hierzulande haben wir ja kein so enges «Leitlinien-Konzept» wie in Deutschland. Wir richten uns neben der deutschen Leitlinie auch nach den Behandlungsempfehlungen des ACR<sup>7</sup> und der EULAR<sup>2</sup>.</p> <p><strong>Was sind besondere Herausforderungen in der Therapie?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Patienten mit einer Niereninsuffizienz, die ja häufig an einer Hyperurikämie leiden. Hier ist eine harnsäuresenkende Behandlung besonders wichtig, weil es Hinweise darauf gibt, dass die Nierenfunktion damit erhalten werden kann. Umgekehrt müssen die Medikamente besonders vorsichtig dosiert werden.</p> <p><strong>Warum haben Gichtpatienten oft eine mangelnde Therapieadhärenz?</strong><br /> <strong>A. Krebs:</strong> Die Medikamentenadhärenz ist bei vielen chronischen Krankheiten ein Problem, vor allem wenn die Betroffenen nicht täglich Beschwerden haben, die sie an die Krankheit erinnern. Ein wichtiges Element zur Verbesserung der Compliance ist sicher eine gute Information der Patienten durch die behandelnden Ärzte. Und die können natürlich nur gut erklären, wenn sie selbst gut ausgebildet sind. Wichtig ist auch, dass man dem Patienten immer wieder erklärt, wie essenziell die nicht medikamentösen Massnahmen sind: Gewichtsreduktion, Reduktion des Konsums von fruktosehaltigen und alkoholischen Getränken, Fleisch und Schalentieren und natürlich die Behandlung von Komorbiditäten wie Hypertonie und metabolischem Syndrom.</p> <p><strong>Vielen Dank für das Gespräch!</strong></p> <p><strong><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1701_Weblinks_lo_ortho_1701_s64_abb1+2.jpg" alt="" width="1455" height="565" /></strong></p> <p><strong><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1701_Weblinks_lo_ortho_1701_s65_abb3a+b.jpg" alt="" width="1468" height="753" /></strong></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Kiltz U et al: S2e-Leitlinie Gichtarthritis; AWMF-Leitlinien Register Nummer: 060/005 <strong>2</strong> Richette P et al: Ann Rheum Dis 2017; 76: 29-42 <strong>3</strong> Anderson A, Singh JA: Cochrane Database Syst Rev 2010(3); CD008335 <strong>4</strong> Sriranganathan MK et al: J Rheumatol Suppl 2014; 92: 63-9 <strong>5</strong> Strand V et al: J Rheumatol 2012; 39: 1450-7 <strong>6</strong> http://www.aerzteblatt.de/ nachrichten/70163 <strong>7</strong> Khanna D et al: Arthritis Care Res (Hoboken) 2012; 10: 1431-46, 1447-61</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...