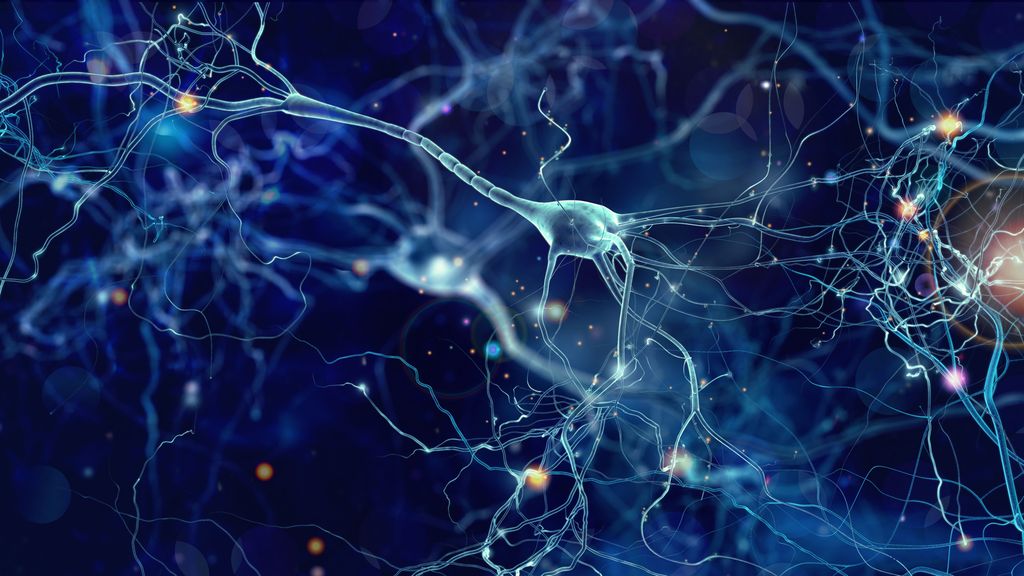
©
Getty Images/iStockphoto
Hereditäre Polyneuropathien
Jatros
Autor:
Univ.-Doz. Dr. Michaela Auer-Grumbach
Univ.-Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie<br> Medizinische Universität Wien<br> E-Mail: michaela.auer-grumbach@meduniwien.ac.at
30
Min. Lesezeit
21.05.2020
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Hereditäre Polyneuropathien wurden bereits Ende des 19. Jahrhunderts erstmals beschrieben. Die Nervenärzte Charcot und Marie in Frankreich und Tooth in England erkannten die familiäre Häufung eines meist symmetrischen distalen Muskelschwunds und der daraus resultierenden Muskelschwäche in den Unterschenkeln und Füßen, verbunden mit einer erheblichen Fußdeformierung und Gangstörung sowie einer Atrophie und Schwäche der kleinen Handmuskeln. Nach diesen Erstbeschreibern wird die Erkrankung bis heute als Charcot-Marie-Tooth (CMT)-Syndrom bezeichnet.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Klinik</h2> <p>Der Krankheitsbeginn ist in jedem Lebensalter möglich, liegt jedoch meistens in der Kindheit oder im Jugendalter. Der klassische CMT-Patient klagt in erster Linie über eine Schwäche der Fuß- und Zehenheber. Der Schuhkauf ist erschwert durch den oft ausgeprägt hohen Rist mit Hohlfuß und gelegentlich auch Hammerzehenbildung (Abb. 1A). Durch die zusätzliche Schwäche der Peronealmuskulatur kommt es oft zum Überknöcheln und auch zu gelegentlichen Stürzen mit Verletzungen.<br /> Bei fortgeschrittener Parese zeigt sich das typische Bild des Steppergangs. Im Krankheitsverlauf tritt häufig auch eine Muskelschwäche in den Händen auf. Die Patienten klagen über feinmotorische Probleme. Gelegentlich werden diese auch durch einen essenziellen Tremor weiter verstärkt. Je nach genetischer Ursache finden sich zusätzlich distale sensible Störungen, die meistens die Oberflächensensibilität betreffen. Bei einzelnen genetischen Formen ist aber auch durch ein reduziertes Schmerzempfinden die Verletzungsgefahr erhöht, Wunden heilen verzögert oder auch gar nicht ab und es bilden sich tiefe Fußulzera. Bei anderen CMT-Patienten können wiederum starke neuropathische Schmerzen vorherrschen. Auch andere Zusatzsymptome wie z. B. Heiserkeit durch Stimmbandlähmung, Hypakusis, Sehstörungen u. a. kommen bei seltenen Genotypen vor.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Neuro_2002_Weblinks_jat_neuro_2002_s6_abb1_auer-grumbach.jpg" alt="" width="250" height="431" /></p> <h2>Elektrophysiologische Klassifikation</h2> <p>Die zugrunde liegende Pathologie der peripheren Nerven wurde einige Jahrzehnte nach der Erstbeschreibung durch histologische Untersuchungen belegt. Bereits damals erkannte man, dass manche Formen der hereditären motorisch-sensiblen Neuropathien (HMSN) überwiegend durch eine Schädigung der Myelinscheide (= CMT1/HMSN Typ 1, demyelinisierende Form) bzw. andererseits durch primär axonale Schädigung (= CMT2/HMSN Typ 2, axonale Form) erklärt werden können. In den 1970er- bis 1980er-Jahren wurden diese Störungen der peripheren Nerven dann auch durch elektroneurografische Untersuchungen bestätigt. Die demyelinisierende Form (CMT1) geht mit einer erheblichen Verlangsamung der peripheren Nerven einher (<38 m/s), bei axonalen Formen (CMT2) zeigt sich eine Verminderung der Amplituden der motorischen Nerven, bei noch normaler oder nur wenig veränderter Nervenleitgeschwindigkeit (>38 m/s). Als Referenznerv für die Unterteilung in die CMT1 und CMT2 wird der motorische N. medianus bzw. N. ulnaris herangezogen. Bei der HMSN sind auch die sensiblen Nerven entsprechend verändert. In der Elektromyografie (EMG) finden sich chronisch neurogene Veränderungen. Rege Spontanaktivität gibt Hinweise auf eine progressive Verlaufsform, wie sie v. a. bei den spät beginnenden Formen häufig vorkommt. Bei Patienten mit HINT1-Mutationen sind repetitive Entladungen häufig. Auf Befragung geben diese Patienten auch oft Muskelkrämpfe bzw eine Myotonie in den Händen an.</p> <h2>Genetik</h2> <p>Nach der Erstbeschreibung der Erkrankung wurde bald klar, dass – trotz des gleichen oder ähnlichen klinischen Erscheinungsbilds – wohl unterschiedliche genetische Ursachen maßgebend sind. Dies bestätigte sich dann auch im Laufe der 1980er- und 1990er-Jahre, in denen genetische Untersuchungen die zugrunde liegenden Mutationen mehr und mehr aufdeckten. Für die klinisch gut abgrenzbare und deutlich häufigere CMT1 konnten erstmals die genetischen Ursachen entschlüsselt werden. Dominante Mutationen in den wichtigen, vorwiegend in Schwann-Zellen exprimierten Myelingenen des peripheren Nervensystems PO/MPZ („myelin protein zero gene“) und PMP22 („peripheral myelin protein 22 gene“) erwiesen sich neben dem GJB1 („gap junction beta-1-gene“) als die führenden Gene bei hereditären Neuropathien. Die genetische Aufklärung der primär axonalen Formen gestaltete sich jedoch schwieriger, nicht zuletzt aufgrund der sehr unterschiedlichen, komplexen Wirkungsmechanismen in den Nervenzellen, in denen Fehlfunktionen zum Krankheitsbild führen. Als Hauptgen gilt hier v. a. MFN2 („mitofusin 2 gene“) bei den dominanten Formen. Überraschenderweise wurden im Laufe der letzten 30 Jahre immer mehr Gene identifiziert, die in der Pathogenese der hereditären Polyneuropathien eine Rolle spielen. So sind bis heute Mutationen in mehr als 80 Genen bekannt, die entweder in heterozygoter Form bereits krankheitskausal sind oder aber bei autosomal rezessiver bzw. x-gebundener Vererbung zur CMT-Erkrankung führen. Auch in Österreich, wo man von ca. 4000 CMT-Patienten ausgeht, sind in bereits mehr als 40 Genen Mutationen als Ursache für die CMT-Erkrankung identifiziert worden. Wie auch international kommt die demyelinisierende CMT1A am häufigsten vor, gefolgt von der an sich selteneren distalen hereditären motorischen Neuropathie Typ 5 (dHMN-V) mit Mutation im BSCL2 („Berardinelli-Seip congenital lipodystrophy gene“)-Gen. Diese ist bedingt durch die Founder-Mutation Asn88Ser, deren Ursprung bis ins späte 17. Jahrhundert zurückverfolgt werden konnte. Nicht nur bei dieser speziellen genetischen Form, sondern auch bei anderen genetischen Subtypen besteht manchmal eine asymmetrische Verteilung der Muskelatrophie (Abb. 1B). Auch finden sich bei der dHMN-V meist lebhafte Muskeleigenreflexe der unteren Extremitäten.<br /> Viele genetische Ursachen wurden im Zuge von Familienuntersuchungen (Koppelungsanalysen) zunächst im Genom lokalisiert und durch schrittweise Testung von Kandidatengenen schließlich geklärt. Auch fanden zeitgleich umfassende Genotyp-Phänotyp -Studien statt, durch die es möglich wurde, Besonderheiten für einzelne genetische Untertypen hervorzuheben. So erfolgte auch die Abgrenzung der distalen rein bzw. überwiegend hereditären motorischen Neuropathien (dHMN) bzw. jener Untergruppe, bei der überwiegend sensible und/oder autonome Nervenfasern (= hereditäre sensibel-autonome Neuropathie, HSN bzw HSAN) betroffen sind. Alle Erbgänge sind möglich, jedoch überwiegen bei uns dominante Formen, in Ländern mit einem höheren Anteil an Konsanguinität stehen jedoch rezessive Formen im Vordergrund. Nicht selten tritt aber die CMT-Erkrankung auch sporadisch auf.</p> <h2>Genetische Diagnostik</h2> <p>Trotz immenser Verbesserung der technischen Möglichkeiten, die uns nun für die genetische Diagnostik zur Verfügung stehen – insbesondere durch das seit einigen Jahren entwickelte Next Generation Sequencing (NGS), das mittlerweile nicht nur in der Forschung, sondern auch für die rasche Routinediagnostik angewandt wird – gelingt es weiterhin bei nahezu 50 % der CMT Patienten nicht, den Genotyp zuzuordnen. Da das Wissen um den Genotyp für die Beratung der Patienten hinsichtlich des zu erwartenden Krankheitsverlaufs wichtig ist, ist die Zuordnung zur zugrunde liegenden genetischen Abweichung von entscheidender Bedeutung. Sie ist ebenso für junge Patienten mit Kinderwunsch essenziell, um durch Bestätigung der genetischen Diagnose in Bezug auf das zu erwartende Vererbungsrisiko beraten zu können. Auch ist in schweren Fällen eine Präimplantationsdiagnostik nur dann möglich, wenn die genetische Ursache eindeutig zugeordnet werden kann.<br /> Die genetische Abklärung wird in Österreich bereits an mehreren Institutionen bzw. Labors angeboten und kann vom Facharzt für Neurologie, Orthopädie oder Humangenetik nach entsprechender genetischer Beratung veranlasst werden. Die Auswahl des genetischen Tests (Einzelgenanalyse, NGS mit Panel oder „whole exome sequencing“, etc) erfolgt individuell in Abhängigkeit vom klinisch-elektrophysiologischen Phänotyp, von der Größe des vermutlich mutierten Gens und vorhandenen Vorbefunden. Durch die mittlerweile kostengünstige Testung mittels NGS-Methoden ist die bisher meist angewandte Sanger-Sequenzierung einzelner CMT-Gene deutlich in den Hintergrund gerückt. Abbildung 2 zeigt einen möglichen diagnostischer Algorithmus.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2020_Jatros_Neuro_2002_Weblinks_jat_neuro_2002_s7_abb2_auer-grumbach.jpg" alt="" width="850" height="526" /></p> <h2>Ausblick</h2> <p>Erfreulicherweise ist in den letzten Jahren die CMT-Erkrankung auch in Österreich deutlich bekannter geworden. Ziel ist es, dass nicht nur Orthopäden und Neurologen, die die häufigsten Ansprechpartner der CMT-Patienten sind, das Krankheitsbild kennen, verstehen und abklären können, sondern dass auch Allgemeinmediziner, Schulärzte sowie Krankenversicherungen etc. das Wesen dieses Krankheitsbildes erfassen und verstehen können. Als Selbsthilfegruppe hat sich CMT Austria formiert und bietet den Betroffenen laufend aktualisierte Informationen zur Erkrankung und auch über geplante Therapiestudien, die v. a. zur pathogenetisch gut charakterisierten CMT1A immer wieder durchgeführt werden. Auch wenn eine ursächliche Therapie bisher noch nicht zur Verfügung steht, besteht dennoch zumindest für einzelne Subtypen berechtigter Grund zur Hoffnung, dass CMT zukünftig nicht nur symptomatisch durch Physiotherapie, Schmerzmittel und orthopädische Hilfsmittel wie Orthesen und Schuhanpassung behandelt werden kann, sondern auch, dass durch kausale Therapien der Krankheitsverlauf zumindest verzögert oder auch gestoppt werden kann. Aus diesen Gründen sind die vollständige Erfassung und genaue Klassifikation der Betroffenen unerlässlich, um allen CMT-Patienten eine individual- und sozialmedizinisch adäquate Versorgung zukommen zu lassen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei der Verfasserin</p>
</div>
</p>