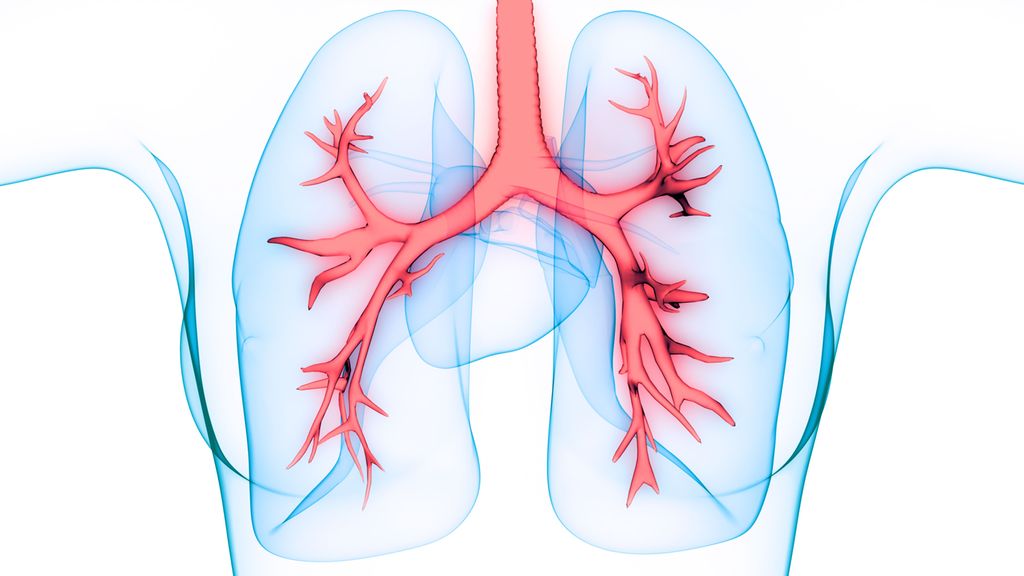
©
Getty Images/iStockphoto
Erkrankungen durch Schimmelpilze – die aktuelle AWMF-Leitlinie
Jatros
Autor:
Prof. Dr. Gerhard A. Wiesmüller
Institut für Arbeitsmedizin und Sozialmedizin<br>Uniklinik RWTH Aachen<br>Gesundheitsamt der Stadt Köln<br>Leiter der Abteilung Infektions- und Umwelthygiene<br>E-Mail: ga.wiesmueller@post.rwth-aachen.de
30
Min. Lesezeit
04.05.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und Präventivmedizin (GHUP) hat mit anderen wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften, deutschen und österreichischen Gesellschaften, Ärzteverbänden und Experten im April 2016 die AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie „Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen“ vorgelegt, AWMF-Register-Nr. 161/001, Klassifikation S2k, gültig bis 10. April 2021.1 Damit soll die bestehende Lücke für die medizinische Diagnostik bei Schimmelbelastungen im Innenraum geschlossen werden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Bisher existierten nur Leitlinien, die Empfehlungen zur Sanierung von Gebäuden bei Feuchteschäden/Schimmelbefall zusammenfassten<sup>2–4</sup>, sowie Übersichtsarbeiten zu den auf Schimmelpilze zurückgeführten Krankheitsbildern. Insbesondere zum Vorgehen bei der Versorgung der betroffenen Patienten gab es zuvor keine umfassende Leitlinie.<br />Im vorliegenden Beitrag wird das Wesentliche aus dieser neuen Leitlinie vorgestellt. Für nähere Details sowie die primären Literaturzitate wird auf die Vollpublikation der Leitlinie verwiesen.<sup>1</sup></p> <h2>Gesundheitliche Beeinträchtigungen durch Schimmelpilzbefall</h2> <p>Abgesehen von der allergischen bronchopulmonalen Aspergillose (ABPA) und den durch Schimmelpilze kausal verursachten Mykosen, liegen nur Evidenzen für Assoziationen von Feuchte-/Schimmelschäden und unterschiedlichen Krankheiten vor, die in Tabelle 1 dargestellt sind.<br />Eine Kausalität zwischen einer speziellen Schimmelpilzexposition und konkreten gesundheitlichen Beschwerden/Krankheitsbildern kann im Einzelfall nicht zweifelsfrei abgeleitet werden. Ob eine Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilze vorliegt, hängt maßgeblich von der Disposition der exponierten Personen ab.<br />Nach heutigem Kenntnisstand sind Reizungen der Schleimhäute der Augen und Atemwege sowie allergische Reaktionen bei Schimmelbefall außerhalb von Krankenhäusern wahrscheinlich am häufigsten.<br />Um eine gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelpilze beurteilen zu können, müssen die Disposition der Betroffenen und das Ausmaß des Schimmelpilzbefalls beurteilt werden. Vom Arzt ist zunächst zu prüfen, ob das Beschwerde-/Krankheitsbild möglicherweise durch einen Schimmelbefall im Innenraum bedingt sein kann und ob eine Prädisposition hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Schimmelpilzwirkungen vorliegt. Hierzu dienen wie bei jeder medizinischen Diagnostik zunächst die Anamnese und körperliche Untersuchung. Zudem ist eine sachliche Information über das aktuelle Wissen zu möglichen gesundheitlichen Effekten und Risiken sowie zu indizierten Untersuchungsmethoden bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen von zentraler Bedeutung. Hierbei kann die zu beziehende Kurzfassung der AWMF-Leitlinie für von einem Schimmelbefall Betroffene behilflich sein (<a href="http://www.akademie-oegw.de/fileadmin/customers-data/aktuelles/Newsletter_12_2016/2016- 12-15_AWMF-Betroffene_Schimmelpilzbefalle.pdf">www.akademie-oegw.de/fileadmin/customers-data/aktuelles/Newsletter_12_2016/2016-12-15_AWMF-Betroffene_Schimmelpilzbefalle.pdf</a>).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Pneumo_1702_Weblinks_s34_1.jpg" alt="" width="2148" height="1506" /></p> <h2>Infektionen</h2> <p>Bei Infektionen durch Schimmelpilze handelt es sich stets um opportunistische Infektionen. Sie setzen eine verminderte Immunabwehr bei exponierten Patienten voraus, die nach der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut (KRINKO) in drei Schweregrade (Risikogruppen) eingeteilt wird (Tab. 2).<sup>5</sup> Dies sind (Aufzählung entsprechend dem abnehmenden Risiko) Patienten mit Tumorerkrankung, v.a. mit hämatoonkologischer Grunderkrankung (z.B. Leukämie, Lymphom), akuter myeloischer Leukämie (AML), akuter lymphatischer Leukämie (ALL), allogener Stammzelltransplantation, autologer Stammzelltransplantation, solider Organtransplantation, HIV-Infektion, sonstiger Immunsuppression (z.B. länger dauernde hoch dosierte Therapie mit Glukokortikoiden), aplastischer Anämie, zystischer Fibrose u.v.a. Zum Vorgehen bei Schimmelpilzinfektionen sei auf die entsprechende angemeldete AWMF-Leitlinie zu Diagnose und Therapie invasiver Aspergillusinfektionen, AWMF Nr. 082-003 – Entwicklungsstufe: S2e (<a href="http://www.awmf.org/leitlinien/detail/anmeldung/1/ll/082-003.html">www.awmf.org/leitlinien/detail/anmeldung/1/ll/082-003.html</a>), verwiesen.</p> <h2>Sensibilisierungen und Allergien</h2> <p>Eine Sensibilisierung auf Schimmelpilze kann im Prinzip leitliniengerecht durch Allergietests (Hauttests oder Nachweis von spezifischen IgE-Antikörpern) nachgewiesen werden. Nur im Falle eines Verdachts auf ABPA (seltene Erkrankung v.a. bei zystischer Fibrose, Asthma bronchiale) oder einer exogenen allergischen Alveolitis (EAA; seltene Erkrankung, überwiegend am Arbeitsplatz) ist zusätzlich der Nachweis von spezifischen IgG-Antikörpern im Serum indiziert. Eine IgE-vermittelte Allergie kann neben der gründlichen Anamnese leitliniengerecht durch eine konjunktivale, nasale und/oder bronchiale Provokation nachgewiesen werden. Dabei gibt es allerdings ein Problem: Für die meisten im Innenraum bei Feuchteschäden vorkommenden Schimmelpilze sind zur Allergietestung keine kommerziell erhältlichen Testextrakte verfügbar. Daher kann von einem positiven Testergebnis allein nicht auf mögliche gesundheitliche Probleme mit Schimmelpilzbefall im Innenraum geschlossen werden. Auf der anderen Seite schließt ein negatives Ergebnis aber auch mögliche gesundheitliche Probleme aufgrund von Schimmelpilzen, die typischerweise bei Feuchteschäden vorkommen, nicht aus.<br />Spezielle serologische und zelluläre Untersuchungsmethoden und ihre Aussagekraft für Schimmelpilzexpositionen im Innenraum sind in Tabelle 3 zusammengestellt.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Pneumo_1702_Weblinks_s34_2.jpg" alt="" width="1419" height="1760" /></p> <h2>Toxische Reaktionen</h2> <p>Eine Bestimmung von Mykotoxinen im Blut oder Urin hat für die medizinische Praxis keine Bedeutung und muss zurzeit auf wissenschaftliche Fragestellungen beschränkt bleiben. Beim aktuellen Stand der analytischen Möglichkeiten lassen sich die Mykotoxine im Innenraum weder sicher bestimmen noch bewerten.<br />Bisher ist ungeklärt, ob von flüchtigen organischen Verbindungen („microbial volatile organic compounds“, MVOC), welche von Schimmelpilzen und Bakterien gebildet werden, für die aber auch andere Quellen in Innenräumen existieren, in den in Innenräumen vorkommenden Konzentrationen biologische Signalwirkungen ausgehen. Ihre Bestimmung in der Innenraumluft ist für die medizinische Diagnostik nicht sinnvoll.</p> <h2>Geruchsbelästigungen und Befindlichkeitsstörungen</h2> <p>Auch Geruchswirkungen und/oder Befindlichkeitsstörungen können bei Feuchte-/Schimmelschäden im Innenraum vorkommen. Hierbei handelt es sich nicht um eine akute Gesundheitsgefährdung. Prädisponierende Faktoren für Geruchswirkungen können genetische und hormonelle Einflüsse, Prägung, Kontext und Adaptationseffekte sein. Prädisponierende Faktoren für Befindlichkeitsstörungen können Umweltbesorgnisse, -ängste, -konditionierungen und -attributionen sowie eine Vielzahl von Erkrankungen sein.</p> <h2>Weiterführende Diagnostik und Austestung</h2> <p>Eine Bestimmung der Schimmelpilzarten, die bei einem bestimmten Schimmelbefall im Innenraum vorkommen, ist für die medizinische Diagnostik nur in Ausnahmefällen (z.B. bei Infektionsgefährdung) sinnvoll. Eine zusammenfassende aktuelle Darstellung der Untersuchungsmethoden zur Erfassung einer Schimmelpilzexposition bei Schimmelbefall in Innenräumen und ihrer Aussagemöglichkeiten findet sich bei Gabrio et al.<sup>6</sup><br />Insbesondere für solche Personen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bei Schimmelbefall haben, stellt die durch eine Schimmelpilzmessung bedingte zeitliche Verzögerung von Maßnahmen ein erhöhtes Risiko dar.</p> <h2>Risikogruppen</h2> <p>Personen, die ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bei Schimmelbefall haben und somit besonders zu schützende Risikogruppen darstellen, sind:<br />– Personen mit Immunsuppression/Immunschwäche nach den oben dargestellten drei Risikogruppen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut,<sup>5</sup><br />– Personen mit zystischer Fibrose (Mukoviszidose),<br />– Personen mit Asthma bronchiale.</p> <h2>Therapie</h2> <p>Auch dann, wenn kausal der Zusammenhang zwischen Beschwerden/Befunden/Krankheiten und dem Vorkommen von Schimmel/Feuchte im Innenraum nicht nachgewiesen werden kann, ist aus präventiver und hygienischer Sicht beim Vorhandensein eines Feuchte-/Schimmelschadens die erste „therapeutische“ Maßnahme die zügige fach- und sachgerechte Sanierung und bei schwerwiegenden Krankheitsbildern mit hohem Gesundheitsrisiko (Immunsuppression gemäß den Kriterien der KRINKO,<sup>5</sup> zystische Fibrose, Asthma) die umgehende Expositionsminimierung.<br />Die Behandlung von Schimmelpilzinfektionen gehört in die Hände der Fachärzte, die auch die jeweilige Grunderkrankung behandeln, und/oder von fachkundigen Infektiologen. Spezifische antiallergische Behandlungen gehören in die Hände von bezüglich Schimmelpilzallergien erfahrenen Allergologen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Pneumo_1702_Weblinks_s34_3.jpg" alt="" width="2151" height="2908" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Wiesmüller GA et al: AWMF-Schimmelpilz-Leitlinie „Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposition in Innenräumen“ 2016; AWMF-Register-Nr. 161/001; online unter: <a href="http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/161-001.html">www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/161-001.html</a> (Stand 11. 4. 2016) <strong>2</strong> Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes: Leitfaden zur Vorbeugung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Schimmelpilzwachstum in Innenräumen („Schimmelpilz-Leitfaden“). Umweltbundesamt, Berlin, 2002; online unter: <a href="http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2199.pdf">www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2199.pdf</a> <strong>3</strong> Innenraumlufthygiene-Kommission des Umweltbundesamtes: Leitfaden zur Ursachensuche und Sanierung bei Schimmelpilzwachstum in Innenräumen („Schimmelpilzsanierungs-Leitfaden“). Umweltbundesamt, Berlin, 2005; online unter: www.umweltbundesamt.org/fpdf-l/2951.pdf <strong>4</strong> Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg: Handlungsempfehlung für die Sanierung von mit Schimmelpilzen befallenen Innenräumen. Stuttgart, 2006; online unter: <a href="http://www.landesgesundheitsamt.de/servlet/PB/show/1154726/0204_Handlungsempfehlung_Schimmelpilze.pdf">www.landesgesundheitsamt.de/servlet/PB/show/1154726/0204_Handlungsempfehlung_Schimmelpilze.pdf</a> <strong>5</strong> Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI): Anforderungen an die Hygiene bei der medizinischen Versorgung von immunsupprimierten Patienten. Bundesgesundheitsbl 2010; 53: 357-88 <strong>6</strong> Gabrio T et al: Untersuchungsmethoden zur Erfassung einer Schimmelpilzexposition – ein Update. Umweltmed – Hygiene – Arbeitsmed 2015; 20(3): 115-31 <strong>7</strong> Haftenberger M et al: Prävalenz von Sensibilisierungen gegen Inhalations- und Nahrungsmittelallergene. Ergebnisse der Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland (DEGS1). Bundesgesundheitsbl 2013; 56: 687-97 <strong>8</strong> Heinzerling LM et al: GA(2)LEN skin test study I: GA(2)LEN harmonization of skin prick testing: novel sensitization patterns for inhalant allergens in Europe. Allergy 2009; 64: 1498-1506 <strong>9</strong> Kommission „Methoden und Qualitätssicherung in der Umweltmedizin“ des Robert Koch-Instituts: „Qualitätssicherung beim Lymphozytentransformationstest“ – Addendum zum LTT-Papier der RKI-Kommission „Methoden und Qualitätssicherung in der Umweltmedizin“. Bundesgesundheitsbl – Gesundheitsforsch – Gesundheitsschutz 2008; 51: 1070-6 <strong>10</strong> TRBA 460 (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe 460), Einstufung von Pilzen in Risikogruppen. 2002; BArbBl 10</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Asthma und der zirkadiane Rhythmus
Der zirkadiane Rhythmus spielt nicht nur beim Schlafverhalten eine bedeutende Rolle, sondern hat auch einen erheblichen Einfluss auf Asthmaanfälle und die Lungenfunktion. Die gezielte ...
Hypersensitivitätspneumonitis – wie oft denken wir Pathologen nicht daran?
Die Hypersensitivitätspneumonitis (HP) ist eine immunvermittelte interstitielle Lungenerkrankung, die durch Immunreaktionen auf inhalierte Antigene verursacht wird. Die Diagnose stützt ...


