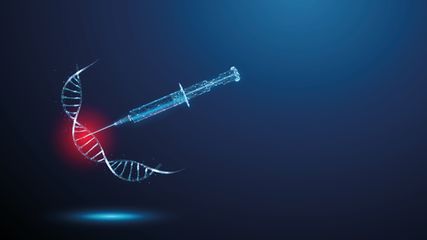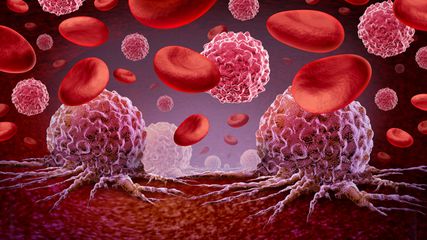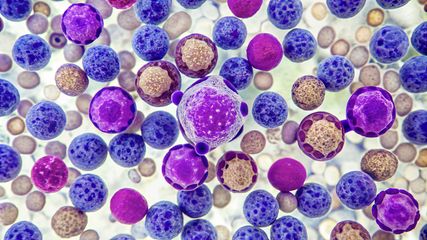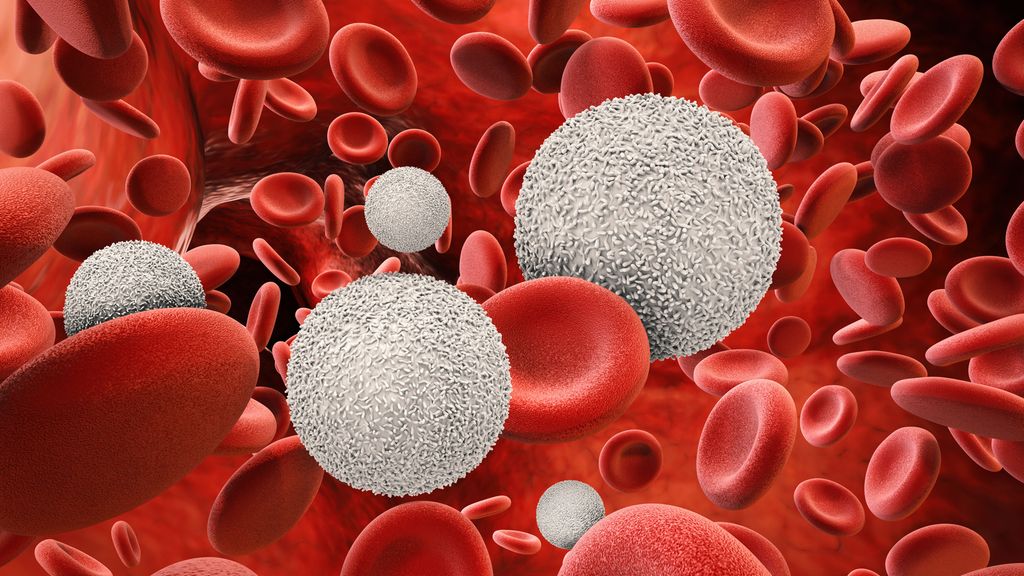
©
Getty Images/iStockphoto
Aktuelles zu den neuen Faktorpräparaten mit verlängerter Halbwertszeit
Jatros
30
Min. Lesezeit
12.07.2018
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Die Substitution von Gerinnungsfaktoren ist für die Patienten mit regelmäßigen Injektionen verbunden und bedeutet eine oftmals hohe Belastung. Daher sind Präparate mit verlängerter Halbwertszeit, die seltener appliziert werden müssen, eine Option. Ob sie allerdings für jeden Hämophiliepatienten geeignet sind und was vor einer Umstellung zu bedenken ist, war eines der Themen am Kongress der World Federation of Hemophilia (WFH) in Glasgow.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>EHL-Faktorpräparate bieten die Chance, die Hämophilietherapie weiter zu verbessern.</li> <li>Alle derzeit verfügbaren Produkte sind in der Blutungskontrolle und Prophylaxe vergleichbar.</li> <li>Innovative Therapiekonzepte werden die Behandlung in den kommenden Jahren verändern.</li> <li>Da die neuen Therapeutika andere Angriffspunkte und somit andere Nebenwirkungen haben, ist es nötig, die Ärzte entsprechend zu schulen und langfristige Programme zur Nachbeobachtung aufzulegen.</li> </ul> </div> <p>Prof. John Pasi, London, gab in seinem Vortrag einen Überblick über die Faktorpräparate mit verlängerter Halbwertszeit („extended half-life“, EHL) und die Umstellung der Patienten von einer bewährten Behandlung auf diese Medikamente. Eine Möglichkeit, die Halbwertszeit zu verlängern, ist die Pegylierung, also die Konjugation mit Polyethylenglykol (PEG). Hier gebe es immer wieder Bedenken wegen der Verstoffwechslung und Toxizität des PEG, erklärte Pasi. In Tiermodellen habe sich jedoch auch bei einer länger dauernden Gabe über zwei Jahre kein Hinweis auf eine Toxizität gezeigt. Lediglich eine starke Überdosierung könne zu einer akuten Toxizität führen, sagte er. Auch in klinischen Studien hätten sich keine entsprechenden Hinweise ergeben.<sup>1</sup> In Untersuchungen an gesunden Personen wurden Antikörper gegen PEG gefunden, deren klinische Relevanz jedoch nicht klar ist.<sup>2</sup> Ein weiterer Aspekt ist, wie EHL definiert wird. Pasi zeigte die Designs der Studien mit den derzeit verfügbaren EHLFaktor- VIII(FVIII)-Präparaten, die sich sehr voneinander unterscheiden und daher einen direkten Vergleich der Substanzen nicht erlauben. Die relative Verlängerung der Halbwertszeit beträgt das bis zu 1,5-Fache. Schaut man sich die jährliche Blutungsrate („annualised bleeding rate“, ABR) an, dann liegt diese bei allen im Durchschnitt zwischen 0 und 3,6.<br /> Im Gegensatz dazu konnte die Halbwertszeit der Faktor-IX(FIX)-Präparate deutlich verlängert werden – bis zum 4,8-Fachen. Zur Frage, welche Patienten auf EHL-Präparate umgestellt werden sollten, gab Pasi einige Kriterien an, unter anderem:</p> <ul> <li>wenn herkömmliche Therapieschemata nur schwer eingehalten werden können</li> <li>wenn höhere Talspiegel notwendig sind</li> <li>wenn die Patienten es wünschen</li> </ul> <h2>Emicizumab bei Hämophilie-A-Patienten ohne Inhibitoren</h2> <p>Prof. Johnny Mahlangu, Johannesburg/ Südafrika, berichtete über die Ergebnisse der Phase-III-Studie HAVEN 3. Sie sollte die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik des rekombinanten, humanisierten, bispezifischen monoklonalen Antikörpers Emicizumab bei Patienten mit Hämophilie A ohne Inhibitoren untersuchen. Emicizumab ahmt die natürliche Funktion des FVIII nach, indem es an die beiden Gerinnungsfaktoren IXa und X bindet. So kann die Blutgerinnungskaskade auch ohne FVIII ablaufen. Der Wirkstoff wird deshalb auch nicht durch Anti- FVIII-Hemmkörper (Inhibitoren) beeinträchtigt.<sup>3</sup><br /> An HAVEN 3 (NCT02847637) nahmen 152 Patienten ohne Inhibitoren teil, die bereits eine Faktorprophylaxe oder eine Bedarfsbehandlung erhalten hatten. Letztere wurden in drei Arme randomisiert: Die Patienten in Arm A und B wurden initial vier Wochen lang mit 3mg Emicizumab/ kg/Woche behandelt und anschließend entweder mit 1,5mg/kg/Woche (Arm A) oder mit 3mg/kg alle zwei Wochen (Arm B). Arm C erhielt weiterhin keine Prophylaxe. Patienten, die vor Studienbeginn bereits eine Prophylaxe hatten, wurden in Arm D zusammengefasst und mit dem gleichen Schema behandelt wie die Probanden in Arm A. Primärer Endpunkt war die Anzahl der Blutungen während der Emicizumab-Prophylaxe (Arm A und Arm B) verglichen mit keiner Prophylaxe (Arm C). Sekundäre Endpunkte waren unter anderem Blutungshäufigkeit, Blutungen in Zielgelenke, gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL), bei Patienten in Arm D der Vergleich der Blutungshäufigkeit zwischen ihrer früheren Prophylaxe und Emicizumab sowie die Sicherheit.<br /> Im Vergleich zu Arm C reduzierte die Prophylaxe in Arm A die ABR um 96 % , in Arm B um 97 % (jeweils p<0,0001). Ähnlich hoch war auch die Reduktion der Blutungen in die Zielgelenke. Selbst bei Patienten, die zuvor bereits eine regelmäßige Prophylaxe erhalten hatten, kam es zu einer Reduktion der ABR um 68 % im Vergleich zu ihrer früheren Medikation (p<0,0001). Das Nebenwirkungsprofil war günstig und es kam nicht zu thromboembolischen Ereignissen. Mahlangus Fazit lautete, dass die subkutane Prophylaxe mit Emicizumab eine effektive und sichere Behandlungsoption bei Hämophilie A ist.<sup>4</sup></p> <h2>Emicizumab bei Patienten mit und ohne Inhibitoren</h2> <p>Prof. Steven Pipe, Ann Arbor/USA, präsentierte beim WFH World Congress die HAVEN-4-Studie (NCT03020160), an der 48 Hämophilie-A-Patienten mit und ohne Inhibitoren teilnahmen. Sie untersuchte die Wirksamkeit, Sicherheit und Pharmakokinetik der vierwöchentlichen Gabe vom Emicizumab. Alle Patienten hatten bereits zuvor eine Faktorprophylaxe oder eine Bedarfstherapie erhalten. Primärer Endpunkt war die Häufigkeit behandelter Blutungen unter Emicizumab; zu den sekundären Endpunkten gehörten unter anderem die allgemeine Blutungsfrequenz, die Häufigkeit behandelter Spontanblutungen sowie Gelenkblutungen und Blutungen in Zielgelenke, die gesundheitsbezogene Lebensqualität (HRQoL) und die Sicherheit.<br /> Die Patienten wurden in zwei Gruppen randomisiert: Die Expansionsgruppe zur Bewertung der Wirksamkeit und Sicherheit erhielt während einer vierwöchigen Einleitungsphase 3mg Emicizumab/kg/ Woche und anschließend 6mg/kg alle vier Wochen. Die Gruppe zur Bewertung der Pharmakokinetik erhielt ausschließlich 6mg/kg alle vier Wochen.<br /> Bei den Patienten in der Expansionsgruppe wurde im Median eine ABR von 0,0 behandelten Blutungen verzeichnet, wobei rund 56 % der Patienten de facto keine behandelte Blutung aufwiesen und 90 % zwischen 0-3 behandelten Blutungen. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine vierwöchentliche Prophylaxe mit Emicizumab bei Hämophilie-A-Patienten mit und ohne Inhibitoren eine gute Blutungskontrolle erzielen kann. Das Nebenwirkungsprofil war mit früheren Ergebnissen vergleichbar.<sup>5</sup></p> <h2>Registeranalyse zur Inhibitorentstehung</h2> <p>Prof. Marijke van den Berg, Utrecht/ Niederlande, stellte eine Studie vor, die untersuchte, ob es Unterschiede zwischen rekombinanten Faktorpräparaten und Plasmapräparaten hinsichtlich der Inhibitorentstehung gibt. Basis waren Daten aus dem PedNet-Register, an dem aktuell 32 Hämophiliebehandlungszentren aus 18 europäischen Staaten beteiligt sind, und eingeschlossen waren alle nicht vorbehandelten Patienten mit schwerer Hämophilie A (FVIII<0,01 IU/ml). Daraus wurden zwei Kohorten gebildet: Kohorte 1 mit Patienten, die zwischen 2000 und 2009 geboren wurden, Kohorte 2 mit Patienten, die nach 2009 geboren wurden. Die Nachbeobachtungszeit wurde mit 20 Jahren festgelegt, um Langzeitverläufe verfolgen zu können. Endpunkt war die klinisch relevante Entwicklung von Inhibitoren innerhalb der ersten 50 Behandlungstage, definiert als mindestens zwei positive Titer und eine verminderte Wiederfindungsrate (Recovery) bzw. ein hoher Titer von >5BU/ml.<br /> Ausgewertet wurden die Daten von insgesamt 988 Patienten mit schwerer Hämophilie A. Von diesen wurden 805 mit rekombinanten Faktorpräparaten behandelt, 183 mit plasmabasierten. Beide Gruppen unterschieden sich hinsichtlich der Inzidenz von Inhibitoren nicht signifikant: 28 % der Patienten, die rekombinante Faktorpräparate erhielten, entwickelten Inhibitoren versus 27 % der Patienten, die mit plasmabasierten Produkten behandelt wurden. Auch die Inzidenz hoher Hemmkörpertiter unterschied sich nicht signifikant (20 vs. 21 % ). In Zukunft wollen die Wissenschaftler nicht die Produktklassen analysieren, sondern die einzelnen Präparate. Außerdem sollen alle genetischen und mit der Therapie verbundenen Risikofaktoren der Inhibitorbildung berücksichtigt werden.<sup>6</sup></p> <h2>Was die Zukunft bringt</h2> <p>Prof. David Lillicrap, Kingston/Kanada, wagte einen Blick in die Zukunft und beschrieb die Entwicklungen der Hämophilietherapie in den kommenden fünf Jahren. Es gibt eine Reihe innovativer Ansätze, zum Beispiel EHL-Präparate, Intrinsische- Tenase-Komplex-Innovationen wie Emicizumab, Modulatoren der Hämostase wie den Antithrombin-Blocker Fitusiran oder den Tissue-Factor-Pathway-Inhibitor Concizumab sowie Zell- und Gentherapien.<br /> Dies werde die Behandlungsmöglichkeiten in den nächsten fünf Jahren stark erweitern, sagte Lillicrap. Dennoch sollte man mit Vorsicht an diese Entwicklungen herangehen, denn die Studien zu den innovativen Therapien hätten einige Limitationen. Dazu zählen eine meist geringe Patientenzahl, die oft kurze Nachbeobachtungszeit und ein noch unvollständiges Verständnis der Pathogenese von Nebenwirkungen. Denn die Hämostase ist komplex, dynamisch und selbstregulierend. Gerinnungsfördernde und gerinnungshemmende Signale sind normalerweise fein aufeinander abgestimmt und durch zelluläre, vaskuläre und plasmaassoziierte Faktoren reguliert. Die innovativen Produkte ersetzen nicht die fehlenden Faktoren, sondern greifen in die Hämostase selbst ein. Das Management unerwünschter Wirkungen wie Thrombosen oder Blutungen könne sich deshalb von dem bisher üblichen unterscheiden. Daher plädierte Lillicrap dafür, vor allem die behandelnden Ärzte zu schulen und neue Therapien zunächst nur in spezialisierten Zentren einzusetzen. Zudem müsse die Pathophysiologie der Nebenwirkungen besser erforscht werden. Postmarketing-Surveillance- Programme und Leitlinien für das Management von Blutungen unter der Therapie, Operationen, Therapieversagen und für Laboruntersuchungen seien ebenfalls nötig, betonte er.<br /> Eine andere Strategie ist die Gentherapie, zu der derzeit einige Studien bei Hämophilie A und B laufen. Dabei werden Adeno-assoziierte Viren (AAV) als Genvektoren eingesetzt. Einschränkungen bei diesem Verfahren sind unter anderem die geringe Ladekapazität der Partikel und dass bis zu 60 % der Menschen gegen sie immun sind. Grundsätzlich sei die Höhe der durch die Gentherapie angeregten Faktorproduktion sehr variabel, sagte Lillicrap. Außerdem sei eine vorübergehende Hepatotoxizität innerhalb der ersten drei Behandlungsmonate beobachtet worden. Deren Pathogenese wird noch diskutiert, aber sie hinterlässt offenbar keine bleibenden Schäden. Dies müsse allerdings weiter untersucht werden und die Patienten müssten über einen längeren Zeitraum nachbeobachtet werden. Im Mausmodell führte die Gentherapie gelegentlich zu Leberzellkarzinomen. Auch dies müsse eingehend erforscht werden, betonte Lillicrap. Er riet zu Registern für Patienten, die mittels Gentherapie behandelt werden, und zu jährlichen Untersuchungen der Betroffenen.<br /> Trotz der Einschränkungen und Herausforderungen bei neuen Hämophilietherapien zog Lillicrap ein positives Fazit: Die Fortschritte, die mit diesen Innovationen einhergehen, seien substanziell und hätten das Potenzial, die Lebensqualität der Patienten signifikant zu verbessern.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Kongress der World Federation of Hemophilia 2018,
20. bis 24. Mai, Glasgow
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Baumann A et al.: Pharmacokinetics, metabolism and distribution of PEGs and PEGylated proteins: quo vadis? Drug Discov Today 2014; 19: 1623-31 <strong>2</strong> Lubich C et al.: Antibodies against polyethylene glycol (peg) in healthy subjects – myth or reality? J Thromb Haemost 2015; 13(Suppl 2): 352 <strong>3</strong> Oldenburg J et al.: Emicizumab prophylaxis in hemophilia A with inhibitors. N Engl J Med 2017; 377: 809- 18 <strong>4</strong> Mahlangu J: Emicizumab prophylaxis administered once-weekly or every two weeks provides effective bleed prevention in persons with hemophilia A without inhibitors – results from the phase III HAVEN 3 study. WFH 2018, LBA 854 <strong>5</strong> Pipe S: Emicizumab subcutaneous dosing every 4 weeks is safe and efficacious in the control of bleeding in persons with hemophilia A with and without inhibitors – results from the phase 3 HAVEN 4 study. WFH 2018, LBA <strong>6</strong> Van den Berg M: Inhibitor incidence in 1083 PUPs with severe hemophilia treated with class recombinant or class plasma products is similar. WFH 2018, LBA <strong>7</strong> Lillicrap D: New therapies for hemophilia: balancing caution with excitement. WFH 2018</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Thalassämie nimmt hierzulande an Bedeutung zu
Die medizinische Betreuung von Thalassämiepatient:innen hat sich in den letzten Jahrzehnten deutlich gebessert und benötigt insbesondere bei symptomatischen Patient:innen eine ...
Heilung für das multiple Myelom?
Fortschritte des Wissens zur Pathogenese des multiplen Myeloms (MM) und die davon abgeleitete Entwicklung neuer Behandlungsformen haben zu einer signifikanten Steigerung des Überlebens ...
Interessante Daten zu neuen Therapieoptionen
Am hämatologischen Jahreskongress der American Society of Hematology (ASH) wurden Updates von Studien wie TRIANGLE und POLARIX präsentiert, ohne dass sich hierbei grundlegende neue ...