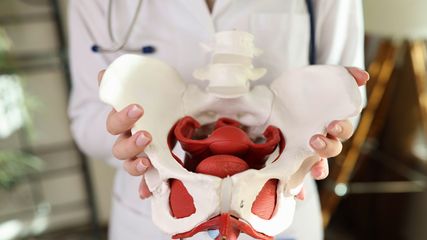Psychische Risiken und traumasensible Begleitung
Autorin:
Dr.phil. Kathrin Degen
Therapeutische Leitung
Gynäkopsychiatrie Thurgau
Psychiatriezentrum Kreuzlingen
E-Mail: kathrin.degen@stgag.ch
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Der Verlust eines Kindes im Rahmen einer späten Abortinduktion, nach Feststellung einer fetalen Missbildung oder einer schweren Chromosomenstörung, kann als ein traumatisches Lebensereignis erachtet werden. Die psychischen Folgen eines solchen Abbruchs, vor allem wenn dieser im 2. oder 3. Trimenon erfolgt, können schwerwiegend für die Betroffenen und ihr Umfeld sein. Um psychischen Folgestörungen entgegenzuwirken, sollte eine möglichst frühzeitige und kontinuierliche traumasensible Begleitung der Paare und Familien angestrebt werden.1–3
Trauerreaktion nach peripartalen Verlusten
Peripartale Verluste aufgrund von Fehlgeburt, Totgeburt oder eines neonatalen Versterbens sind keine seltenen Ereignisse und können erhebliche Auswirkung auf das psychische Wohlbefinden der betroffenen Eltern und Familien haben. So ist ein peripartaler Verlust häufig mit depressiven Symptomen, Ängsten, Schlafstörungen und posttraumatischem Stress assoziiert.4 Auch wenn die Eltern kaum oder wenig Zeit hatten, eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, unterscheidet sich die Intensität der Trauerreaktion nicht signifikant von dem Verlust einer anderen nahestehenden Person.5
Der Verlust eines Kindes in der Schwangerschaft ist aber häufiger als andere Verlusterlebnisse mit Schuldgefühlen und Selbstvorwürfen verbunden, was den Trauerprozess verlängern kann. Ebenso können sich der häufig zu beobachtende soziale Rückzug von betroffenen Familien sowie das Gefühl, der eigene Körper habe versagt, negativ auf die Trauerreaktion auswirken.6 In der Folge kann es zu einer anhaltenden Trauerstörung (auch bekannt als «komplizierte Trauerreaktion») kommen. Bei dieser dauern die zunächst normativen Trauersymptome länger an, schränken das Funktionsniveau der betroffenen Person stärker ein und können im ungünstigsten Fall chronifizieren.
Risikofaktoren für eine anhaltende Trauerstörung
Es konnten verschiedene Risikofaktoren identifiziert werden, welche die Entstehung einer anhaltenden Trauerstörung im Rahmen eines peripartalen Verlustes begünstigen. So kann z.B. das Fehlen von sozialer Unterstützung, sei es durch den Partner oder die Partnerin, die Familie oder auch Freunde, zur Entstehung einer anhaltenden Trauerstörung beitragen.5 Ebenso zeigt sich bei kinderlosen Frauen eine stärker ausgeprägte Trauerreaktion als bei Frauen, welche bereits Kinder haben. Auch Ambivalenz bezüglich der verlorenen Schwangerschaft sowie das Vorbestehen von psychischen Belastungen und Erkrankungen können das Risiko für einen stockenden bzw. komplizierten Trauerprozess erhöhen.7 Während die Trauerintensität zunimmt, je mehr sich eine Frau bereits innerlich und äusserlich mit dem Kind beschäftigt und seine Realität anerkannt hat, scheint hingegen das reine Gestationsalter weit weniger ausschlaggebend für die Intensität der Trauerreaktion zu sein.8 So können Mütter, die eine frühere Fehlgeburt erlitten haben, eine ebenso starke Trauerreaktion zeigen wie Frauen mit einer Totgeburt im letzten Trimenon.
Besonderheiten beim induzierten Schwangerschaftsabbruch
Eine besondere Form des peripartalen Verlustes ist der Abbruch einer Schwangerschaft aufgrund von pränatal diagnostizierten fetalen Missbildungen oder schweren Chromosomenstörungen. Schuldgefühle, die eine negative Auswirkung auf den Trauerprozess haben können, sind in Zusammenhang mit einem späten Schwangerschaftsabbruch besonders häufig. Ebenso kann es in diesen Fällen zu «disenfranchised grief» kommen, dem Phänomen, dass den betroffenen Eltern die Trauer durch das familiäre Umfeld, Fachpersonen oder auch sich selbst gegenüber abgesprochen wird. Oft berichten Patientinnen in der Trauertherapie auch, sie haben das Gefühl, ihre Trauer sei aufgrund ihrer Entscheidung gegen das Austragen des Kindes nicht zulässig.9
Eine Langzeitstudie zeigte, dass 14 Monate nach dem Verlust immer noch 14% der betroffenen Frauen die Kriterien für eine anhaltende Trauerstörung erfüllten und 17% der Betroffenen mit einer psychiatrischen Erkrankungdiagnostiziert wurden.1 Eine weitere Studie zeigte, dass 20% der Frauen bis zu ein Jahr unter den Symptomen einer anhaltenden Trauerstörung und weiteren psychischen Symptomen litten.10 Für den Langzeitverlauf nach einem Schwangerschaftsabbruch scheinen insbesondere ein hohes Stresslevel direkt nach dem Eingriff, fehlende Unterstützung durch Partner:innen, eine als gering wahrgenommene Selbstwirksamkeit sowie ausgeprägteZweifel während der Entscheidungsfindungals Faktoren eine negative Rolle zu spielen.1
Traumasensible Begleitung
Um die Wahrscheinlichkeit für eine anhaltende Trauerstörung oder andere psychische Störungen trotz der genannten Risikofaktoren und besonderen Umstände des induzierten Spätaborts zu reduzieren, sollte möglichst früh ein traumasensibler Ansatz in der Begleitung verfolgt werden. Dies betrifft zum einen das Bewusstsein bei den involvierten Fachpersonen, dass, sollte sich der Verdacht auf einen schwerwiegenden pränatalen Befund bestätigen und sollten sich die Eltern für einen Abbruch entscheiden, dies als ein traumatisches Lebensereignis erachtet werden kann. Zum anderen sollte bei einer traumasensiblen Versorgung berücksichtigt werden, dass man in vielen Fällen nicht weiss bzw. nicht ausschliessen kann, ob die betroffenen Menschen bereits traumatische Vorerfahrungen haben. Unabhängig davon, ob die etwaigen traumatischen Vorerfahrungen sich auf frühere Peripartalzeiten beziehen oder ausserhalb von diesen stattfanden, können sie das traumatische Erleben in der aktuellen Situation nochmals verstärken bzw. können alte traumatische Erfahrungen dadurch aktiviert werden.
Insbesondere den Moment, in dem zum ersten Mal der Verdacht auf eine pränatale Auffälligkeit geäussert wird, beschreiben viele Frauen und Paare rückblickend als überfordernd und überwältigend, da dies meistens nicht vorhersehbar war und sie häufig völlig unvorbereitet getroffen hat. Deshalb sollten bereits zu diesem Zeitpunkt Interventionen und Herangehensweisen genutzt werden, die aus dem Bereich der «psychischen Ersten Hilfe» bekannt sind. Dazu gehören unter anderem das Geben von Informationen, das aktive Zuhören und die Stärkung der Selbstkontrolle der Betroffenen. So beschreiben viele Frauen, dass Folgendes für sie hilfreich war: ein ausführliches Gespräch mit der Fachperson, auf Wunsch umfassende Informationen zu erhalten, Fragen stellen zu können und, wenn möglich, frühzeitig in den Entscheidungsprozess über nächste Schritte involviert zu werden. Diese Form der Begleitung sollte über den zum Teil längeren Abklärungszeitraum fortgesetzt werden, wobei es als hilfreich erlebt wird, wenn es eine feste Ansprechperson gibt, an welche sich die Eltern wenden können. Besonders negativ wirkt sich psychisch aus, wenn während dieser Abklärungsphase das Gefühl entsteht, alleine gelassen zu werden. Ist die Diagnose bestätigt und der Entscheid für einen Abbruch gefällt, kommt der Begleitung der Geburt für den psychischen Integrations- und Trauerprozess eine besondere Bedeutung zu. Den Eltern auch im Falle eines induzierten Spätaborts Abschiedsrituale zu ermöglichen – das (wenn es gewünscht ist) Sehen und Halten des Kindes, professionelle Erinnerungsfotos, welche bei spezialisierten Fotograf:innen auch in relativ frühen Schwangerschaftswochen möglich sind, sowie die Gestaltung der Verabschiedung bzw. Beerdigung – ist mittlerweile weit verbreitet und etabliert. Es ist jedoch zu erwähnen, dass einige Studien eine signifikant höhere Rate an posttraumatischen Belastungssymptomen, Angst und Depression bei Frauen zeigten, die ihre verstorbenen Kinder gehalten hatten.11 Es sollten deshalb auch hier immer die Autonomie und Selbstbestimmung der Eltern an erster Stelle stehen, wenn es darum geht, wie sie von ihrem Kind Abschied nehmen wollen.
Trauerprozess fördern
Für die psychische Integration des Verlustes ist es relevant, den Trauerprozess zu ermöglichen und zu fördern. Trauer ist ein normales, wenn auch sehr individuelles und persönliches Phänomen und trägt in seinem häufig wellenförmigen Verlauf dazu bei, den erlebten Verlust zu integrieren, was sich in einer Abnahme der zunächst starken und dann allmählich abflachenden Trauersymptomen zeigt. Insbesondere nach einem Verlust aufgrund eines induzierten Spätaborts sollte auf Anzeichen eines stockenden Trauerprozesses geachtet und ggf. niederschwellig eine Trauerbegleitung bei darauf spezialisierten Hebammen, Trauerbegleiter:innen oder Seelsorger:innen angeboten werden. Dabei ist es wichtig, die häufig unterschiedlichen Trauerstile und -prozesse der Elternteile zu beachten, da dies eine grosse Belastung für die Paarbeziehung sein kann.12 Ebenso sollten Geschwisterkinder altersgerecht in den Trauerprozess integriert werden und den Eltern sollte, falls es Hinweise gibt, dass sie mit dieser zusätzlichen Aufgabe aufgrund der eigenen Trauerarbeit überfordert sind, Trauerhilfe für Kinder zur Verfügung gestellt werden. Eine psychologische Unterstützung sollte vor allem dann in Erwägung gezogen werden, wenn sich im Verlauf Hinweise auf eine anhaltende Trauerstörung zeigen und eine spezifische Trauertherapie indiziert ist. Ebenso sollte frühzeitig psychotherapeutische Begleitung erwogen werden, wenn psychische Erkrankungen bei den betroffenen Eltern vorbekannt sind.
Literatur:
1 Kersting A et al.: Complicated grief after traumatic loss: a 14-month follow up study. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2007; 257(8): 437-43 2 Korenromp MJ et al.: Psychological consequences of termination of pregnancy for fetal anomaly: similarities and differences between partners. Prenat Diagn 2005; 25(13): 1226-33 3 Iles S, Gath D: Psychiatric outcome of termination of pregnancy for foetal abnormality. Psychol Med 1993; 23(2): 407-13 4 Hughes P, Riches S: Psychological aspects of perinatal loss. Curr Opin Obstet Gynecol 2003; 15(2): 107-11 5 Janssen HJ et al.: A prospective study of risk factors predicting grief intensity following pregnancy loss. Arch Gen Psychiatry 1997; 54(1): 56-61 6 Kerstind A, Wagner B: Complicated grief after perinatal loss. Dialogues Clin Neurosci 2012; 14(2): 187-94 7 Neugebauer R et al.: Major depressive disorder in the 6 months after miscarriage JAMA 1997; 277(5): 383-8 8 Klier CM et al.: Affective disorders in the aftermath of miscarriage: a comprehensive review. Arch Womens Ment Health 2002; 5(4): 129-49 9 Doka KJ: Disenfranchised grief. Bereavement Care 1999; 18(3): 37-9 10 Korenromp MJ et al.: Adjustment to termination of pregnancy for fetal anomaly: a longitudinal study in women at 4, 8, and 16 months. Am J Obstet Gynecol 2009; 201(2): 160.e1-7 11 Hughes P et al.: Assessment of guidelines for good practice in psychosocial care of mothers after stillbirth: a cohort study. Lancet 2002; 360(9327): 114-8 12 White-van Mourik M: Termination of a second-trimester pregnancy for fetal abnormality: psychosocial aspects. In: Clake A (Hg.): Genetic counselling. Practice and principles. Routledge 2006
Das könnte Sie auch interessieren:
Verbesserung der Ästhetik ohne onkologische Kompromisse
In der Brustchirurgie existiert eine Vielzahl an unterschiedlich komplexen onkoplastischen Operationstechniken mit verschiedenen Klassifikationen. Die kritische Selektion der Patient: ...
Neue Erkenntnisse zur Kolporrhaphie
Die Kolporrhaphie ist eines der etabliertesten chirurgischen Verfahren in der Beckenbodenchirurgie, welches vorrangig zur Behandlung von Beckenorganprolaps (BOP) eingesetzt wird. Die ...
Die Kunst ärztlicher Kommunikation bei Breaking Bad News
Worte haben entscheidende Wirkungen. In Gesprächen mit Patient:innen und Angehörigen gibt es meist eine hohe Erwartungshaltung gegenüber der Ärztin, dem Arzt. Vor allem die Übermittlung ...