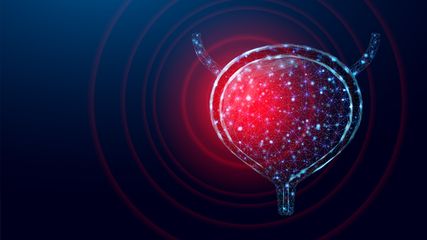©
Getty Images/iStockphoto
Nichtbakterielle Zystitis
Urologik
Autor:
Dr. Felicitas Witte
30
Min. Lesezeit
14.12.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ständige Schmerzen beim Wasserlösen und das Gefühl, immer wieder aufs WC zu müssen: Bei diesen Symptomen denkt man zunächst an eine bakterielle Zystitis. Doch hinter den Beschwerden können auch nichtbakterielle Ursachen stecken. Auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie gab Prof. Dr. Daniela Schultz-Lampel, Direktorin des Kontinenzzentrums am Schwarzwald-Baar-Klinikum im süddeutschen Villingen-Schwenningen, einen prägnanten Überblick über Differenzialdiagnose und Therapie nichtbakterieller Zystitiden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Schmerz und Drang – das sei das, was die Patienten am meisten störe, führte Prof. Dr. Daniela Schultz-Lampel in das Thema ein. Dysurie, Drang, Pollakisurie und Nykturie, ein brennender, stechender Schmerz in Blase und Harnröhre – bei diesen Symptomen denke man meist an eine chronische Zystitis, sagte die Urologin. „Aber auch viele nichtbakterielle Noxen können solche Beschwerden verursachen.“ Das sind zum Beispiel ionisierende Strahlen, Chemotherapeutika (Abb. 1) oder Autoimmunprozesse. Zwei der wichtigsten Differenzialdiagnosen in der Praxis sind die nichtbakterielle Zystitis verursacht durch ionisierende Strahlen und die sogenannte interstitielle Zystitis.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Urologik_Uro_1704_Weblinks_s20_1.jpg" alt="" width="500" /></p> <p>Die Behandlung besteht jeweils aus Therapiebausteinen; die wichtigsten sind bei beiden Diagnosen die gleichen: Medikamente, Blasenspülungen und transurethrale Botulinuminjektionen.<sup>1–3</sup> „In den Leitlinien sind Therapiestufen angegeben“, berichtete Schultz-Lampel, „aber oft kann man nicht stufenweise vorgehen, sondern muss individuell die passenden Bausteine auswählen.“ Es werden zahlreiche Behandlungen empfohlen, wegen nicht ausreichender Daten sind aber evidenzbasierte Empfehlungen schwierig. Bei der interstitiellen Zystitis geeignet zu sein scheint ein multimodaler Therapieansatz mit einer Kombination aus Verhaltenstherapie, Medikamenten und Instillationen.</p> <h2>Therapie der Strahlenzystitis</h2> <p>Bei der Strahlenzystitis wird oralen Glukosaminen und Pentosanpolysulfat ein positiver Effekt nachgesagt, es fehlt jedoch an Evidenz.<sup>4</sup> Für Cranberryprodukte fand sich kein signifikanter Vorteil.<sup>5–7</sup> Eingesetzt werden in der Praxis häufig Antimuskarinika. Helfen konservative Therapieansätze nicht, kommt eine interventionelle oder operative Therapie infrage. Bei einer interstitiellen Zystitis können diverse Medikamente oral eingesetzt werden (Tab. 1). Allen Präparaten ist jedoch gemein, dass sie nicht besonders gut wirken, sie zeigen Erfolgsraten von etwa 50 % . Am besten schneidet Pentosanpolysulfat (PPS) ab.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Urologik_Uro_1704_Weblinks_s20_2.jpg" alt="" width="1417" height="2906" /></p> <p>Eine Instillationstherapie habe den Vorteil, dass man lokal therapiere und Nebenwirkungen vermeide, so Schultz-Lampel. Als Wirkstoffe können diverse Substanzen eingesetzt werden (Tab. 2): Chondroitinsulfat, Hyaluronsodium, Pentosanpolysulfat, Heparin/Lidocain oder Dimethylsulfoxid. Die Evidenzlage überzeugt jedoch nicht. In einer Metaanalyse aus 19 Studien mit insgesamt 801 Patienten waren nur fünf kontrollierte Studien eingeschlossen.<sup>8</sup> Die Beschwerden – gemessen anhand der visuellen analogen Schmerzskala (VAS) – besserten sich in allen Fällen, auch bei den Patienten, die nur Placeboinstillationen bekommen bzw. als Kontrollgruppe gedient hatten. In den fünf kontrollierten Studien waren die VAS-Scores bei den Placebo- bzw. Kontrollpatienten im Schnitt um 0,5 bis 2,1 Punkte und bei den Installationen um bis zu 3,7 Punkte geringer. Auch zur Installationstherapie der Strahlenzystitis sind zahlreiche Substanzen beschrieben, die Evidenzlage ist ebenfalls mäßig. In einer randomisierten klinischen Studie reduzierte Hyaluronsäure im Vergleich zur hyperbaren Oxygenierung Miktionsfrequenz und Schmerzen, allerdings traten häufiger Harnwegsinfektionen auf.<sup>9</sup> In einer nicht randomisierten Studie mit 20 Frauen mit Uterus- oder Zervixkarzinomen hatten diejenigen, die während und nach der Bestrahlung Chondroitinsulfatinstillationen erhalten hatten, weniger Schmerzen, es traten seltener Drangsymptome und Inkontinenz auf.<sup>10</sup> Auch bei Männern mit Prostatakarzinom verbesserte eine Installationstherapie postradiale Beschwerden in der Prostata.<sup>11</sup> Eine weitere Substanz für Instillationen ist Formalin, das vor allem bei hämorrhagischer Strahlenzystitis angewendet wird. Die Erfolgsraten liegen zwischen 70 und 89 % , die Therapie führt aber bei jedem dritten Patienten zu Komplikationen.<sup>12–14</sup> Beschrieben sind Nekrosen und Fistelbildungen der Harnblase und sogar Todesfälle. „Formalin bleibt eine wichtige Option für eine immer weiter blutende Blase“, sagte Schultz-Lampel. „Es braucht jedoch eine enorme Logistik, um Komplikationen zu vermeiden.“</p> <h2>Weitere Therapieoptionen</h2> <p>Aufwendig ist auch die hyperbare Oxygenierung (HBO), die nur wenige Zentren anbieten. Der Patient muss Druckkammer-tauglich sein. Er atmet in der Kammer 100 % igen Sauerstoff ein. Eine Sitzung dauert mindestens 60 Minuten, die Behandlung muss täglich erfolgen, und das über mindestens vier Wochen. Leider sind die meisten Studien retrospektiv. Im Langzeitverlauf wird die Erfolgsrate mit 72–83 % angegeben.<sup>15, 16</sup> Auch bei der HBO treten bei jedem dritten Patienten Nebenwirkungen auf, in der Regel lediglich Ohrenschmerzen.<sup>17</sup></p> <p>Eine weitere Therapieoption bei nichtbakterieller Zystitis stellt die EMDA-Behandlung dar, bei der mithilfe von elektrischem Strom hohe Arzneimittelkonzentrationen in die Blase gebracht werden. Schultz-Lampel hat damit in ihrer Klinik seit 2001 mehr als 300 Patienten behandelt. „Drang und Schmerz gehen deutlich zurück, die Nykturie lässt nach und die Lebensqualität bessert sich bei den meisten Patienten enorm“, fasst die Urologin ihre Ergebnisse zusammen. Die Effekte halten zwei Wochen bis ein Jahr an, echte Heilungen sind die Ausnahme, so Schultz-Lampel.</p> <p>Sowohl bei der interstitiellen als auch der radiogenen Zystitis kann Botulinumtoxin A eingesetzt werden. Es wird in kleinen Portionen in den Detrusor vesicae injiziert. Bei der interstitiellen Zystitis konnte Botulinumtoxin Schmerzen reduzieren und die Blasenkapazität erhöhen,<sup>18</sup> allerdings wurden nur 60 Patienten untersucht. In einer anderen Studie sprachen die Patienten nicht oder nicht genügend darauf an. „Bei der Strahlenzystitis sind die Ergebnisse deutlich besser“, berichtete Schultz-Lampel. So nahm die Blasenkapazität bei Patienten mit Radio- und Chemozystitis deutlich zu und die Urinfrequenz ließ nach, allerdings war auch diese Studie mit sechs Patienten sehr klein.<sup>20</sup></p> <p>Lassen sich in der Zystoskopie Hunner-Läsionen nachweisen, kann man koagulieren oder mit dem Laser behandeln. Dies führte bei mehr als 90 % der Patienten für ein bis drei Jahre zu einer Verbesserung der Beschwerden.<sup>21</sup> Nach Ausschöpfung aller konservativen medikamentösen und minimal invasiven Verfahren kann eine Zystektomie mit Harnableitung die Lebensqualität verbessern.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Vortrag „Chance für Patienten: Zertifizierte Zentren für Interstitielle Cystitis und Beckenschmerz“, 69. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Urologie, 20.–23. September 2017, Dresden
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Mühlstädt S et al.: Radiation cystitis: pathophysiology and treatment. Urologe 2017; 56: 301-5 <strong>2</strong> Gonsior A et al.: Interstitial cystitis: diagnosis and pharmacological and surgical therapy. Urologe 2017; 56: 811-27 <strong>3</strong> Engeler D et al.: EAU-guidelines on chronic pelvic pain 2016. http://uroweb.org/guideline/chronic-pelvic-pain/ <strong>4</strong> Denton AS et al.: Non-surgical interventions for late radiation cystitis in patients who have received radical radiotherapy to the pelvis. Cochrane Database Syst Rev 2002; 3: CD001773 (doi:10.1002/ 14651858.cd001773) <strong>5</strong> Campbell G et al.: A randomised trial of cranberry versus apple juice in the management of urinary symptoms during external beam radiation therapy for prostate cancer. Clin Oncol 2013; 15: 322-8 <strong>6</strong> Cowan CC et al.: A randomised double-blind placebo-controlled trial to determine the effect of cranberry juice on decreasing the incidence of urinary symptoms and urinary tract infections in patients undergoing radiotherapy for cancer of the bladder or cervix. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2012; 24: e31-8 <strong>7</strong> Hamilton K et al.: Standardized cranberry capsules for radiation cystitis in prostate cancer patients in New Zealand: a randomized double blinded, placebo controlled pilot study. Support Care Cancer 2015; 23: 95-102 <strong>8</strong> Barua JM et al.: A systematic review and meta-analysis on the efficacy of intravesical therapy for bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Int Urogynecol J 2016; 27: 1137-47 <strong>9</strong> Shao Y et al.: Comparison of intravesical hyaluronic acid instillation and hyperbaric oxygen in the treatment of radiation-induced hemorrhagic cystitis. BJU Int 2012; 109: 691-4 <strong>10</strong> Hazewinkel MH et al.: Prophylactic vesical instillations with 0.2 % chondroitin sulfate may reduce symptoms of acute radiation cystitis in patients undergoing radiotherapy for gynecological malignancies. Int Urogynecol J 2011; 22: 725-30 <strong>11</strong> Gacci M et al.: Bladder instillation therapy with hyaluronic acid and chondroitin sulfate improves symptoms of postradiation cystitis: prospective pilot study. Clin Genitourin Cancer 2016; 14: 444-9 <strong>12</strong> Dewan AK et al.: Intravesical formalin for hemorrhagic cystitis following irradiation of cancer of the cervix. Int J Gynaecol Obstet 1993; 42: 131-5 <strong>13</strong> Likourinas M et al.: Intravesical formalin for the control of intractable bladder haemorrhage secondary to radiation cystitis or bladder cancer. Urol Res 1979; 7: 125-6 <strong>14</strong> Lojanapiwat B et al.: Intravesicle formalin in­stillation with a modified technique for controlling haemorrhage secondary to radiation cystitis. Asian J Surg 2002; 25: 232-5 <strong>15</strong> Dellis A et al.: Is there a role for hyberbaric oxygen as primary treatment for grade IV radiation-induced haemorrhagic cystitis? A prospective pilot-feasibility study and review of literature. Int Braz J Urol 2014; 40: 296-305<strong>16</strong> Oliai C et al.: Hyperbaric oxygen therapy for radiation-induced cystitis and proctitis. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2012; 84: 733-40<strong>17</strong> Nakada T et al.: Hyperbaric oxygen therapy for radiation cystitis in patients with prostate cancer: a long-term follow-up study. Urol Int 2012; 89: 208-14 <strong>18</strong> Kuo H-C et al.: Intravesical botulinum toxin-A injections reduce bladder pain of interstitial cystitis/bladder pain syndrome refractory to conventional treatment - a prospective, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Neurourol Urodyn 2016; 35: 609-14 <strong>19</strong> Lee C-L et al.: Intravesical botulinum toxin a injections do not benefit patients with ulcer type interstitial cystitis. Pain Physician 2013; 16: 109-16 <strong>20</strong> Chuang YC et al.: Bladder botulinum toxin A injection can benefit patients with radiation and chemical cystitis. BJU Int 2008; 102: 704-6 <strong>21</strong> Payne RA et al.: Endoscopic ablation of Hunner’s lesions in interstitial cystitis patients. Can Urol Ass J 2009; 3: 473-7</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Historische Momente aus Wiener urologischen Abteilungen
Der 51. Österreichische Urologenkongress in der Messe Wien vom 22. bis 25.5.2025, veranstaltet zusammen mit der bayrischen Schwestergesellschaft, fokussierte nicht nur wichtige ...
Zytoreduktive Nephrektomie im Jahr 2025 – ein evidenzfreier Raum?
Die zytoreduktive Nephrektomie (CN) ist heutzutage weiterhin ein fester Bestandteil der Therapie des metastasierten Nierenzellkarzinoms (mRCC). Doch ob und wann ein Patient einer CN ...
Blasenerhalt trotz BCG-Versagen bei High-Risk-Tumoren: intravesikale Strategien heute und morgen
Standard bei BCG-Versagen beim nichtmuskelinvasiven Blasenkarzinom ist die radikale Zystektomie. Alternativen mit Gemcitabin oder Mitomycin sind onkologisch unterlegen. Neue Ansätze wie ...