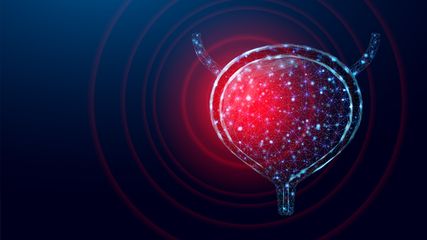<p class="article-intro">Das Miktionszystourethrogramm (MCUG) ist Standard in der Abklärung nach fieberhaften Harnwegsinfekten (HWI) bei pädiatrischen Patienten und sollte laut den aktuellen EAU/ESPUGuidelines bis auf wenige Ausnahmen nach jedem gesicherten ersten fieberhaften Harnwegsinfekt im Kindesalter durchgeführt werden. Bei einer Subgruppe von Kindern mit falsch negativem MCUG besteht dennoch ein erhöhtes Risiko für weitere Harnwegsinfekte. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit möglichen weiteren Maßnahmen in dieser Patientengruppe.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Nach fieberhaften Harnwegsinfekten ist ein MCUG bei 10–20 % der Patienten falsch negativ.4 Diese Patientengruppe mit okkultem VUR ist besonders gefährdet und ein „übersehener“ VUR in Kombination mit rezidivierenden fieberhaften HWI kann schwerwiegende Folgen haben.</li> <li>Weitere Untersuchungen sind bei nachfolgenden Harnwegsinfekten, aber auch bei zusätzlichen Risikofaktoren nach individueller Indikation sinnvoll.</li> <li>Eine differenzierte Aufklärung der Eltern bezüglich der Wertigkeit einer negativen MCUGUntersuchung ist wesentlich für die Vermeidung unnötiger Morbidität.</li> </ul> </div> <h2>Einleitung</h2> <p>Harnwegsinfekte sind als die häufigste bakterielle fieberhafte Erkrankung im Kindesalter verantwortlich für 5–8 % aller hochfieberhaften Zustandsbilder im ersten Lebensjahr.<sup>1</sup> Fieberhafte HWI sind nicht nur mit einer hohen Morbidität verbunden, sondern können, vor allem wenn sie rezidivierend auftreten, Ursache für Nierennarben und einen irreversiblen Nierenfunktionsverlust sein. Die am häufigsten mit rezidivierenden HWI assoziierte Fehlbildung ist der vesikoureterale Reflux (VUR). Dieser ist mit einer geschätzten Inzidenz von 0,4–1,8 % bei nicht symptomatischen Kindern eine häufige urogenitale Anomalie.<sup>2</sup> Bei Kindern, bei denen nach einem fieberhaften Harnwegsinfekt ein Miktionszystourethrogramm durchgeführt wird, ist – je nach Alter des Kindes und Anzahl der Infekte – in ca. 30(–70) % ein VUR nachweisbar,<sup>3, 4</sup> die Rate an negativen MCUG ist somit sehr hoch.<br /> Das MCUG kann jedoch falsch negativ sein und ein vorliegender VUR nicht dargestellt werden, also okkult sein. Kinder mit okkultem VUR sind besonders gefährdet, da sich die Eltern bei fehlendem Bewusstsein dieser Möglichkeit in falscher Sicherheit wiegen und weitere Harnwegsinfekte mitunter gar nicht diagnostiziert und wenn, dann eventuell nicht weiter abgeklärt werden. Die Schwierigkeit liegt nun darin, zu entscheiden, welche Kinder bei Harnwegsinfekten und negativem MCUG keine weitere Abklärung brauchen und bei welchen Kindern ein okkulter VUR oder eine andere nicht sicher mit dem MCUG diagnostizierbare Veränderung, die das Risiko für weitere Probleme beeinflussen könnte, vorliegt.<br /> Ziel ist es, jene Kinder, die ein erhöhtes Risiko für weitere Harnwegsinfekte und einen möglichen Nierenfunktionsverlust haben, rasch und zuverlässig zu identifizieren und gleichzeitig möglichst viel unnötige invasive Diagnostik zu verhindern.<br /> Dieser Artikel beschäftigt sich mit der interessanten Frage nach den Konsequenzen eines negativen MCUG – nicht nur in Hinblick auf den okkulten VUR, sondern auch bezogen auf technische Aspekte der Durchführung des MCUG, mögliche Alternativen und die Frage nach einer ergänzenden DMSA-Szintigrafie.</p> <h2>MCUG</h2> <p>Das MCUG ist nach wie vor trotz Invasivität und Strahlenbelastung – auch wenn diese sehr gering ist – der Goldstandard zur Diagnose bzw. zum Ausschluss eines VUR im Kindesalter.<br /> Der VUR ist jedoch per se ein intermittierendes Phänomen und kann oft nicht während der kurzen Untersuchungszeit dargestellt werden. Die Sensitivität des MCUG wird weiter vermindert durch technische Einflussfaktoren wie eine möglicherweise nicht ausreichende Blasenfüllung (gerade bei Kindern mit VUR liegt die Blasenkapazität deutlich höher als altersabhängig zu erwarten), durch die Verwendung von nicht vorgewärmtem Kontrastmittel, die Durchführung von zu wenigen Füllungen (dies ist v.a. bei kleinen Kindern von Bedeutung) und stark dilatierte Harnleiter, bei denen durch einen Verdünnungseffekt des Kontrastmittels ein vorliegender VUR möglicherweise nicht dargestellt werden kann. Gerade bei älteren Kindern ist das MCUG oft weniger aussagekräftig: Eine Miktion während der Untersuchung ist häufig nicht möglich, bei älteren Mädchen ist der Miktionsdruck unter Untersuchungsbedingungen möglicherweise nicht ausreichend, um einen vorliegenden VUR darstellen zu können, und natürlich ist auch die Compliance der jungen Patienten ein Faktor, der die Sensitivität des MCUG beeinflussen kann.<br /> Wichtig ist zunächst die Suche nach Risikofaktoren: Hierzu dienen die Anamnese (Alter, Geschlecht, Anzahl der bislang aufgetretenen fieberhaften Harnwegsinfekte, Familienanamnese ...) sowie sonografische Kriterien: Das Vorliegen einer Hydronephrose, eines Megaureters, einer Nierenbeckenwandverdickung oder eines Doppelhohlsystems kann ein Hinweis auf das Vorliegen eines VUR sein. Die größte Bedeutung in der weiteren Abklärung hat definitiv die DMSA-Szintigrafie.</p> <h2>DMSA-Szintigrafie</h2> <p>Die DMSA-Szintigrafie ist der Goldstandard zur Detektion von akuten pyelonephritischen Veränderungen sowie von Nierennarben bei Kindern und kann in der Regel ambulant und ohne Sedierung durchgeführt werden. Die Strahlenbelastung liegt bei ca. 1mSv. Etwa die Hälfte der akuten pyelonephritischen Veränderungen bleibt als Nierennarbe bestehen und bedeutet einen Nierenfunktionsverlust für den jungen Patienten. Bei der Erstabklärung von Kindern mit febrilen HWI bestehen bei etwa 40 % bereits irreversible Nierenschäden.<sup>5</sup> Es konnte gezeigt werden, dass neue Nierennarben in jedem Alter und bereits nach einem einzigen kurzen fieberhaften HWI auftreten können.<sup>6, 7</sup> Sowohl akute DMSA-Veränderungen als auch persistierende postpyelonephritische Veränderungen korrelieren stark mit dem Vorhandensein eines (hochgradigen) VUR und mit dem Risiko für weitere Durchbruchsinfekte.<sup>8</sup> Bei bis zu der Hälfte der Kinder mit DMSA-Veränderungen kann aber kein VUR nachgewiesen werden.<br /> DMSA-Veränderungen bei Kindern mit fieberhaften Harnwegsinfekten und negativem MCUG können somit ein Hinweis auf einen okkulten VUR sein (Abb. 1). Diese Kinder bedürfen eines genauen Followups und ggf. – insbesondere bei weiteren HWI – sollte eine weiterführende Diagnostik erfolgen. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten:</p> <h2>Sono-MCUG</h2> <p>Das Sono-MCUG wurde 1998 erstmals beschrieben.<sup>9</sup> Mittels transurethralen Katheters wird ein Sono-Kontrastmittel mit Schwefelhexafluorid-Mikrobläschen (SonoVue<sup>®</sup>) in die Blase instilliert, sowohl während der Füllung als auch während der Miktion können Blase und Nieren kontinuierlich sonografiert und auf das Vorliegen eines VUR gescannt werden. Im Vergleich zum konventionellen MCUG ist die Sensitivität des Sono-MCUG höher,<sup>10</sup> ein Vorteil ergibt sich vor allem bei ausgeprägt dilatierten Ureteren und Nierenbecken, da auch einzelne „microbubbles“ nachgewiesen werden können, während beim konventionellen MCUG ein Verdünnungseffekt den Nachweis eines VUR erschweren oder unmöglich machen kann (Abb. 2).<br /> Das Sono-MCUG ist geeignet zur Erstabklärung von Mädchen (eine Darstellung der Harnröhre ist nur erschwert möglich), zum Follow-up von Jungen und Mädchen und ggf. bei negativem konventionellem MCUG, v.a. bei Megaureteren.</p> <h2>PIC -Zystogramm („positioning instillation of contrast“)</h2> <p>Die Technik wurde erstmals 2003 von Rubenstein beschrieben.<sup>11</sup> In Narkose erfolgt eine Zystoskopie und nach Entleerung der Blase eine Kontrastmittelirrigation direkt vor den Harnleiterostien. Zeigt sich in der danach durchgeführten Durchleuchtung ein sogenannter PIC-VUR, kann dieser gleich mittels endoskopischer Ostienunterspritzung therapiert werden. Weiters kann während der Zystoskopie die Aufspülbarkeit der Harnleiterostien beurteilt werden. Diese kann nach der HITKlassifikation von Grad 0 bis Grad 3 eingeteilt werden und korreliert mit dem Grad des PIC-VUR (Tab. 1).<sup>12</sup> In der Arbeit von Rubenstein konnte bei allen Kindern, die rezidivierende Harnwegsinfekte und ein negatives MCUG hatten, ein PIC-VUR nachgewiesen werden. Der Grad des PICVUR korreliert signifikant mit dem Schweregrad von ipsilateralen DMSA-Veränderungen,<sup>13</sup> außerdem konnte gezeigt werden, dass die endoskopische Therapie eines PIC-VUR die Rate an Harnwegsinfekten deutlich senken kann.<sup>14</sup><br /> Der Nachteil liegt in der Notwendigkeit einer Allgemeinnarkose, daher ist eine genaue Indikationsstellung unumgänglich.</p> <h2>Harnröhrenklappe</h2> <p>Das MCUG wird nicht nur zur Diagnose eines VUR verwendet, auch die männliche Harnröhre kann beim Verdacht auf eine posteriore Harnröhrenklappe dargestellt werden. Besonders bei Jungen mit unilateralem, höhergradigem VUR (sog. VURDSyndrom, „posterior urethral valves, unilateral vesicoureteral reflux and renal dysplasia“) und/oder einer unilateral kleineren Niere (sog. „Pop-off“-Niere) ist die Harnröhrenklappe immer eine wesentliche Differenzialdiagnose, die den weiteren Verlauf entscheidend beeinflusst. Das MCUG eignet sich jedoch nicht zum sicheren Ausschluss einer Harnröhrenklappe, selbst bei unauffälliger Harnröhrendarstellung können endoskopisch eindeutige und urodynamisch hochrelevante Klappen vorhanden sein (Abb. 3). Indirekte Zeichen einer Harnröhrenklappe im MCUG können eine trabekuliert erscheinende Blase, eine Blasenhalshypertrophie sowie ein hypertrophierter M. interuretericus sein. Die letztlich einzige sichere Möglichkeit, eine Harnröhrenklappe auszuschließen bzw. zu diagnostizieren und zu behandeln, besteht in einer Urethrozystoskopie.</p> <h2>Indikationen zur weiteren Abklärung nach negativem MCUG:</h2> <ul> <li>weitere fieberhafte Harnwegsinfekte</li> <li>Hochrisikopatienten</li> <li>Z.n. Urosepsis</li> <li>bekannte urogenitale Fehlbildung (z.B. Hydronephrose, Megaureter, Ureterozele)</li> <li>weitere „Verdachtsmomente“ wie zum Beispiel Veränderungen in der DMSA-Szintigrafie, Nierenbeckenwandverdickung, Harnleiterdilatation, Doppelhohlsysteme oder ein wenig aussagekräftiges MCUG</li> </ul> <h2><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Urologik_Uro_1802_Weblinks_urologik_1802_s37_abb1+tab1.jpg" alt="" width="1416" height="1016" /></h2> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2018_Urologik_Uro_1802_Weblinks_urologik_1802_s38_abb2+3.jpg" alt="" width="1419" height="2178" /></p> <h2>Zusammenfassung</h2> <p>Die Abklärung von Kindern mit fieberhaften Harnwegsinfekten ist nach wie vor nicht einheitlich. Beim Auftreten weiterer fieberhafter Harnwegsinfekte oder beim Vorhandensein anderer Verdachtsmomente nach primär negativem MCUG sollte an die Möglichkeit eines okkulten VUR gedacht werden und nach genauer Abwägung ggf. eine weitere Diagnostik erfolgen. Wichtig ist auch eine differenzierte Aufklärung der Eltern: Bei Fieber sollte nach wie vor rasch eine Urinuntersuchung durchgeführt werden und beim Auftreten weiterer Harnwegsinfekte eine Wiedervorstellung beim Kinderurologen erfolgen. Zur weiteren Abklärung dienen in erster Linie DMSA-Szintigrafie, Sono-MCUG und PIC-Zystogramm, wobei die Entscheidung hierzu stets individuell getroffen werden muss.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Shaikh N et al.: Prevalence of urinary tract infection in childhood. Pediatr Infect Dis J 2008; 27: 302-8 <strong>2</strong> Bailey R: Vesicoureteric reflux in healthy infants and children. Hodson J, Kincaid-Smith P: Reflux Nephropathy. New York: Masson, 1979. 59-61 <strong>3</strong> Jacobson SH et al.: Vesicoureteric reflux: occurrence and long-term risks. Acta Paediatr Suppl 1999; 133: 22-30 <strong>4</strong> Kass EJ et al.: Paediatric urinary tract infection and the necessity of complete urological imaging. BJU Int 2000; 86: 94-6 <strong>5</strong> Downs SM: Technical report: urinary tract infections in febrile infants and young children. The Urinary Tract Subcommittee of the American Academy of Pediatrics Committee on Quality Improvement. Pediatrics 1999; 103: e54 <strong>6</strong> Ransley PG, Risdon RA: Reflux nephropathy: effects of antimicrobial therapy on the evolution of the early pyelonephritic scar. Kidney Int 1981; 20: 733-42 <strong>7</strong> Coulthard MG, Keir MJ: Reflux nephropathy in kidney transplants, demonstrated by dimercaptosuccinic acid scanning. Transplantation 2006; 82: 205-10 <strong>8</strong> Zhang X et al.: Accuracy of early DMSA scan for VUR in young children with febrile UTI. Pediatrics 2014; 133: e30-8 <strong>9</strong> Bosio M: Cystosonography with echocontrast: a new imaging modality to detect vesicoureteric reflux in children. Pediatr Radiol 1998; 28: 250-5 <strong>10</strong> Darge K: Voiding urosonography with US contrast agents for the diagnosis of vesicoureteric reflux in children: II. Comparison with radiological examinations. Pediatr Radiol 2008; 38: 54-63 <strong>11</strong> Rubenstein JN et al.: The PIC cystogram: a novel approach to identify „occult“ vesicoureteral reflux in children with febrile urinary tract infections. J Urol 2003; 169: 2339-43 <strong>12</strong> Kirsch AJ et al.: Dynamic hydrodistention of the ureteral orifice: a novel grading system with high interobserver concordance and correlation with vesicoureteral reflux grade. J Urol 2009; 182: 1688-92 <strong>13</strong> Berger C et al.: Positioning irrigation of contrast cystography for diagnosis of occult vesicoureteric reflux: association with technetium- 99m dimercaptosuccinic acid scans. J Pediatr Urol 2013; 9: 846-50 <strong>14</strong> Hagerty J et al.: Treatment of occult reflux lowers the incidence rate of pediatric febrile urinary tract infection. Urology 2008; 72: 72-6</p>
</div>
</p>