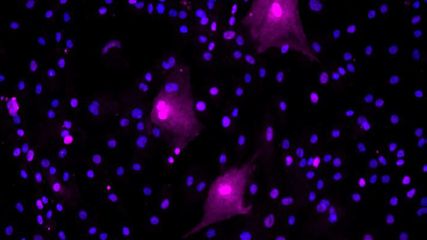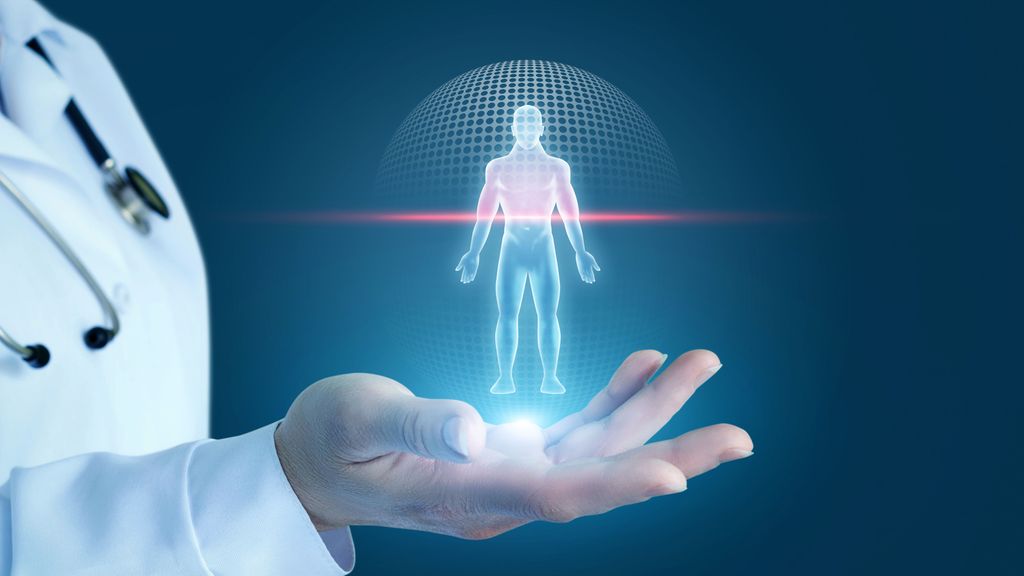
©
Getty Images/iStockphoto
Regelmässig und richtig screenen, adäquat behandeln und Antirheumatika anpassen
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
07.03.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Immer wieder war es auf Rheumakongressen in der letzten Zeit zu hören: Bei rheumatoider Arthritis darf man die Komorbiditäten nicht vergessen. Man müsse regelmässig und systematisch danach suchen, so der Rheumatologe Prof. Krüger aus München, sie konsequent behandeln und gegebenenfalls die antirheumatische Therapie anpassen. Beim Screening helfen kann eine Checkliste der Europäischen Rheumaliga, EULAR.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Rheumatoide Arthritis (RA) befällt zwar vor allem die Gelenke, aber direkt oder indirekt auch andere Bereiche des Körpers. So kommen beispielsweise Infektionen<sup>1, 2</sup> und bestimmte Arten von Krebs3 bei Patienten mit RA häufiger vor, und kardiovaskuläre Krankheiten<sup>4, 5</sup> werden bis zu zweimal so oft beobachtet wie bei der Normalbevölkerung. Dass die Patienten früher sterben, scheint zu einem grossen Teil durch diese Komorbiditäten bedingt zu sein, vor allem durch kardiovaskuläre Krankheiten.<sup>4</sup> Experten vermuten, dass die Komorbiditäten eine Konsequenz der ständigen Entzündung sind.<sup>6, 7</sup></p> <h2>Die 6 wichtigsten Komorbiditäten</h2> <p>Biologika können zwar die Krankheitsaktivität deutlich senken und die Funktion verbessern, doch Komorbiditäten seien nach wie vor ein besonderes Problem, so eine Expertengruppe der Europäischen Rheumaliga, EULAR:<sup>8</sup> Bei chronisch entzündlichen/ rheumatischen Krankheiten wie RA werde nach Komorbiditäten nicht genügend gescreent, es gebe zu wenig Präventionsmassnahmen und bestehende Komorbiditäten würden nicht genügend therapiert, so das Fazit der Experten. Die Gruppe hat deshalb 6 Komorbiditäten definiert, auf die man in der Routineversorgung systematisch screenen sollte: Infektionen, kardiovaskuläre Erkrankungen, bösartige Tumoren, gastrointestinale Krankheiten, Osteoporose und Depressionen. Ihre Empfehlungen teilte die EULAR wie üblich in übergreifende Prinzipien und einzelne «Punkte, an die man denken sollte » (Tab. 1). Die Empfehlungen gelten nicht nur für RA, sondern auch für andere chronisch entzündliche/rheumatische Krankheiten wie Morbus Bechterew, autoimmune Bindegewebserkrankungen oder Kristallarthropathien.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1901_Weblinks_lo_ortho_1901_s54_tab1_witte.jpg" alt="" width="800" height="1053" /></p> <h2>Checkliste zur Entdeckung von Komorbiditäten</h2> <p>Komorbiditäten sollten sorgfältig bestimmt und behandelt werden, so das erste Prinzip.<sup>8</sup> Alle an der Behandlung Beteiligten – inklusive Patient – sind wichtig, um die Komorbiditäten zu entdecken (Prinzip B), und die Komorbiditäten sollten systematisch regelmässig erhoben werden (Prinzip C). Für die Praxis hat die EULAR-Arbeitsgruppe ein Formular erstellt, in das man alle erforderlichen Daten eintragen kann. Diesen Bogen könnte auch das Pflegepersonal ausfüllen. Das Dokument besteht aus 93 Fragen, ist auf Englisch und online als ergänzender Inhalt zum Artikel<sup>8</sup> erhältlich.<br /> Daten zu anderen Komorbiditäten wie Fatigue, Fibromyalgie oder wiederholten nicht opportunistischen, nicht ernsthaften Infektionen zu sammeln wäre auch wichtig, räumen die EULAR-Autoren ein. Doch das hätte das Formular, das ja jetzt schon umfangreich ist, gesprengt. Die Experten entschlossen sich zudem, manche Komorbiditäten aus den «Punkten, an die man denken sollte» herauszunehmen, weil nicht klar sei, wie effektiv ein Screening darauf sei. Dies betrifft zum Beispiel Prostatakrebs oder Divertikulitis. Falsch positive Ergebnisse könnten zu Angst beim Patienten und Überbehandlungen führen und die Gesundheitsausgaben unnötig erhöhen.<br /> Systematisch nach Komorbiditäten zu screenen, so schätzen die EULAR-Autoren, könnte bis zu einer Stunde dauern, insbesondere wenn man es zum ersten Mal macht. Die darauf folgenden Untersuchungen gehen dann aber schneller vonstatten, vor allem wenn man die bisher erhobenen Daten idealerweise elektronisch sauber dokumentiert hat.<br /> «Hat man erst einmal die Komorbiditäten beziehungsweise Risikofaktoren entdeckt, ist schon ein grosser Schritt getan», sagt Prof. Dr. med. Klaus Krüger, Ludwig- Maximilians-Universität, München. «Dann gilt es, die Begleitkrankheiten auch korrekt zu behandeln, damit sie nicht noch schlimmer werden.»</p> <h2>TNF-Hemmer senken das kardiovaskuläre Risiko</h2> <p>Besonderes Augenmerk solle man auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen legen, denn diese tragen zu einem erheblichen Teil zur erhöhten Mortalität bei. «Das Risiko lässt sich aber deutlich senken, wenn es gelingt, die entzündliche Krankheitsaktivität zu reduzieren beziehungsweise zu eliminieren », sagt Krüger. Der intensivste Effekt ist für TNF-α-Inhibitoren belegt. Das Risiko lässt sich damit je nach Studie um zwischen 30 und 70 % verringern.<sup>9</sup> Zu beachten ist dabei, dass TNF-α-Hemmer bei höhergradiger Herzinsuffizienz, also NYHA 3 oder 4, als kontraindiziert gelten. «Diese Kontraindikation kann man aber anzweifeln », sagt Krüger. «Denn sie beruht nur auf einer einzigen Studie von 2003,<sup>10</sup> in der Infliximab in Überdosis bei herzinsuffizienten Patienten zu einem ungünstigen Verlauf führte.» Vermutlich wirken auch die nicht TNF-α-basierten bDMARDs kardioprotektiv, dies ist allerdings noch nicht gut untersucht.<br /> Hydroxychloroquin hat eine eher schwache entzündungshemmende Wirkung, kann aber über Lipidsenkung, Regulierung des Glukosestoffwechsels und Blutdrucksenkung ebenfalls Herz und Gefässe schützen.<sup>11</sup> Von den sonstigen konventionell- synthetischen DMARDs wurde ein risikoreduzierender Effekt bisher nur für Methotrexat gezeigt.<sup>9</sup> Aufmerksam Herz und Gefässe im Blick haben sollte man bei einer Behandlung mit nichtsteroidalen Antiphlogistika (NSAR) und Kortison. «Unter NSAR ist das erhöhte kardiovaskuläre Risiko entgegen früheren Ansichten allerdings überschaubar», sagt Krüger. In einer Metaanalyse aus 754 Studien ging eine NSAR-Behandlung im Vergleich zur Nichteinnahme mit einem relativen Risiko von 1,37 bis 1,44 einher – das entspricht einer Rate von drei NSAR-bedingten kardiovaskulären Ereignissen pro 1000 Patientenjahre.<sup>12</sup> «Will man NSAR verschreiben, muss man aber beachten, dass bei Herzinfarkt, Schlaganfall oder einer koronaren Herzerkrankung in der Anamnese eine Kontraindikation für Coxibe besteht», so Krüger.<br /> Die Langzeit-Glukokortikoidgabe geht indes im Vergleich zu NSAR mit einem deutlich erhöhten kardiovaskulären Risiko einher, vor allem ab einer Tagesdosis von 5 mg. Die ursprüngliche Annahme, dies sei durch ein Studien-Bias bedingt, nämlich dass vor allem Patienten mit schwererer RA und entsprechend erhöhtem kardiovaskulärem Risiko einer Glukokortikoidtherapie unterzogen wurden, wurde durch neuere Studien widerlegt.<sup>9</sup> Natürlich müssen ein Diabetes mellitus, eine arterielle Hypertonie und andere Risikofaktoren, die per se zu einem erhöhten kardiovaskulären Risiko führen, adäquat und konsequent behandelt werden. Hierzu gehört zum Beispiel auch, den Patienten zu körperlicher Bewegung anzuregen, seine Lipide im Blick zu haben und ihm vorzuschlagen, mit dem Rauchen aufzuhören.</p> <h2>Besonderes Vorgehen bei interstitieller Lungenerkrankung</h2> <p>Ein Problem, das die EULAR-Autoren offenbar in ihrer Empfehlung vernachlässigt haben, sind interstitielle Lungenerkrankungen. «Sie sind die einzige Systemmanifestation der RA mit unverändert zunehmender Häufigkeit und schlechter Prognose», sagt Krüger. Die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei 60 % .<sup>13</sup> Rituximab und Abatacept könnten sich möglicherweise positiv auf den Verlauf der Lungenkrankheit auswirken.<sup>14</sup> Unter einer Therapie mit TNF-α-Hemmern wurden sowohl Verschlechterungen als auch Verbesserungen der Lungenkrankheit beobachtet. Methotrexat wurde früher wegen eines möglichen erhöhten Risikos einer allergischen Alveolitis als kontraindiziert betrachtet. «Inzwischen wissen wir aber, dass Methotrexat die Prognose der Lungenkrankheit verbessert », so Krüger. Als optimale Behandlungsmöglichkeiten bei RA und interstitieller Lungenkrankheit bieten sich somit die Kombinationen Abatacept + Methotrexat oder Rituximab + Methotrexat an.<br /> Hat der Patient eine Niereninsuffizienz, muss man bei der Verschreibung von Antirheumatika aufmerksam sein. So muss etwa die Dosis von Methotrexat und Sulfasalazin ab einer GFR von weniger als 60 ml/min halbiert werden, und ab einer GFR von weniger als 30 ml/min sind die Präparate kontraindiziert. «Es stehen aber selbst bei starker Niereninsuffizienz genügend Alternativen zur Verfügung», sagt Krüger. So sind beispielsweise bei den Biologika keine Einschränkungen bekannt, allerdings weisen die Hersteller in der Fachinformation darauf hin, dass hierzu Untersuchungen fehlen (Tab. 2).<br /> Noch einige Komorbiditäten gilt es zu beachten. Wie man dabei vorgeht, lässt sich gut in einer Übersichtsarbeit der Canadian Dermatology-Rheumatology Comorbidity Initiative nachlesen.<sup>15</sup> Hier geht es nicht nur um das Vorgehen bei RA, sondern auch bei Psoriasis und Psoriasisarthritis. 407 Artikel identifizierte die Arbeitsgruppe und teilte ihre Empfehlungen in 19 Kapitel ein, in denen detailliert das jeweilige Vorgehen beschrieben ist. «Wer RA-Patienten behandelt, muss immer die Komorbiditäten im Blick haben, denn in 80 % der Fälle liegen solche vor», so das Fazit von Krüger. «Man muss systematisch und regelmässig danach suchen, adäquat therapieren und gegebenenfalls die Antirheumatika anpassen – dann hat der Patient die Chance, dass er ähnlich lange lebt wie jemand ohne RA.»</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Ortho_1901_Weblinks_lo_ortho_1901_s55_tab2_witte.jpg" alt="" width="550" height="500" /></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Doran MF et al.: Arthritis Rheum 2002; 46(9): 2294-300 <strong>2</strong> Keyser FD: Curr Rheumatol Rev 2011; 7(1): 77-87 <strong>3</strong> Wolfe F, Michaud K: Arthritis Rheum 2004; 50(6): 1740-51 <strong>4</strong> Avina-Zubieta JA et al.: Ann Rheum Dis 2012; 71(9): 1524-9 <strong>5</strong> del Rincon ID et al.: Arthritis Rheum 2001; 44(12): 2737-45 <strong>6</strong> Greenberg JD et al.: Nat Rev Rheumatol 2012; 8(1): 13-21 <strong>7</strong> Baecklund E et al.: BMJ 1998; 317(7152): 180-1 <strong>8</strong> Baillet A et al.: Ann Rheum Dis 2016; 75(6): 965-73 <strong>9</strong> Krüger K: Z Rheumatol 2016; 75: 173-80 <strong>10</strong> Chung ES et al.: Circulation 2003; 107: 3133-40 <strong>11</strong> Rempenault C et al.: Ann Rheum Dis 2018; 77: 98-103 <strong>12</strong> Coxib and traditional NSAID Trialists’ (CNT) Collaboration, Bhala N et al.: Lancet 2013; 382: 769-79 <strong>13</strong> Hyldgaard C et al.: Ann Rheum Dis 2017; 76: 1700-6 <strong>14</strong> Johnson C et al.: Curr Opin Rheumatol 2017; 29: 254-9 <strong>15</strong> Roubille C et al.: J Rheumatol 2015; 42 (10): 1767-80</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...