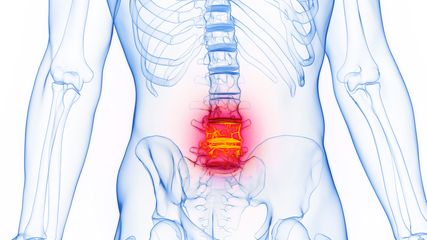©
Getty Images/iStockphoto
Kongress-News aus Spanien
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
26.09.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Madrid war dieses Jahr der Tagungsort des grössten europäischen Rheumatologiekongresses. Vom 12. bis 15 Juni fanden sich internationale Experten zum Informationsaustausch über die neuesten Fortschritte in Forschung und Therapie ein.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>DNA-Methylierung ist bei Psoriasispatienten mit der Entwicklung einer PsA assoziiert: Etwa 4 Jahre vor der PsA-Diagnose kam es zu typischen Veränderungen der Erbsubstanz.</li> <li>Der selektive JAK1-Hemmer Filgotinib überzeugte in der FINCH-1-Studie bei Patienten mit RA.</li> <li>Patienten, die an CED oder Typ-1-Diabetes leiden, haben ein signifikant erhöhtes Risiko, auch an RA zu erkranken.</li> <li>Bei RA-Patienten, die auf Tocilizumab ansprechen, können systemische Kortikosteroide ohne klinisch relevante Konsequenzen ausgeschlichen werden.</li> <li>Patienten, die TNF-α-Blocker einnehmen, sprechen gut auf eine Grippeimpfung an und profitieren sogar sehr viel mehr vom Impfschutz als Gesunde.</li> <li>Der Tyrosinkinasehemmer Nintedanib kann den Verlust der Lungenfunktion bei Patienten mit SSc und damit assoziierter ILD bremsen.</li> </ul> </div> <h2>Risikomarker für PsA</h2> <p>Ungefähr ein Drittel aller Psoriasispatienten wird im Laufe des Lebens eine Psoriasisarthritis (PsA) entwickeln, häufig in den ersten 10 Jahren nach Diagnosestellung. Das Zusammenspiel zwischen Umwelt, Genetik und Epigenetik ist bisher nur rudimentär verstanden, es wird jedoch vermutet, dass epigenetische Prozesse darüber entscheiden, welche Psoriasispatienten eine PsA entwickeln werden. Eine epigenetische Deregulierung auf Ebene der DNA-Methylierung ereignet sich sehr früh bei der PsA-Pathogenese, noch vor dem Auftreten klinischer Symptome, und könnte daher als Biomarker für die Vorhersage der Krankheitsentwicklung dienen.<br />Dr. med. Remy Pollock vom University Health Network Toronto (Kanada) führte einen epigenomweiten Vergleich der DNA-Methylierung in Blutproben von 60 Psoriasispatienten, die eine PsA entwickelten, und solchen, die keine entwickelten, durch. Im Hinblick auf Alter, Geschlecht und Psoriasisdauer waren die Patienten vergleichbar. Hier zeigten sich diskrete, aber signifikante Unterschiede in der DNA-Methylierung an 68 Genorten (CpG-Dinukleotiden), von denen einige bei der Th17-Differenzierung involviert waren.<sup>1</sup><br />«Die wichtigste Botschaft unserer Studie ist, dass wir künftig vielleicht die DNA-Methylierung als prognostischen Marker für die Entwicklung einer PsA verwenden könnten», erklärte Dr. Pollock. Dies hätte den grossen Vorteil, dass solche Patienten dann früh einer Therapie zugeführt werden könnten. In einem nächsten Schritt plant die Arbeitsgruppe, zu untersuchen, wie sich die DNA-Methylierung nach der PsA-Diagnose verändert und ob die Methylierung mit einer Gen- und Proteinexpression von proentzündlichen Signalwegen korreliert.</p> <h2>Selektiver JAK1-Hemmer in der FINCH-1-Studie</h2> <p>Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA), die unzureichend auf Methotrexat ansprechen, könnten von einer Therapie mit dem experimentellen JAK1-Hemmer Filgotinib profitieren, so die Ergebnisse der grossen FINCH-1-Studie. Im Vergleich zur Placebogruppe erreichten signifikant mehr Patienten mit mittelschwerer bis schwerer RA, die mit Filgotinib behandelt wurden, nach 12 Wochen eine Verbesserung nach den Kriterien des American College of Rheumatology (ACR20) um mindestens 20 %. In Woche 24 entsprachen die ACR20- , ACR50- und ACR70-Ansprechraten in etwa denen in der aktiven Vergleichsgruppe, die Adalimumab erhielt. <br />In der doppelblinden Phase-III-Studie FINCH 1 wurden Patienten mit aktiver RA eingeschlossen und entweder mit Filgotinib, Placebo oder Adalimumab als aktiver Vergleichssubstanz behandelt. Die FINCH-Studie wird insgesamt 52 Wochen lang durchgeführt. Zusätzlich erhielten alle Studienteilnehmer Methotrexat für bis zu 12 Wochen. «Die Wirkung von Filgotinib trat schnell ein und hielt über 24 Wochen an», berichtete Prof. Dr. med. Bernard Combe, Rheumatologe an der Universität Montpellier (Frankreich), bei der Vorstellung der Studienergebnisse.<sup>2</sup> <br />Neben den genannten Verbesserungen im ACR-Ansprechen führte die Behandlung mit Filgotinib auch zu einem signifikant höheren Prozentsatz an Patienten, die eine geringe Krankheitsaktivität erreichten (gemessen im DAS28-CRP ≤ 3,2). Auch diesbezüglich war die Wirkung ähnlich stark wie die von Adalimumab. Zudem verbesserte sich bei den Patienten die Gelenkfunktion und es gab Hinweise auf eine Verlangsamung der radiologischen Progression. In puncto Verträglichkeit gab es keine signifikanten Sicherheitsunterschiede zwischen den Studiengruppen: Die Rate schwerer Infektionen, Venenthrombosen und anderer unerwünschter Ereignisse war gering. Die Rate an schwerwiegenden Infektionen war in den Filgotinibgruppen etwas höher als in der Placebogruppe und in allen Gruppen höher als in der Adalimumabgruppe. <br />Eine Besonderheit der FINCH-1-Studie ist, dass sie mit über 1750 randomisierten Patienten viel grösser als alle Studien ist, die sonst mit JAK-Hemmern durchgeführt wurde. Zudem unterscheidet sich Filgotinib von den bereits zugelassenen Vertretern der Substanzgruppe Baricitinib und Tofacitinib dadurch, dass es selektiv den JAK1-Signalweg blockiert. Nach Ansicht von Prof. Combe seien diese ersten Ergebnisse vielversprechend und man könne davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren mit Filgotinib der dritte JAK-Hemmer auf den Markt kommt.</p> <h2>Diabetes und CED als Risikofaktoren für RA</h2> <p>Eine Autoimmunerkrankung kommt selten allein: Diesen Schluss lässt eine Studie aus den USA zu. Hier wurde zum einen die Prävalenz von insgesamt 77 Erkrankungen bei RA-Patienten mit derjenigen von Kontrollen verglichen. Zum anderen wurde auch untersucht, in welcher zeitlichen Abfolge eine Diagnose im Vergleich zur RA-Erstdiagnose auftritt, um zu erkennen, welche Erkrankungen einen prädiktiven Wert für eine Rheumadiagnose haben. <br />«Es ist bekannt, dass Patienten häufig sowohl Typ-1-Diabetes als auch RA aufweisen, doch unsere Ergebnisse legen nahe, dass entzündliche Darmerkrankungen und Typ-1-Diabetes ein Risikofaktor für die spätere Entstehung einer RA sind», erklärte Dr. med. Vanessa Kronzer, Mayo Clinic School of Graduate Medical Education in Rochester (MN/USA). Die genannten Erkrankungen waren die einzigen Komorbiditäten, die in der Zeitperiode vor der Rheumadiagnose häufiger auftraten als danach (CED 1,9 % vs. 0,5 %, p < 0,001; Typ-1-Diabetes 1,3 % vs. 0,4 %, p = 0,01). <br />Diese Erkenntnis stammt aus einer Fallkontrollstudie von 821 RA-Patienten aus einer Datenbank eines Zentrums, bei der jeder Rheumapatient mit 3 hinsichtlich der Ausgangsfaktoren ähnlichen Kontrollpersonen verglichen wurde.3 In die Analyse gingen Komorbidität nach Eigenauskunft der Patienten und das Alter bei der Erstdiagnose von über 77 Begleiterkrankungen ein. <br />Vor der RA-Diagnose bestand bezüglich der Anzahl der weiteren Komorbidität kein Unterschied zwischen den Gruppen, nach der RA-Diagnose hingegen wies die RA-Gruppe im Vergleich zu den Kontrollen signifikant häufiger eine Komorbidität auf (median 5,0 vs. 4,0 in der Kontrollgruppe, p = 0,003). In der RA-Gruppe bestanden auch mehr Erkrankungen, die bislang nicht mit einer RA assoziiert wurden, so z. B. venöse Thromboembolie (10 % vs. 6 %; p < 0,001) und Epilepsie (3 % vs. 1,2 %; p < 0,001). Rheumapatienten hatten dagegen seltener erhöhte Cholesterinwerte als die Kontrollen (11,4 % vs. 16,4 %; p = 0,004). Bei der Häufigkeit onkologischer Erkrankungen gab es keinen Unterschied zwischen den Gruppen.</p> <h2>Gelingt die Remission, sind Steroide entbehrlich</h2> <p>Bei Patienten mit RA, die mit dem IL-6-Inhibitor Tocilizumab eine Remission oder eine niedrige Krankheitsaktivität erreichen, können zeitgleich systemische Kortikosteroide ohne klinisch relevante Konsequenzen ausgeschlichen werden. Dies zeigte eine randomisierte kontrollierte Studie an 25 Patienten.<sup>4</sup> <br />In die Studie wurden 259 Patienten mit RA eingeschlossen und mit Tocilizumab und Kortikosteroiden (5 mg Prednison/ Tag) mit oder ohne weitere Therapie mit konventionellen DMARDs über mindestens 24 Wochen behandelt. Bei der Randomisierung mussten alle Patienten seit mindestens 4 Wochen in Remission sein oder nur eine geringe Krankheitsaktivität aufweisen (definiert als DAS28-ESR < 3,2). Im Anschluss wurden verblindet in einer Gruppe entweder die Kortikosteroide beibehalten oder ausgeschlichen (ausgehend von 4 mg/ Tag wurde die Dosis alle 4 Wochen um 1 mg reduziert, bis die Patienten in Woche 16–24 kein Steroid mehr einnahmen). Die Therapie mit Tocilizumab und weiteren DMARDs wurde unverändert beibehalten. <br />Nach 24 Wochen bestand im Hinblick auf die Krankheitsaktivität nur ein kleiner, aber signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen von 0,6 DAS28-ESR-Einheiten (p < 0,001). Dennoch erreichten die meisten Patienten in beiden Therapiearmen einen Behandlungserfolg: 77 % von denen, die weiterhin Steroide erhielten, und 65 % von denen, bei denen Steroide ausgeschlichen wurden. Krankheitsschübe ereigneten sich bei 26 % der Patienten, bei denen Steroide ausgeschlichen wurden, und bei 11 % in der anderen Gruppe. Nebenwirkungen wurden bei 5 % der Patienten, die weiterhin Steroide erhielten, im Vergleich zu 3 % in der Ausschleichgruppe beobachtet. <br />«Auf Grundlage dieser Ergebnisse sind wir der Ansicht, dass allen Patienten, die mit Tocilizumab eine niedrige Krankheitsaktivität oder eine Remission erreicht haben, angeboten werden sollte, Steroide auszuschleichen», empfahl Prof. Dr. med. Gerd R. Burmester, Abteilung für Rheumatologie und klinische Immunologie an der Charité-Universitätsmedizin Berlin.</p> <h2>Unbedingt zur Grippeimpfung raten</h2> <p>Bislang war nicht ganz klar, ob Patienten, die Biologika einnehmen, ebenso gut auf eine Grippeimpfung ansprechen wie Gesunde. Eine italienische Studie zeigte jetzt, dass diese Patienten nicht nur ebenso gut auf die Impfung ansprechen wie Gesunde, sondern obendrein ungeimpft ein höheres Risiko für eine Influenzainfektion aufweisen.<sup>5</sup> <br />«Die Einnahme von TNF-α-Blockern erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Infektion durch die Unterdrückung des Immunsystems. Andererseits war uns bislang auch nicht klar, ob Patienten, die TNF-α-Blocker einnehmen, ebenso gut wie Gesunde auf die Impfung ansprechen», erklärte Dr. med. Giovanni Adami, Universität Verona (Italien). Um diesen Sachverhalt zu untersuchen, werteten Dr. Adami und seine Arbeitsgruppe Daten von 15 132 erwachsenen Patienten aus, die Adalimumab einnahmen, und verglichen sie mit 71 221 gesunden Kontrollen. Insgesamt zeigte sich, dass eine Grippeschutzimpfung die Infektionsraten in beiden Gruppen etwa gleich stark reduziert. Die Rate an Grippeinfektionen sank bei den Gesunden von 2,3 % bei Nichtgeimpften auf 0,9 % bei Geimpften. Von den Patienten, die TNF-Blocker einnahmen, steckten sich 14,4 % der Nichtgeimpften mit Grippe an, im Vergleich zu 4,5 % der Geimpften. Umgekehrt bedeutet dies, dass Patienten mit TNF-α-Blocker-Einnahme erheblich mehr von einer Impfung profitieren als Gesunde: Bei ihnen müssen nur 10 geimpft werden, um eine Grippeinfektion zu vermeiden, bei den gesunden Kontrollen sind es 71. «Es kam für uns nicht überraschend, dass Patienten, die Adalimumab einnahmen, deutlich mehr als die Gesunden profitieren, denn natürlich haben solche Menschen ein höheres Risiko für eine Infektion. Uns hat vielmehr überrascht, dass die Reduktion des Risikos für eine Infektion ähnlich ist wie bei Gesunden, sie also ebenso gut auf die Impfung ansprechen wie die Kontrollen», sagte Dr. Adami. <br />In der Studie wurden auch die Kosten analysiert, die aufgebracht werden müssen, um eine Influenzainfektion zu verhindern: Dies waren ca. 1420–2840 US$ bei den Kontrollen im Vergleich zu nur 200– 400 US$ bei den Patienten, die TNF-Blocker einnahmen. Das Team um Dr. Adami plant jetzt, entsprechende Zusammenhänge auch für andere Impfungen und andere Immunsuppressiva, z. B. JAK-Inhibitoren, zu untersuchen.</p> <h2>Erhalt der Lungenfunktion bei unterschiedlichsten Subgruppen</h2> <p>Die SENSCIS-Studie zeigte, dass der Tyrosinkinasehemmer Nintedanib den Verlust der Lungenfunktion bei Patienten mit systemischer Sklerose (SSc) und damit assoziierter interstitieller Lungenerkrankung (ILD) abbremsen kann. Eine Subgruppenanalyse bestätigte jetzt den therapeutischen Nutzen von Nintedanib, unabhängig von Sklerosesubtyp, Alter, Herkunft und Einnahme von Mycophenolat- Mofetil.<sup>6</sup><br /> Die SENSCIS-Studie ist mit 576 Patienten die grösste Phase-III-Studie, die je bei SSc durchgeführt wurde. Eingeschlossen wurden Patienten, bei denen ein erstes Nicht-Raynaud-Symptom weniger als 7 Jahre vor Studieneinschluss festgestellt wurde und die eine mindestens 10 %ige Lungenfibrose aufwiesen (ermittelt mithilfe einer hochauflösenden CT-Aufnahme). Die Studienteilnehmer wurden ein Jahr lang zusätzlich zu ihrer immunsuppressiven Therapie mit Placebo oder Nintedanib behandelt. Hier zeigte sich, dass Nintedanib tatsächlich die Progression der Fibrose abbremsen kann. So nahm die forcierte Vitalkapazität (FVC) bei Einnahme von Nintedanib um 52,4 ml/Jahr ab, im Vergleich zu 93,3 ml/Jahr bei Therapie mit Placebo (p = 0,04). Dies entsprach einer relativen Reduktion der Verschlechterung der Lungenfunktion durch Nintedanib um 44 %.<br /> Im Rahmen des EULAR-Kongresses stellte Prof. Dr. med. Oliver Distler, Rheumatologe am Universitätsspital Zürich, eine Subgruppenanalyse der SENSCIS-Studie vor: Hier wurden präspezifiziert die Abnahmen der FVC-Werte nach Geschlecht, Alter, Herkunft, Ethnie, Subtyp der Sklerose (diffuse kutane vs. limitiert kutane systemische Sklerose), Antikörperstatus (Anti-Topoisomerase-I-positiv oder -negativ) und Einnahme von Mycophenolat-Mofetil ausgewertet. Hier zeigte sich, dass Nintedanib unabhängig von den Ausgangsvoraussetzungen seine Wirksamkeit entfaltete. «Dies sind sehr gute Nachrichten für SSc-Patienten und deren Ärzte, weil es bisher keine Behandlungsmöglichkeit für SSc-Patienten mit assoziierter interstitieller Lungenerkrankung gibt», erklärte Prof. Distler. ILD sind die häufigste Todesursache von Patienten mit SSc und für circa ein Drittel der Todesfälle verantwortlich.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: EULAR European Congress of Rheumatology 2019; 12.–15. Juni, Madrid
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Pollock R et al.: Characterizing the epigenomic landscape of psoriasis patients destined to develop psoriatic arthritis. EULAR-Kongress, 12.–15. Juni 2019, Madrid, Abstract Nr. OP0203 <strong>2</strong> Combe B et al.: Efficacy and safety of filgotinib for patients with rheumatoid arthritis with inadequate response to methotrexate FINCH 1 primary outcome results. EULAR-Kongress, 12.–15. Juni 2019, Madrid, Abstract Nr. LB0001 <strong>3</strong> Kronzer V et al.: Comorbidities as risk factors for rheumatoid arthritis (AR) and accrual after RA diagnosis. EULAR-Kongress, 12.–15. Juni 2019, Madrid, Abstract Nr. OP0088 <strong>4</strong> Burmester G et al.: Randomized controlled 24-week trial evaluating the safety and efficacy of blinded tapering versus continuation of long-term prednisone (5mg/d) in patients with rheumatoid arthritis who achieved low disease activity or remission on tocilizumab. EULAR-Kongress, 12.–15. Juni 2019, Madrid, Abstract Nr. OP0030 <strong>5</strong> Adami G et al.: Effectiveness of influenza vaccine in TNF-inhibitor treated patients. EULAR-Kongress, 12.–15. Juni 2019, Madrid, Abstract Nr. OP0230 <strong>6</strong> Distler O et al.: Nintedanib reduced decline in forced vital capacity across subgroups of patients with systemic sclerosis-associated interstitial lung disease: data from the SENSCIS trial. Oral Presentation, EULAR-Kongress, 12.–15. Juni 2019, Madrid, Abstract Nr. OP0017</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Bedeutung pulmonaler Symptome zum Zeitpunkt der Erstdiagnose
Bei der Erstdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen können bereits pulmonale Symptome vorliegen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. Eine Studie des Rheumazentrums Jena hat ...
Betroffene effektiv behandeln und in hausärztliche Betreuung entlassen
Bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Gicht ist eine rheumatologisch-fachärztliche Betreuung sinnvoll. Eine im August 2024 veröffentlichte S3-Leitlinie zur Gicht macht deutlich, ...
Gezielte Therapien bei axSpA – und wie aus ihnen zu wählen ist
Nachdem 2003 der erste TNF-Blocker zugelassen wurde, existiert heute für die röntgenologische (r-axSpA) und die nichtröntgenologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) eine ganze Reihe ...