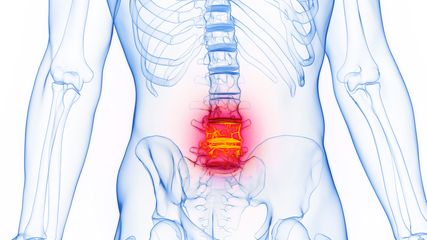<p class="article-intro">Die Ursache der Arthrose wird generell im Verschleiß von Knorpel in den Gelenken gesehen. Doch wird der Beitrag einer inflammatorischen Komponente immer deutlicher. Unter dem Titel „Arthrose und Immunologie“ behandelte die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR) diesen Aspekt ausführlich.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Arthrose, Synovitis und das adaptive Immunsystem</h2> <p>Die Arthrose (engl. „osteoarthritis“, OA) als häufigste Erkrankung des Bewegungsapparats zeigt eine starke Zunahme der Inzidenz, bedingt durch das steigende Alter der Bevölkerung und verbreitetes Übergewicht. Durch Alter und mechanische Überbelastung kommt es zum Knorpelschwund, bei dem der Abbau der Matrix gegenüber der Neusynthese überwiegt.<br /> Doch OA ist weit mehr als nur Knorpelschwund, wie Prof. Dr. Martin Stradner, Medizinische Universität Graz, hervorhob. So gibt es deutliche Veränderungen auch an den Knochen (Sklerosierung, Zystenbildung, Durchbrechen von Gefäßen) und an der Muskulatur (Atrophie) sowie typischerweise eine Verdickung und Entzündung der synovialen Membran. Diese Synovitis ist bei Weitem nicht so ausgeprägt wie bei entzündlichen Gelenkserkrankungen, z. B. der rheumatoiden Arthritis, doch tritt sie bei etwa 60 % aller Gonarthrosen und 90 % aller Fingerpolyarthrosen auf.<br /> Die Synovitis weist auf eine Beteiligung inflammatorischer Prozesse auch bei der OA hin. Sie bedingt eine erhöhte Schmerzhaftigkeit, der Schmerz korreliert mit der Ausprägung der Synovitis im MRT. Eine rezente Studie bei entzündlicher Fingerpolyarthrose zeigte, dass eine Behandlung mit oralem Prednisolon die Synovitis und den damit assoziierten Schmerz signifikant reduziert.<sup>1</sup><br /> Die Synovitis führt auch zu Funktionseinschränkungen, z. B. beim Gehen oder Treppensteigen, und begünstigt die Progression der OA. Sie kann im MRT gut erkannt werden. Histologisch zeigen sich verschiedene Muster der Synovitis: fibrotisch bei fortgeschrittener Erkrankung, dagegen hyperplastisch mit gesteigerter Synoviozytenproliferation bei Frühformen.<sup>2</sup> Auch kommen detritusreiche Formen mit Knorpel- und Knochenfragmenten und inflammatorische mit Infiltration von Makrophagen und Lymphozyten vor. Interessant ist hier, dass im gleichen Gelenk verschiedene dieser Typen parallel existieren können.<br /> Es stellt sich die Frage, ob die Synovitis Ursache oder Folge der OA ist. Nach den Ergebnissen der MOST-Studie<sup>3</sup> ist Synovitis in der Tat eine unabhängige Ursache der OA. Jedoch steigt das Risiko, eine OA zu entwickeln, nur bei höheren Schweregraden der Synovitis. Eine geringgradige Synovitis wäre dagegen eher als Folge der OA anzusehen.<br /> Zu den bei der OA relativ spärlichen T-Zellen gibt es wenige Daten. Synoviale CD4+-T-Zellen, vor allem Th1-, Th9- und Th17-Zellen, wurden beschrieben und scheinen bei der OA mit dem Schmerz zu korrelieren. Auch B-Zellen und Autoantikörper treten bei der OA auf. Eine (oligo-) klonale Expansion der B-Zellen ist nachweisbar; selten kommt es zur Ausbildung von Keimzentren und selten werden Antikörper gegen die Knorpelmatrix gebildet. Doch sollte man die OA keinesfalls als Autoimmunerkrankung fehlinterpretieren.<br /> Zusammenfassend kann gesagt werden, dass adaptive Immunmechanismen in der Synovitis bei der OA aktiv sind – ihre Relevanz und Kausalität bleiben jedoch derzeit unklar.</p>
<p class="article-intro">Die Ursache der Arthrose wird generell im Verschleiß von Knorpel in den Gelenken gesehen. Doch wird der Beitrag einer inflammatorischen Komponente immer deutlicher. Unter dem Titel „Arthrose und Immunologie“ behandelte die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Rheumatologie & Rehabilitation (ÖGR) diesen Aspekt ausführlich.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Arthrose, Synovitis und das adaptive Immunsystem</h2> <p>Die Arthrose (engl. „osteoarthritis“, OA) als häufigste Erkrankung des Bewegungsapparats zeigt eine starke Zunahme der Inzidenz, bedingt durch das steigende Alter der Bevölkerung und verbreitetes Übergewicht. Durch Alter und mechanische Überbelastung kommt es zum Knorpelschwund, bei dem der Abbau der Matrix gegenüber der Neusynthese überwiegt.<br /> Doch OA ist weit mehr als nur Knorpelschwund, wie Prof. Dr. Martin Stradner, Medizinische Universität Graz, hervorhob. So gibt es deutliche Veränderungen auch an den Knochen (Sklerosierung, Zystenbildung, Durchbrechen von Gefäßen) und an der Muskulatur (Atrophie) sowie typischerweise eine Verdickung und Entzündung der synovialen Membran. Diese Synovitis ist bei Weitem nicht so ausgeprägt wie bei entzündlichen Gelenkserkrankungen, z. B. der rheumatoiden Arthritis, doch tritt sie bei etwa 60 % aller Gonarthrosen und 90 % aller Fingerpolyarthrosen auf.<br /> Die Synovitis weist auf eine Beteiligung inflammatorischer Prozesse auch bei der OA hin. Sie bedingt eine erhöhte Schmerzhaftigkeit, der Schmerz korreliert mit der Ausprägung der Synovitis im MRT. Eine rezente Studie bei entzündlicher Fingerpolyarthrose zeigte, dass eine Behandlung mit oralem Prednisolon die Synovitis und den damit assoziierten Schmerz signifikant reduziert.<sup>1</sup><br /> Die Synovitis führt auch zu Funktionseinschränkungen, z. B. beim Gehen oder Treppensteigen, und begünstigt die Progression der OA. Sie kann im MRT gut erkannt werden. Histologisch zeigen sich verschiedene Muster der Synovitis: fibrotisch bei fortgeschrittener Erkrankung, dagegen hyperplastisch mit gesteigerter Synoviozytenproliferation bei Frühformen.<sup>2</sup> Auch kommen detritusreiche Formen mit Knorpel- und Knochenfragmenten und inflammatorische mit Infiltration von Makrophagen und Lymphozyten vor. Interessant ist hier, dass im gleichen Gelenk verschiedene dieser Typen parallel existieren können.<br /> Es stellt sich die Frage, ob die Synovitis Ursache oder Folge der OA ist. Nach den Ergebnissen der MOST-Studie<sup>3</sup> ist Synovitis in der Tat eine unabhängige Ursache der OA. Jedoch steigt das Risiko, eine OA zu entwickeln, nur bei höheren Schweregraden der Synovitis. Eine geringgradige Synovitis wäre dagegen eher als Folge der OA anzusehen.<br /> Zu den bei der OA relativ spärlichen T-Zellen gibt es wenige Daten. Synoviale CD4+-T-Zellen, vor allem Th1-, Th9- und Th17-Zellen, wurden beschrieben und scheinen bei der OA mit dem Schmerz zu korrelieren. Auch B-Zellen und Autoantikörper treten bei der OA auf. Eine (oligo-) klonale Expansion der B-Zellen ist nachweisbar; selten kommt es zur Ausbildung von Keimzentren und selten werden Antikörper gegen die Knorpelmatrix gebildet. Doch sollte man die OA keinesfalls als Autoimmunerkrankung fehlinterpretieren.<br /> Zusammenfassend kann gesagt werden, dass adaptive Immunmechanismen in der Synovitis bei der OA aktiv sind – ihre Relevanz und Kausalität bleiben jedoch derzeit unklar.</p> <h2>Arthrose und das angeborene Immunsystem</h2> <p>Stressbelastung oder Schädigung von Gewebe führt zur Ausschüttung von DAMPs („damage-associated molecular patterns“), die von Zellen des angeborenen Immunsystems erkannt werden und diese zur Ausschüttung von Zytokinen veranlassen. So entsteht eine lokale Entzündung. Diese kann wiederum zur Bildung von DAMPs Anlass geben, was einen inflammatorischen Teufelskreis auslöst. Auch bei der OA tragen etliche DAMPs zur entzündlichen Komponente der Erkrankung bei. Prof. Mag. Dr. Stefan Tögel, Medizinische Universität Wien, stellte eine Auswahl dieser Faktoren vor:<br /> HMBG-1 ist ein nukleäres Protein. Seine Freisetzung aus der Zelle führt zu Entzündungen. Wird es von Chondrozyten ausgeschüttet, so aktiviert es über den TLR4-Rezeptor Makrophagen; diese bilden dann vermehrt IL-1β und TNF-α, welche wiederum Chondrozyten zur erhöhten Ausschüttung von HMBG-1 veranlassen. HMBG-1 selbst stimuliert Chondrozyten zur Sekretion von Matrix-Metalloproteasen (MMPs).<br /> S100-Alarmine sind kalziumbindende Proteine mit definierten intrazellulären Rollen. Werden sie von den Zellen freigesetzt, so fungieren sie als proinflammatorische Faktoren. Z. B. wird eine Freisetzung aus Chondrozyten durch mechanischen Stress und aus Makrophagen durch Zytokine induziert. Über Aktivierung von RAGE- und TLR4-Rezeptoren auf der Oberfläche dieser Zellen werden wiederum IL-1β und TNF-α sowie MMPs ausgeschüttet, die Entzündung und Matrixabbau befördern. In Mäusen löst eine intraartikuläre S100- Injektion Synovitis aus. Bei OA-Patienten ist eine Expression von S100A12 durch Chondrozyten im Knorpel nachweisbar.<br /> Der RAGE-Rezeptor ist auch das Ziel von „advanced glycation endproducts“ (AGEs), die als Produkte nicht enzymatischer Verbindung von Zuckern insbesondere mit Proteinen (z. B. Kollagen) entstehen. Sie werden mit vielen altersbedingten chronischen Erkrankungen impliziert. Via Aktivierung von RAGE kommt es auch durch AGEs wiederum zu vermehrter MMP- und Zytokinausschüttung. Auch wird die Expression von RAGE erhöht, was ein verstärktes Ansprechen auf AGEs, S100-Proteine und auch HMBG-1 bedingt.<br /> Plasma-Proteine wie Gc-Globulin, α1-Mikroglobulin und α2-Makroglobulin induzieren durch Aktivierung von TLR4 ebenfalls die Entzündung bei der OA. Galektine sind eine Familie von DAMPs mit vielfältigen Aufgaben. Die Arbeitsgruppe von Prof. Tögel zeigte eine Verbindung zwischen Galektinen und der Entzündung bei der OA auf:</p> <ul> <li>Galektin-1, -3 und -8 werden von Chondrozyten exprimiert.</li> <li>Ihre Expression korreliert mit der Knorpeldegeneration bei der OA.</li> <li>Sie induzieren die Expression von Entzündungsmarkern wie IL-1β und IL-6 und von MMPs und dämpfen die Bildung von strukturgebenden Proteinen wie Kollagen II. Sie wirken durch Aktivierung des NF-κB-Signalwegs.<sup>4–6</sup></li> </ul> <p>Noch unveröffentlichte Daten aus einem dreidimensionalen In-vitro-System zeigen, dass Galektine den Abbau von extrazellulärer Matrix durch Überproduktion von MMPs induzieren.<br /> Zu den Zellen des angeborenen Immunsystems, die Rezeptoren für die verschiedenen DAMPs aufweisen, gehören vor allem die Makrophagen. Die experimentelle Depletion von Makrophagen in Mausmodellen der OA reduziert die Ausprägung der Erkrankung.<br /> Neben den DAMPs spielt auch das Komplementsystem als weiterer Teil des angeborenen Immunsystems eine Rolle bei der OA. So wurde z. B. gezeigt, dass bei C5-Defizienz in einem OA-Mausmodell nur eine abgeschwächte Form der Erkrankung auftritt.<br /> Eine pathogene Rolle wird auch seneszenten Zellen im Knorpel und im Synovium zugeschrieben, die im Zuge des Alterungsprozesses auftreten. Im Mausmodell können seneszente Zellen durch Kreuzband- Durchtrennung induziert werden. Die Elimination dieser Zellen durch ein „Senolyticum“ (ein p53MDM2-Inhibitor) dämpfte die Entwicklung einer posttraumatischen OA.<sup>7</sup><br /> Zusammenfassend wird klar, dass das angeborene Immunsystem auf vielen Ebenen an der Progression der OA beteiligt ist. Es gibt aber keine Hinweise darauf, dass dieser Teil des Immunsystems ätiologisch an der Auslösung der OA beteiligt wäre. Ob das angeborene Immunsystem molekulare Angriffspunkte für die Therapie der OA liefert, bleibt noch zu zeigen.</p> <h2>DMARD-Therapien und Arthrose</h2> <p>Ergotherapie und physikalische Therapie sind die Grundpfeiler der OA-Behandlung. Dagegen sind pharmakologische Therapieoptionen limitiert, wobei die topischen und peroralen NSAR zu den wichtigsten gehören. Prof. Dr. Klaus Bobacz, Medizinische Universität Wien, gab einen Überblick über die vielfältigen Versuche, auch die OA mit „disease-modifying anti-rheumatic drugs“ (DMARDs) zu behandeln:</p> <ul> <li>Hydroxychloroquin als konventionelles DMARD zeigte in 3 gut durchgeführten Studien keine Wirksamkeit bei der OA; man sollte es nicht (mehr) einsetzen.<sup>8 </sup></li> <li>Kein eindeutiges Bild gibt es zu Methotrexat; zwar zeigten manche Studien eine Wirkung bei der OA, doch ist die Studienlage zu widersprüchlich, um eine Empfehlung auszusprechen.</li> <li>TNF-α kann in den Gelenken bei der OA eindeutig nachgewiesen werden. Die Ergebnisse klinischer Studien mit den TNF-α-Inhibitoren Adalimumab, Infliximab und Etanercept bei OA sind jedoch ernüchternd: In keiner placebokontrollierten randomisierten Studie zeigte sich ein Effekt hinsichtlich Schmerz und Funktion als primäre Endpunkte.</li> <li>Ähnlich negativ stellt sich die Situation für IL-1β-Inhibitoren dar: In placebokontrollierten Studien mit dem IL-1β- Antagonisten Anakinra und den Antikörpern Lutikizumab und Gevokizumab konnte keine Wirksamkeit bei OA festgestellt werden. Einzig die CANTOS-Studie mit dem Antikörper Canakinumab bei kardiovaskulären Patienten zeigte weniger Hüft- und Knieersatzprothesen und weniger OA-Symptomatik unter der Behandlung.</li> </ul> <p>Das Versagen dieser Therapien kann zum einen durch die Komplexität des Krankheitsgeschehens bei der OA mit Beteiligung verschiedener Strukturen (Knorpel, Synovia und Knochen) erklärt werden. Zum anderen ist OA keine einheitliche Erkrankung, sondern wird heute in 4 phänotypische Gruppen unterteilt: Nicht jedes potenzielle DMARD mag in allen diesen Gruppen wirksam sein:</p> <ul> <li>posttraumatische Arthritis mit lokaler Inflammation als Folge von aktivierten Mechanorezeptoren und konsekutiver Synovitis</li> <li>OA bei metabolischem Syndrom mit einer systemischen niedriggradigen Inflammation</li> <li>Alters-OA bedingt durch zelluläre Veränderungen und Entstehung eines sekretorischen inflammatorischen Phänotyps</li> <li>OA als Folge von Kristallablagerungen (vor allem Kalzium-Pyrophosphat, basisches Kalziumphosphat).</li> </ul> <p>Schließlich ist noch zu bemerken, dass es bei den Entzündungsfaktoren Redundanzen gibt, sodass das Ausschalten eines einzelnen Faktors möglicherweise nicht ausreichend ist. <br />Zusammenfassend kann gesagt werden, dass DMARDs bei der Arthrose bisher keine Erfolgsgeschichte aufweisen und derzeit keine empfehlenswerten Optionen für den klinischen Einsatz bei der OA zur Verfügung stehen. Für eine Reihe weiterer Biologika (z. B. Anti-IL-6-Antikörper) stehen Ergebnisse aus klinischen Studien noch aus. Hoffnungen werden derzeit in humanes FGF18 gesetzt, einen Wachstumsfaktor für Chondrozyten, der als rekombinantes Produkt Sprifermin in einer rezenten klinischen Studie das Wachstum des Knorpels bei der Gonarthrose nach intraartikulärer Gabe stimulierte.<sup>9</sup> Auch ein Inhibitor des wnt-Pathways zeigte einen positiven Effekt auf das Knorpelwachstum in einer Phase- II-Studie bei der Gonarthrose. In beiden Fällen sind Anschlussstudien zu erwarten.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: ÖGR-Jahrestagung 2019, 28.–30. November 2019, Wien
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Kroon FPB et al.: Lancet 2019; 394: 1993-2001<strong> 2</strong> Oehler S et al.: Clin Exp Rheumatol 2002; 20: 633-40 <strong>3</strong> Felson DT et al.: Osteoarthritis Cartilage 2016; 24: 458-64 <strong>4</strong> Toegel S et al.: J Immunol 2016; 196: 1910-21 <strong>5</strong> Weinmann D et al.: Sci Rep 2016; 6: 39112 <strong>6</strong> Weinmann D et al.: Cell Mol Life Sci 2018; 75: 4187-205 <strong>7</strong> Jeon OH et al.: Nat Med 2017; 23: 775-81 <strong>8</strong> Onuora S: Nat Rev Rheumatol 2018; 14: 248 <strong>9</strong> Hochberg MC et al.: JAMA 2019; 322: 1360-70</p>
</div>
</p>