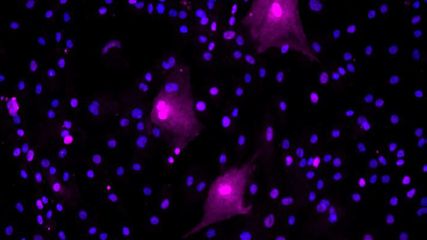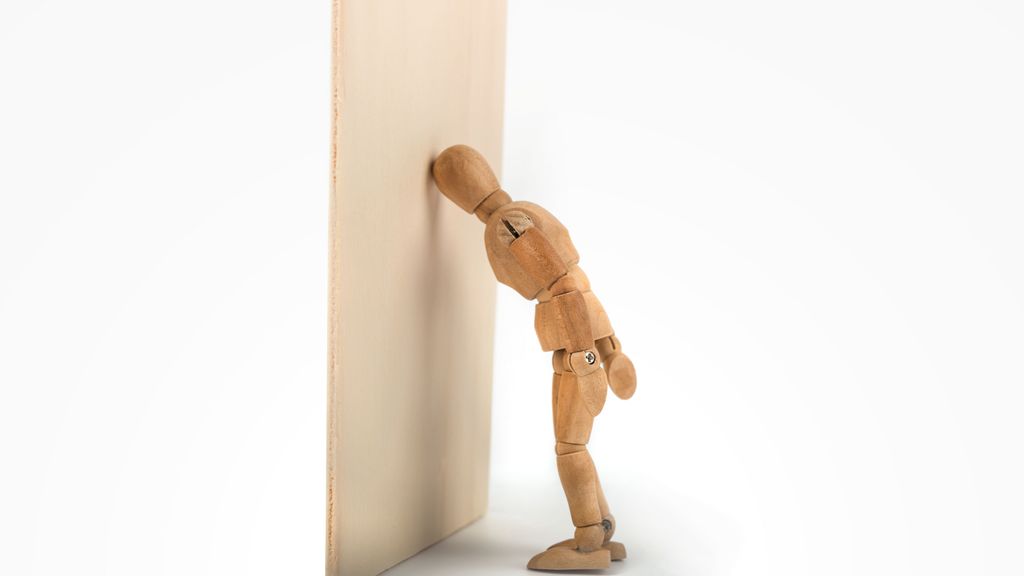
©
Getty Images/iStockphoto
Freude an Bewegung
Jatros
30
Min. Lesezeit
11.07.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der alljährliche interdisziplinäre Kongress der help 4 you company fand auch heuer wieder großen Anklang. Ärzte verschiedenster Fachrichtungen, Therapeuten und viele weitere Interessierte füllten den Vortragssaal Arena21 im Wiener MuseumsQuartier, um sich über den neuesten Wissensstand bei der Behandlung von Gelenksschmerzen zu informieren.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Rheuma und Haut</h2> <p>Rheuma und Haut Dermatologie und Rheumatologie als eng zusammenarbeitende Schwesterdisziplinen vertraten Prof. Dr. Constanze Jonak, Universitätsklinik für Dermatologie, Wien, und Prof. Dr. Klaus Machold, Universitätsklinik für Innere Medizin III, Wien.<br /> Machold erklärte anhand von Fallbeispielen, wie vielfältig und unterschiedlich sich rheumatische Erkrankungen wie PsA, PsO, Sklerodermie und Lupus erythematodes manifestieren können. Bei unklaren Gelenksbeschwerden sollte, vor allem bei jungen Patienten, ein Blick in den Gehörgang und in die Rima ani geworfen werden, denn dies sind Prädilektionsstellen für Hautmanifestationen von PsA und PsO, die leicht übersehen werden. Und natürlich sollten auch die Finger- und Fußnägel kontrolliert werden. Psoriatische Veränderungen an der Nagelmatrix umfassen Pitting (punktförmige Vertiefungen), Leukonychie, Blutungen der Lunula und „Krümelnägel“. Am Nagelbett können Onycholysen, subunguale Hyperkeratosen, Splitterblutungen und Ölflecken auftreten, wie Jonak ausführte.<br />Aber auch wenn kein Haut- und Nagelbefall festzustellen ist, empfahl Machold, den Patienten nach PsO-Fällen in der Familie zu fragen, denn jeder zehnte PsOPatient entwickelt Hautsymptome erst nach der Gelenkssymptomatik.<br />Bei der Behandlung der Patienten sollten deren individuelle Bedürfnisse beachtet werden. „Patienten mit Psoriasis leiden unter vielfältigen Beeinträchtigungen“, wusste Jonak zu berichten. Juckreiz und Schmerzen der Haut rangieren ganz oben, aber auch sexuelle Beeinträchtigung und Depression sind häufig und verringern die Lebensqualität enorm.</p> <h2>Endoprothetik weiterhin auf Erfolgskurs</h2> <p>Dr. Peter Zenz, Vorstand der orthopädischen Abteilung am SMZ Baumgartner Höhe – Otto-Wagner-Spital, Wien, fasste die Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der Hüfttotalendoprothetik (HTEP) zusammen. Er vergaß dabei auch nicht, Fehlschläge wie Großkopfprothesen, Metall/Metall-Gleitpaarungen und modulare Schaft-Hals-Verbindungen zu erwähnen. Der Kurzschaft hingegen hat sich bewährt und ist auf dem Weg zum Goldstandard. Positiv hervorzuheben sind auch die neuen Polyethylen(PE)-Materialien, mit denen der Abrieb auf ein Minimum und Reoperationen um die Hälfte reduziert werden konnten.<br />In der postoperativen Phase hat sich gezeigt, dass „Fast track“-Konzepte nicht zu vermehrten Komplikationen führen, wie manche vielleicht befürchteten. Eine weitere Erkenntnis aus Registerdaten ist, so Zenz, dass es von Vorteil für den Behandlungserfolg ist, wenn ein Chirurg seine Erfahrung mit einem bestimmten Implantat nutzt und dabei bleibt: „Konsistenz des Chirurgen bei der Implantatwahl verringert die Revisionsrate.“<br />Was Knietotalendoprothesen (KTEP) betrifft, wurden ebenfalls in den letzten Jahren sowohl Rückschläge als auch Fortschritte verzeichnet. Als wenig erfolgreich haben sich zementfreie Implantate erwiesen. Für positive Effekte haben dagegen auch hier die hochvernetzten neuen PEMaterialien gesorgt, denn frühzeitige Lockerung wegen PE-Verschleiß war früher der häufigste Revisionsgrund bei KTEP.</p> <h2>Arthrose: kaum Evidenz für Knorpelpräparate</h2> <p>Was man außer einem Gelenksersatz gegen Arthrose tun kann, darüber informierten nacheinander Prof. Dr. Ronald Dorotka, Wien, und Dr. Andreas Kröner, Perchtoldsdorf. Dorotka gab einen Überblick über die konservativen Möglichkeiten, warnte jedoch vor Behandlungsmethoden ohne wissenschaftliche Evidenz, die in großer Anzahl existieren. Insbesondere wird eine ganze Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln mit fragwürdiger Wirkung angeboten. Lediglich für Diacerein, Glucosaminsulfat und Avocado/Soja (unverseifbare Öle) gibt es geringe Evidenz für eine schmerzlindernde Wirkung.<br />Eine empfehlenswerte Arthrosetherapie ist jedenfalls Bewegung, wie Kröner betonte: „Ein Knorpel hat keine Blutgefäße, er kann sich nur durch Diffusion ernähren. Intermittierende dynamische Knorpelbelastung fördert die Syntheseleistung der Chondrozyten. Sie produzieren dann mehr Proteoglykane und Kollagen.“ Statische Belastung, also Stehen, hemmt hingegen den Knorpelstoffwechsel.<br />Vor dem totalen Gelenksersatz gibt es dann noch eine Reihe von anderen operativen Therapieoptionen, von der Mikrofrakturierung über Stammzelltherapien bis zur Mosaikplastik, die je nach Defektgröße und Anspruch des Patienten eingesetzt werden. Eine ganz neue Methode ist die arthroskopische Knorpelzelltransplantation, bei der kleine Kügelchen als Trägermaterial für die Zellen injiziert werden.<br />Wichtig bei allen Methoden sind die sorgfältige Indikationsstellung und die Beachtung von Kontraindikationen, von denen es leider sehr viele gibt, betonte Kröner (Tab. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Jatros_Ortho_1904_Weblinks_jatros_ortho_1904_s65_tab1_lindengruen.jpg" alt="" width="275" height="377" /></p> <h2>Osteoporose: Frakturrisiko berechnen</h2> <p>Einen Überblick über die aktuellen Diagnoserichtlinien und die neuesten Behandlungsmethoden bei Osteoporose gab Dr. Carlo Franz, ärztlicher Leiter des Badener Kurzentrums und des Instituts für physikalische Medizin, Sanatorium Hera, Wien. In der Diagnostik ist nun schon seit einiger Zeit die Knochendichtemessung nicht mehr allein ausschlaggebend, vor allem weil die überwiegende Mehrheit aller Fragilitätsfrakturen bei normaler Knochendichte oder Osteopenie auftreten. Die Entscheidung zur medikamentösen Therapie sollte daher auf Basis der individuellen Frakturwahrscheinlichkeit getroffen werden. Die Abschätzung des Frakturrisikos erfolgt unter Berücksichtigung von klinischen Risikofaktoren und der Knochendichte gemäß dem FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool) bzw. dem Risikomodell des Dachverbandes Osteologie (DVO).</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 13. rheuma.orthopädie-aktiv Kongress, 16. März 2019,
Wien
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...