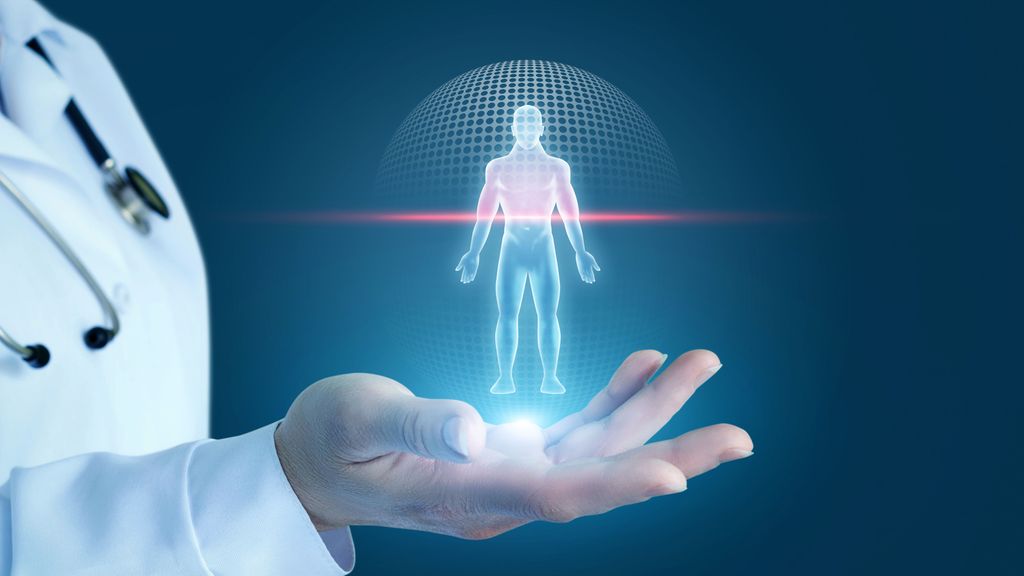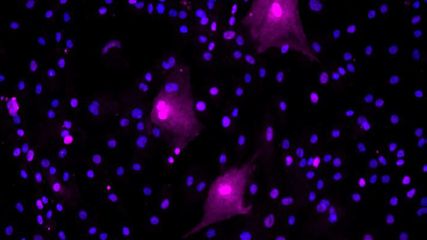<p class="article-intro">In der Rheumatologie gewinnt die Bildgebung in der Frühdiagnostik zunehmend an Bedeutung. Der Ultraschall und die Magnetresonanztomografie werden daher zu einem unverzichtbaren Bestandteil der rheumatologischen Untersuchung, um chronisch-entzündliche Erkrankungen möglichst vor dem Auftreten röntgenologisch sichtbarer Schäden zu diagnostizieren. Dies ist insbesondere auch bei den Spondyloarthritiden von Relevanz, allerdings fehlten bislang klare Richtlinien zum Einsatz der unterschiedlichen Bildgebungsmodalitäten für die Diagnose und das Monitoring dieser Erkrankungen.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Die Gruppe der Spondyloarthritiden (SpA) umfasst mehrere, klinisch mit ähnlichen Symptomen und Manifestationen einhergehende entzündlich-rheumatische Erkrankungen: die ankylosierende Spondylitis (AS), die Psoriasisarthritis (PsA), die mit entzündlichen Darmerkrankungen assoziierte Arthritis/Spondylitis (IBD-related A/SpA) und die reaktive Arthritis (ReA).<sup>1</sup> Je nach klinischer Präsentation (und auch entsprechend den ASAS-Klassifikationskriterien) unterscheidet man zwischen einer prädominant axialen und einer peripheren SpA (Tab. 1a, b).<sup>2, 3</sup></p> <p>Aufgrund von fehlenden spezifischen klinischen Symptomen und der großen Variabilität im Verlauf der Erkrankungen kommt der Bildgebung eine Schlüsselrolle bei der Diagnose und im Monitoring der SpA zu.<sup>1</sup> Neben der essenziellen Bedeutung für die frühe Diagnose erlauben spezifische Magnetresonanztomografie(MRT)-Befunde sowohl bei der axialen als auch bei der peripheren SpA Aufschluss über den Verlauf der Erkrankung und das Therapieansprechen. Jedoch werden nach wie vor die verschiedenen Bildgebungsmodalitäten unterschiedlich eingesetzt. Beispielsweise verlangen die international anerkannten und zur Diagnostik einer AS noch weit verbreiteten modifizierten New-York-Kriterien den radiografischen Nachweis einer Sakroiliitis (Tab. 2).<sup>4</sup> Strukturelle Veränderungen der Sakroiliakalgelenke (SIG), wie zum Beispiel Erosionen, Sklerose oder Ankylose, können allerdings im Röntgen oft erst Jahre nach Symptombeginn nachgewiesen werden, weshalb die Anwendung dieser Bildgebungstechnik zur Frühdiagnose der axialen SpA ungeeignet ist.<sup>5</sup> Die MRT hingegen ermöglicht die Detektion von frühen entzündlichen Läsionen (subchondrales Knochenmarksödem der SIG; Spondylitis marginalis bzw. Spondylitis anterior/posterior [im Englischen „corner inflammatory lesions“], nicht infektiöse Spondylodiszitis [Andersson-Läsion], Knochenmarksödem der Wirbelkörperpedikel sowie Arthritis der Kostovertebral- und Kostotransversalgelenke, Enthesitis der supra- und intraspinalen Ligamenta der Wirbelsäule sowie der Ligamenta flava) und erlaubt somit eine wesentlich frühere Diagnose der SpA.<sup>5–8</sup> <br />Trotz des zunehmenden Wissens um Vor- und Nachteile der verschiedenen Bildgebungsmodalitäten lagen bislang keine allgemein verfügbaren Richtlinien zum Einsatz der Bildgebung für die Diagnose und das Monitoring der SpA vor. In den hier präsentierten EULAR-Empfehlungen wurden zehn Statements zur Diagnose, zum Monitoring von Entzündung und strukturellen Schäden, zur Prädiktion des Outcomes und Therapieansprechens sowie zur Detektion von Wirbelkörperfrakturen und Osteoporose bei axialer und peripherer SpA von einer 21-köpfigen Expertengruppe aus den Fachgebieten Rheumatologie und Radiologie erarbeitet. Die Empfehlungen basieren auf den Daten einer systematischen Literatursuche sowie dem Konsensus der Expertenmeinungen und berücksichtigen alle bislang zur Verfügung stehenden Bildgebungsmodalitäten.</p> <h2>1. Empfehlung: Diagnose der axialen SpA</h2> <p>Generell soll ein konventionelles Röntgen des Beckens als primäre bildgebende Technik zur Abklärung einer möglichen Sakroiliitis bei Verdacht auf axiale SpA durchgeführt werden. Bei sehr jungen Patienten und/oder bei kurzer Symptomdauer soll alternativ eine MRT als primäre bildgebende Untersuchung angewendet werden. Sollte die Diagnose einer Sakroiliitis bei suspizierter axialer SpA mittels konventioneller Radiografie oder klinisch nicht gestellt werden können, soll allenfalls die MRT-Untersuchung der SIG zur weiterführenden Abklärung herangezogen werden. In der MRT-Untersuchung gelten sowohl aktive entzündliche (Knochenmarksödem) als auch strukturelle Läsionen (beispiels­weise Erosionen, Knochenneubildungen, Sklerose und Fettinfiltrationen) als krank­heitsspezifisch. Die generelle Durch­führung einer MRT der (gesamten) Wirbelsäule sowie die generelle Anwendung anderer bildgebender Techniken (außer dem konventionellen Röntgen und der MRT) werden zur Diagnose der axialen SpA nicht empfohlen. Allerdings kann eine Computertomografie (CT) der SIG bei negativem Röntgenbefund und Kontraindikationen gegenüber der Durchführung einer MRT-Untersuchung in Erwägung gezogen werden („strength of recommendation“ [SOR], Mittelwert visuelle Analogskala 9,5; 95 % CI: 9,2–9,9; „level of evidence“ [LOE] III).</p> <ul> <li>Hintergrund: 25 Studien (5 Röntgen, 3 CT, 13 MRT) mit Daten zur diagnostischen Wertigkeit bei der axialen SpA wurden herangezogen. Bei den Studien zur diagnostischen Wertigkeit des Röntgens war eine starke Abhängigkeit der Ergebnisse vom untersuchten Patientenkollektiv (Patienten mit chronisch-entzündlichem Rückenschmerz, klinisch diagnostizierter SpA, AS) mit unterschiedlichen Vortestwahrscheinlichkeiten für die Diagnose einer Sakroiliitis auffällig. Keine eindeutigen Ergebnisse in Bezug auf die Überlegenheit einer Methode ergab der Vergleich der diagnostischen Wertigkeit von CT und Röntgen. Die Berücksichtigung von kombinierten Läsionen (Knochenmarks­ödem sowie erosive Läsionen der SIG) war in der MRT mit der besten diagnostischen Wertigkeit assoziiert. Zudem konnte in einer Studie nachgewiesen werden, dass bei negativem Röntgenbefund der SIG die weiterführende Abklärung mittels MRT zum Nachweis von entzündlichen Läsionen derjenige Diagnoseweg mit der größten Detektionsrate einer Sakroiliitis bei Patienten mit chronisch-entzündlichem tief sitzendem Rückenschmerz ist.</li> </ul> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1606_Weblinks_seite99.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>2. Empfehlung: Diagnose der peripheren SpA</h2> <p>Bei Verdacht auf das Vorliegen einer peripheren SpA kann die Durchführung eines Ultraschalls (US) oder einer MRT zum Nachweis einer Enthesitis, aber auch zum Nachweis einer peripheren Arthritis, Tenosynovitis und/oder Bursitis herangezogen werden (SOR 9,4; 95 % CI: 9,0–9,8; LOE III).</p> <ul> <li>Hintergrund: Neun Studien untersuchten die Rolle von B-Bild und/oder Power-Doppler-Ultraschall von Enthesen für die Diagnose einer peripheren SpA im Vergleich zur klinischen Untersuchung, eine Studie verglich die Ergebnisse der MRT mit jenen des US bei Patienten mit Fersenschmerzen. Prinzipiell ist die sonografische Zuordnung einer Enthesitis bei der peripheren SpA mit einer sehr guten diagnostischen Wertigkeit assoziiert, allerdings weisen die Ergebnisse der eingeschlossenen Studien eine hohe Variabilität auf, welche auf Unterschiede in der Patienten­selektion sowie technischen Anwendung des US bzw. MRT zurückzuführen sind.</li> </ul> <h2>3. Empfehlung: Monitoring der Erkrankungsaktivität – axiale SpA</h2> <p>Um die Erkrankungsaktivität bei Vorliegen einer axialen SpA zu erheben und zu monitorisieren, kann eine MRT der SIG und/oder der Wirbelsäule neben der klinischen Einschätzung sowie laborchemischen Parametern zusätzliche wichtige Informationen liefern. Wann und wie oft die Untersuchung durchgeführt wird, obliegt den klinischen Umständen. Generell ist die Anwendung von „Short tau inver­sion recovery“(STIR)-Sequenzen zur Beurteilung der entzündlichen Aktivität in der MRT ausreichend; die Verwendung von Kontrastmittel ist nicht notwendig (SOR 9,2; 95 % CI: 8,8–9,6; LOE Ib).</p> <ul> <li>Hintergrund: 34 Studien evaluierten die Rolle der MRT zum Monitoring der Erkrankungsaktivität anhand von etablierten Parametern, wie dem Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index (BASDAI), dem Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score (ASDAS), dem C-reaktiven Protein, der Blut­senkungsgeschwindigkeit und dem Schmerz bei der axialen SpA. Sechs von sieben Studien zeigten eine gute Übereinstimmung der Ergebnisse unabhängig von den verwendeten Sequenzen (kontrastverstärkte T1-Gewichtung vs. STIR-Sequenz). In zwei longitudinalen Studien konnten Veränderungen in der MRT schon nach 6–12 Wochen ebenfalls unabhängig von der verwendeten MRT-Sequenz nachgewiesen werden. Wie häufig eine MRT zum Monitoring der Erkrankungsaktivität wiederholt werden soll, ist unklar und kann nicht durch Evidenz belegt werden.</li> </ul> <p><img src="/custom/img/files/files_data_Zeitungen_2016_Jatros_Ortho_1606_Weblinks_seite100.jpg" alt="" width="" height="" /></p> <h2>4. Empfehlung: Monitoring struktureller Veränderungen – axiale SpA</h2> <p>Ein konventionelles Röntgen der SIG und/oder der Wirbelsäule kann verwendet werden, um die strukturellen Langzeitschäden, besonders die entzündlich bedingten Knochenneubildungen (Syndesmophyten) bei der axialen SpA zu monitorisieren. Das Röntgen sollte allerdings nur jedes zweite Jahr durchgeführt werden. Die Durchführung einer MRT kann gegebenenfalls zusätzliche Informationen liefern (SOR 9,3; 95 % CI: 8,8–9,8; LOE Ib).</p> <ul> <li>Hintergrund: 23 Studien untersuchten die Anwendbarkeit bildgebender Techniken zum Nachweis struktureller Schäden bei der axialen SpA. Zehn von 13 Röntgenstudien konnten eine Korrelation zwischen radiologischen Schäden und funktionellen Parametern (Bath Ankylosing Spondylitis Function Index, Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index und diverse andere metrologische Tests) nachweisen. Der Vergleich der unterschiedlichen radiologischen Scores zur Dokumentation von Wirbelsäulenstrukturschäden ergab divergierende Ergebnisse. Fünf Studien wiesen eine gute Korrelation zwischen MRT- und/oder CT-verifizierten sowie Röntgenveränderungen nach. Keine eindeutige Assoziation besteht allerdings zwischen MRT-verifizierten strukturellen Läsionen und diversen klinischen, metrologischen Tests sowie dem Ansprechen auf Tumor-Nekrose-Faktor-α-Inhibitoren. Aktuell liegt keine Evidenz vor, wann die Indikation besteht und wie häufig eine MRT zum Monitoring von strukturellen Schäden bei axialer SpA durchgeführt werden soll.</li> </ul> <h2>5. Empfehlung: Monitoring der Erkrankungsaktivität – periphere SpA</h2> <p>Für das Monitoring der Erkrankungsaktivität bei der peripheren SpA können (insbesondere bei Verdacht auf Synovitis und Enthesitis) der US oder die MRT ergänzend zum klinischen und laborchemischen Assessment herangezogen werden. Wann und wie oft der US bzw. die MRT zur Aktivitätsbeurteilung eingesetzt wird, hängt von der klinischen Situation ab. Die Anwendung der hochsensitiven Farb-/Power-Doppler-Sonografie ist ausreichend; eine kontrastmittelunterstützte US-Untersuchung wird nicht empfohlen (SOR 9,3; 95 % CI: 8,9–9,7; LOE Ib).</p> <ul> <li>Hintergrund: 15 Studien erhoben die Rolle von bildgebenden Techniken zur Aktivitätsbeurteilung bei peripherer SpA. In den zehn Studien, welche die B-Bild/Power-Doppler-Sonografie zur Aktivitätsbeurteilung von Enthesen untersuchten, konnte keine eindeutige Assoziation mit diversen klinischen Parametern hergestellt werden. In vier longitudinalen MRT-Studien zeigten sowohl der für die rheumatoide Arthritis als auch die für die PsA (PsAMRIS) entwickelten MRT-Scores eine ausreichende Sensitivität, um Veränderungen zu detektieren. Allerdings bestand keine Assoziation zwischen dem MRT-verifizierten Knochenmarksödem und der klinischen Aktivität. Auch für die periphere SpA liegt aktuell keine Evidenz vor, wann und wie oft die US- bzw. MRT-Untersuchungen zur Aktivitätsbeurteilung durchgeführt werden sollen.</li> </ul> <h2>6. Empfehlung: Monitoring struktureller Veränderungen – periphere SpA</h2> <p>Bei klinischer Notwendigkeit wird bei der peripheren SpA zum Nachweis von strukturellen Schäden ebenfalls der Einsatz der konventionellen Radiografie empfohlen. Mittels MRT und/oder US können zusätzliche Informationen gewonnen werden (SOR 8,9; 95 % CI: 8,4–9,4; LOE III).</p> <ul> <li>Hintergrund: Zu dieser Fragestellung liegen Daten von sieben Studien zur konventionellen Radiografie vor. Davon evaluierte eine Studie auch die Rolle des Power-Doppler-US und eine Studie erhob die Rolle von der MRT zum Monitoring der strukturellen Veränderungen bei der peripheren SpA. Sowohl für die PsA und ReA als auch für die SpA konnte gezeigt werden, dass die radiografisch verifizierten Veränderungen mit diversen klinischen funktionellen Tests und auch sonografischen Scores gut korrelieren. Auch in der MRT war der Nachweis eines Knochenmarködems mit dem Vorliegen von erosiven Defekten und auch typischen radiologischen Veränderungen der Gelenkszerstörung (Gelenksspaltverschmälerung, Erosionen) bei der PsA assoziiert. Auch für diese Fragestellung, wann und wie oft der US oder die MRT eingesetzt werden soll, um strukturelle Veränderungen bei der peripheren SpA zu monitorisieren, besteht leider keine Evidenz.</li> </ul> <h2>7. Empfehlung: Prädiktion des Outcomes/Schweregrades der Erkrankung – axiale SpA</h2> <p>Bei Patienten mit einer radiografisch verifizierten axialen SpA (AS) wird zum Nachweis von Syndesmophyten, welche mit einem hohen, prädiktiven Wert für die Progression der Erkrankung assoziiert sind, die Durchführung eines konventionellen Röntgens der Hals- und Lendenwirbelsäule empfohlen. Der Nachweis von MRT-verifizierten „vertebral corner inflammatory lesions“ oder Fettläsionen kann ebenfalls zur Vorhersage von radiografisch nachweisbaren Syndesmophyten herangezogen werden (SOR 9,0; 95 % CI: 8,5–9,5; LOE Ib).</p> <ul> <li>Hintergrund: 17 Studien erhoben die Wertigkeit des Röntgens zur Verlaufsbeurteilung der axialen SpA. In allen Studien war der Nachweis von Syndesmophyten im Ausgangsröntgen mit der Progression der Erkrankung assoziiert. Eine hohe Erkrankungslast, gemessen am modified Stoke Ankylosing Spondylitis Score (mSASS, >10 Einheiten), gilt ebenfalls als unabhängiger Prädiktor für einen schlechten Verlauf der AS. In sechs Studien konnte nachgewiesen werden, dass sich aus MRT-verifizierten entzündlichen Wirbelkörperläsionen im Verlauf Syndesmophyten im Röntgen bei AS-Patienten bilden. Nicht nur die Rückbildung der MRT-verifizierten entzündlichen Wirbelkörperläsionen, sondern auch der entzündlichen Läsionen der SIG geht mit dem Fortschreiten der Wirbelsäulenbeteiligung einher. Die Frage, ob MRT-verifizierte Fettdegenerations- oder entzündliche Läsionen die Entstehung von Syndesmophyten besser voraussagen können, lässt sich anhand der vorliegenden Literatur nicht eindeutig beantworten.</li> </ul> <h2>8. Empfehlung: Voraussage des Therapieansprechens – axiale SpA</h2> <p>Eine ausgeprägte MRT-verifizierte Entzündung (Knochenmarksödem) der Wirbelsäule kann als Prädiktor für das wahrscheinliche Ansprechen auf eine TNF-α-Inhibitor-Therapie bei der axialen SpA herangezogen werden. Neben der klinischen Untersuchung und dem C-reaktiven Protein stellt die MRT somit eine weitere Entscheidungshilfe zur Indikationsstellung einer Anti-TNF-α-Therapie dar (SOR 8,9; 95 % CI: 8,3–9,5; LOE Ib).</p> <ul> <li>Hintergrund: Drei Studien wurden als Grundlage für diese Empfehlung herangezogen, allerdings bestanden bei allen Qualitätseinschränkungen in Hinblick auf Patientenselektion, Zeitpunkt und technische Durchführung der MRT-Untersuchung. Während der Nachweis einer hohen entzündlichen Aktivität der Wirbelsäule (gemessen an den Berlin-MRI-Spine- bzw. SPARCC-MRI-Scores) mit einem besseren Therapieansprechen auf eine TNF-α-Inhibitor-Therapie bei AS und nicht radiografischer axialer SpA assoziiert war, konnte bei HLA-B27-positiven Patienten mit MRT-verifizierter Sakroiliitis kein Unterschied zwischen dem Schweregrad der Knochenmarksläsionen und der Erkrankungsaktivität (gemessen am BASDAI) in Hinblick auf die Anti-TNF-α-Response beobachtet werden.</li> </ul> <h2>9. Empfehlung: Wirbelkörperfrakturen</h2> <p>Bei Verdacht auf das Vorliegen einer Wirbelkörperfraktur soll als initiale Maßnahme ein Röntgen durchgeführt werden. Bei einem negativen Röntgenbefund sollte zur weiterführenden Abklärung eine CT veranlasst werden. Die MRT-Untersuchung kann zusätzlich zur CT durchgeführt werden, um die Möglichkeit zur Beurteilung des umliegenden Weichteilgewebes auszuschöpfen (SOR 9,3; 95 % CI: 8,9–9,7; LOE IV).</p> <ul> <li>Hintergrund: Nachdem keine der Studien die formalen Einschlusskriterien erfüllte, wurden Daten aus zwei Studien (ohne Qualitätsassessment) mit gewisser Evidenz zur Fragestellung herangezogen. Bei elf AS-Patienten mit neurologischen Symptomen nach Zervikaltrauma wurden im Röntgen 82 % aller Frakturen detektiert, in CT und MRT konnten hingegen alle Frakturen erkannt werden. Den Daten aus der generellen Bevölkerung zufolge ist die Sensitivität der MRT zur Detektion von Zervikalfrakturen mit der des konventionellen Röntgens vergleichbar, allerdings war die MRT dem Röntgen in der Darstellung von Weichteilverletzungen überlegen und erlaubt zudem die Beurteilung des Rückenmarks.</li> </ul> <h2>10. Empfehlung: Osteoporose</h2> <p>Bei Patienten mit axialer SpA ohne radiologischen Nachweis von Syndesmophyten der Lendenwirbelsäule (LWS) soll eine Osteoporose mittels der dualen Röntgenabsorptiometrie (DXA) an Hüfte und Wirbelsäule erhoben werden. Im Falle von röntgenologisch nachgewiesenen Syndesmophyten der LWS soll eine Hüft-DXA-Untersuchung ergänzt durch eine laterale LWS-DXA bzw. alternativ eine quantitative CT-Untersuchung durchgeführt werden (SOR 9,4; 95 % CI: 9,0–9,8; LOE III).</p> <ul> <li>Hintergrund: 42 Studien und eine zusätzliche Arbeit mit Evidenz zur Fragestellung wurden zur Erarbeitung dieser Empfehlung verwendet. Während der quantitative US keinen zusätzlichen Nutzen im Vergleich zur DXA bringt, konnte in drei Studien belegt werden, dass die quantitative CT bei Patienten mit fortgeschrittener AS zur Detektion einer Osteoporose der Wirbelsäule der DXA an Wirbelsäule und Hüfte überlegen ist. Trotz des Vorliegens von Daten aus 37 Studien bleibt es ungeklärt, ob der Durchführungsort einen Einfluss auf die Detektionsrate von Osteoporose bei SpA-Patienten hat. In drei Studien konnte gezeigt werden, dass die laterale der ap/pa-Projektion an der Wirbelsäule überlegen ist, die DXA-Untersuchung am Unterarm jedoch gegenüber der herkömmlichen Methode (Wirbelsäule, Hüfte) keinerlei Vorteile bringt. Erkrankungsbedingte röntgenologische Veränderungen betreffen die Hüfte und die laterale Projektion weniger häufig als die ap/pa-Aufnahme der Wirbelsäule. Im Verlauf der Erkrankung zeigte sich eine positive Korrelation zwischen der Knochenmineraldichte und der Erkrankungsdauer in der ap-Aufnahme, welche für die laterale Projektion der Wirbelsäule sowie für die Hüfte nicht beobachtet wurde. Nur vier Studien evaluierten die Rolle der Knochendichtemessung im Verlauf der Erkrankung und konnten zeigen, dass Veränderungen nach 1–2 Jahren detektierbar und mit der Erkrankungsaktivität assoziiert waren. Im Qualitätsassessment zeigten fast alle eingeschlossenen Studien Einschränkungen, insbesondere in Hinblick auf die Durchführung des Indextests sowie den Referenzstandard.</li> </ul> <h2>Resümee</h2> <p>Die hier vorgestellten EULAR-Empfehlungen erlauben den gezielten Einsatz der Bildgebung zur Diagnose und zum Monitoring sowohl der axialen als auch der peripheren SpA sowie von deren Komplikationen (Osteoporose). Insbesondere wird auf die Bedeutung der Frühdiagnostik der Erkrankung hingewiesen, mit klaren Stellungnahmen zum Einsatz der MRT zur Diagnose der axialen SpA und der Verwendung des US oder der MRT bei peripherer SpA. Allerdings bleiben viele Fragen betreffend die Bedeutung pathologischer Befunde für den Verlauf und das Therapieansprechen der peripheren und axialen SpA, die klinische Wertigkeit von subklinischen Befunden sowie das Monitoring offen. Die vorgestellten Empfehlungen sollen als Grundlage zur Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Bildgebung in der rheumatologischen Praxis dienen.</p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Mandl P et al: EULAR recommendations for the use of imaging in the diagnosis and management of spondyloarthritis in clinical practice. Ann Rheum Dis 2015; 74(7): 1327-39 <strong>2</strong> Rudwaleit M et al: Ann Rheum Dis 2009; 68(6): 777-83 <strong>3</strong> Rudwaleit M et al: Ann Rheum Dis 2011; 70(1): 25-31 <strong>4</strong> van der Linden S et al: Arthritis Rheum 1984; 27(4): 361-8 <strong>5</strong> Braun J et al: Arthritis Rheum 1994; 37(7): 1039-45 <strong>6</strong> Lambert RGW et al: Ann Rheum Dis 2016. doi: 10.1136/annrheumdis-2015-208642 <strong>7</strong> Hermann KG et al: Ann Rheum Dis 2012; 71(8): 1278-88 <strong>8</strong> Schueller-Weidekamm C et al: Semin Musculoskelet Radiol 2014; 18(3): 265-79 <strong>9</strong> Calin A et al: JAMA 1977; 237(24): 2613-4 <strong>10</strong> Rudwaleit M et al: Arthritis Rheum 2006; 54(2): 569-78</p>
</div>
</p>