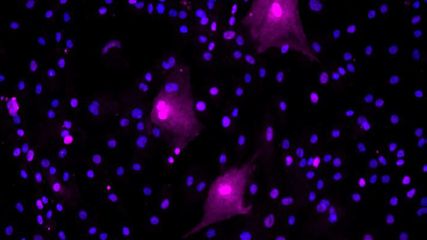©
Getty Images/iStockphoto
Ein klarerer Blick auf Kollagenosen
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
02.03.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Beim Medizinstudium kennt man die klaren Kriterien für Lupus, systemische Sklerose, Polymyositis & Co aus dem Effeff, denn oft wird man in den Prüfungen danach gefragt. Der Alltag sieht aber anders aus. Kollagenosen präsentieren sich nicht immer mit klaren Kriterien. Warum es trotzdem wichtig ist, die Krankheiten so früh wie möglich zu diagnostizieren, erklärte Prof. Dr. med. Oliver Distler aus Zürich auf dem Rheuma Top in Pfäffikon.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Kennen Sie den Blick auf die Churfirsten, vom Rotsteinpass? Für Kollegen, die nicht aus der Schweiz stammen: Die Churfirsten sind eine Gruppe von Bergen in den Appenzeller Alpen. Vom Pass aus hat man einen herrlichen Blick auf die sieben Churfirsten Selun, Frümsel, Brisi, Zuestoll, Schibenstoll, Hinterrugg und Chäserrugg. «Allerdings nur bei schönem Wetter», sagt Prof. Distler. «Bei Nebel kann man die Gipfel kaum voneinander unterscheiden – genauso ist das auch bei Kollagenosen.» Der Direktor der Klinik für Rheumatologie am Universitätsspital Zürich gab am diesjährigen «Rheuma Top» in Pfäffikon einen spannenden Überblick über Kollagenosen, wie man sie auseinanderhält und warum das mitunter nicht einfach ist. Als Student denke man öfters an Kollagenosen, erinnert sich Distler, weil man darüber häufig in den Multiple-Choice-Examina befragt werde. «Aber später, als Arzt, geraten Kollagenosen in Vergessenheit – man sieht ja in der Allgemeinpraxis kaum Patienten damit.»</p> <p>Kollagenosen sind chronisch-entzündliche Systemerkrankungen. Dazu gehören systemische Sklerose, systemischer Lupus erythematodes (SLE), Polymyositis/Dermatomyositis, Sjögren-Syndrom, sogenannte Mischkollagenosen, undifferenzierte Kollagenosen und «Overlap»-Syndrome. «Den Begriff Mischkollagenosen finde ich total unpassend», sagt Distler. «Es tönt so wie eine Mischung verschiedener Kollagenosen, es ist aber eine ganz spezifische Kollagenose, die mit spezifischen Antikörpern assoziiert ist.»<br /> Das Problem sei, dass bestimmte Beschwerden bei fast allen Kollagenosen vorkommen können, etwa das Sicca-Syndrom mit trockenen Augen und trockenem Mund oder eine Arthritis. Nach einer Vorlesung habe einmal ein Student zu Distler gesagt: «Die Einteilung der verschiedenen Kollagenosen ist doch Unsinn, wenn viele Symptome bei allen Kollagenosen vorkommen können. Die Unterscheidung erscheint mir arg artifiziell.» «Da hat er einen wunden Punkt angesprochen», so Distler. «Denn oftmals wissen wir vor allem zu Beginn der Erkrankung oder bei milden Fällen nicht oder noch nicht, was für eine Kollagenose es ist.» Wenn die Kollagenose «klar» sei, das heisst eindeutige Symptome verursache, könne man die Diagnose ziemlich leicht stellen und zum Beispiel sagen, dass es SLE oder eine Polymyositis ist. Wenn die Symptome aber verschleiert sind, ist die Diagnose oft nicht zu stellen. «Hängt die ganze Bergwelt voller Nebel, kann einem der Peak-Finder nicht sagen, ob der Gipfel zum Beispiel der Zuestoll oder der Schibenstoll ist. Ich weiss dann zwar, dass es eine Spitze der Churfirsten-Gruppe ist – also bei meinem Patienten eine Kollagenose –, aber nicht welche.»</p> <h2>Fallbeispiele</h2> <p>Lichtet sich der Nebel im Gebirge, sind die Gipfel plötzlich unterscheidbar. «So kann es sein, dass es im Laufe einer Kollagenosen- Krankheit deutlicher wird, was für eine es ist», sagt Distler. «Es kann aber auch sein, dass der Nebel in den Gipfeln hängen bleibt.» Bei einer 44-jährigen Frau mit neu aufgetretenem Raynaud- Syndrom und milder Polyarthritis sah Distler in der Kapillarmikroskopie dilatierte Kapillaren, aber keine typischen Riesenkapillaren, wie sie für systemische Sklerose, eine Mischkollagenose oder eine Dermatomyositis charakteristisch wären. Die ANA waren stark erhöht, aber die Differenzierung war unauffällig. Alle sonstigen Abklärungen waren ebenfalls unauffällig. Hier stellte Distler die Diagnose undifferenzierte Kollagenose. «Ich kann noch nicht sagen, in welche Richtung das geht. Aber es ist sicher, dass es eine Kollagenose ist.»<br /> Auch eine andere Patientin hatte zunächst ein Raynaud-Syndrom mit rezidivierenden Fingerkuppen-Ulzera und Nekrosen, ANA 1:640, anti-Scl-70, typische Hautzeichen mit modifiziertem Rodnan- Skin-Score von 32/51. Die Diagnose: systemische Sklerose. Nach sechs Jahren bekam die Frau eine schwere Polyarthritis mit mehreren Stunden Morgensteifigkeit. «Eigentlich könnte man argumentieren, eine weitere Diagnostik sei nicht nötig, weil 20 % der Patienten mit systemischer Sklerose eine Polyarthritis bekommen », sagt Distler. Er macht aber immer eine weiterführende Diagnostik – so auch bei dieser Patientin. Hier sah er im Röntgenbild klar Zeichen für eine rheumatoide Arthritis (RA). Die Frau hatte also nicht nur eine Sklerodermie, sondern im Verlauf auch zusätzlich eine RA entwickelt. Es liegt ein sogenanntes Overlap-Syndrom vor.<br /> Eine dritte Patientin klagte ebenfalls über ein neu aufgetretenes Raynaud-Syndrom. Ihre Finger waren teigig geschwollen («puffy fingers») und vor allem in den Metakarpophalangeal- und Handgelenken war eine Polyarthritis nachweisbar. Die Frau litt unter Myalgien, ihre Muskelkraft und die Kreatin-Kinase waren jedoch normal, ANA 1:1280 und U1-RNP-Antikörper positiv. «So präsentiert sich typischerweise eine Mischkollagenose», kommentiert Distler. Die Diagnose wird dann gestellt, wenn U1-RNP-Antikörper mit höherem Titer nachweisbar sind und drei oder mehr der folgenden klinischen Kriterien: geschwollene Hände, Akrosklerose, Raynaud- Syndrom, biologisch oder histologisch nachgewiesene Myositis sowie Synovitis.</p> <h2>Neue, sensitivere Klassifikationssysteme</h2> <p>Distlers wichtigste Botschaft ist, wie man Kollagenosen frühzeitiger erkennen kann. «Unser Ziel muss sein, Kollagenosen zu erfassen, bevor sie Schäden verursachen, denn diese lassen sich nur schwer rückgängig machen.» In den vergangenen Jahren wurden neue Kollagenose-Klassifikationssysteme entwickelt, die sensitiver sind und frühere und mildere Fälle identifizieren. «Die Kriterien sind empfindlicher geworden», sagt Distler. «Aber wenn der Patient sie nicht erfüllt, kann man nicht automatisch sagen, er habe keine Kollagenose.» So haben zum Beispiel vom spezifischen Kollektiv des Unispitals Zürich bis zu 50 % der Patienten, die die neuen EULAR-Kriterien für systemische Sklerose nicht erfüllen, trotzdem diese Krankheit.<sup>1, 2</sup> «Die Realität sieht oft anders aus. Klassifikationskriterien eignen sich nicht unbedingt zur Früherkennung.»<br /> Bei systemischer Sklerose dauere es in den USA im Schnitt ein Jahr, bis der Arzt die Diagnose gestellt habe, erzählt Distler. Ähnlich sei es bei SLE. «Für die Schweiz haben wir keine Daten, aber auch wir sind zu langsam.» Jeder kenne das aus dem Alltag: Hat ein Patient ein Raynaud-Phänomen, rät man oft zum Abwarten und bestellt den Patienten vier Wochen später zur Kontrolle. «Das dauert zu lange. Wir müssen in der frühen Phase behandeln, bevor die Fibrose beginnt.» Eine frühzeitige Diagnose und rechtzeitige Therapie können die Prognose entscheidend verbessern: So sterben 25 % der Patienten mit SLE innerhalb von 10 Jahren nach der Diagnose, wenn sie bereits Organschäden haben, und nur 7,3 % , wenn noch keine Schäden feststellbar sind.<sup>3</sup></p> <h2>Frühdiagnose ist wichtig</h2> <p>Die Hauptaufgabe in der Praxis sei es, eine Kollagenose frühzeitig zu erkennen und dann «relevante» Patienten zu identifizieren, d.h. diejenigen, die von einer Behandlung profitieren. Die Therapieoptionen seien immer noch ziemlich limitiert, gibt Distler zu, etwa Cyclophosphamid und Methotrexat bei systemischer Sklerose. «Es kündigen sich aber neue, wirksamere Therapien an. Ich sehe eine bevorstehende Revolution bei den Medikamenten », sagt Distler. So werden beispielsweise bei systemischer Sklerose und SLE diverse Antikörper und «small molecules» in fortgeschrittenen Studien getestet. Einer (Belimumab) ist sogar schon für SLE zugelassen. «Eine Vogel-Strauss-Taktik bei Kollagenosen zu verfolgen und zu sagen, man kann das ohnehin nicht weiter klassifizieren und nichts machen, davon halte ich nichts», schliesst Distler.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Ortho_1701_Weblinks_lo_ortho_1701_s70_bild.jpg" alt="" width="685" height="735" /></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Rheuma Top, 1.–2. September 2016, Pfäffikon
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Jordan S et al: Rheumatology 2015; 54(8): 1454-8 <strong>2</strong> Andréasson K et al: Ann Rheum Dis 2013; doi: 10.1136/annrheumdis- 2013-203618 <strong>3</strong> Rahman P et al: Lupus 2001; 10: 93-6</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...