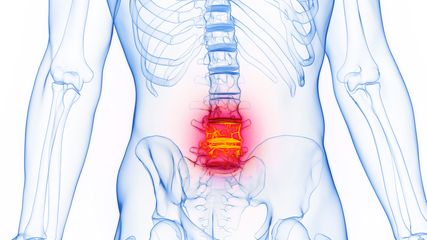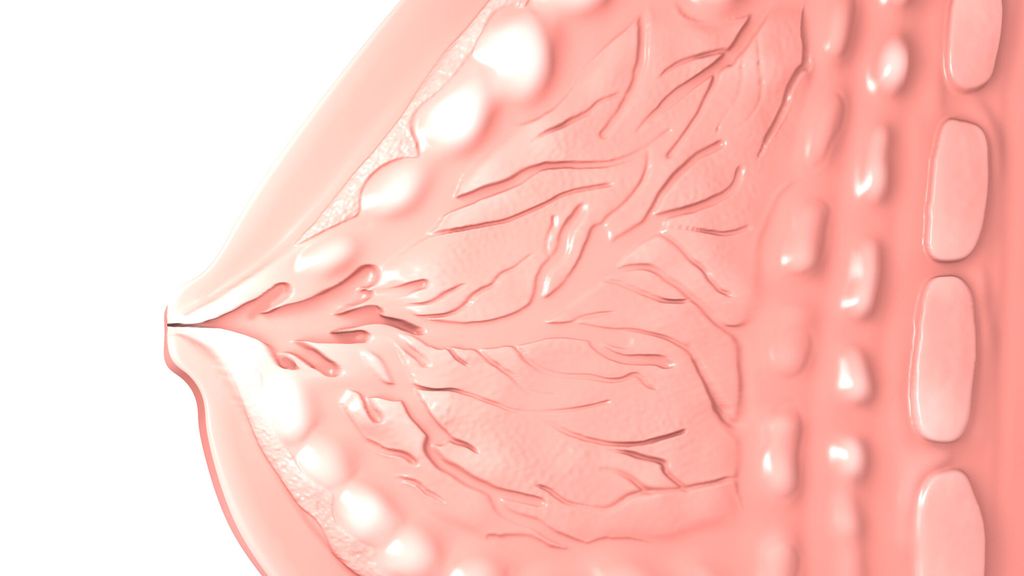
«Der Zusammenhang ist sehr schwach»
Unser Gesprächspartner:
Prof. Dr. med. Beat Thürlimann
Chefarzt Brustzentrum,
Kantonsspital St. Gallen
Das Interview führte Dr. med. Felicitas Witte
Frauen mit rheumatoider Arthritis (RA) haben laut einer schwedischen Registerstudie ein geringeres Risiko, an Brustkrebs zu erkranken.1 Wie soll man Patientinnen beraten? Müssen Frauen mit RA nun seltener zur Früherkennung?
Müssen Frauen mit RA nach den Ergebnissen dieser Studie nun seltener zur Brustkrebs-Früherkennung?
B. Thürlimann: Auf keinen Fall. Für diese Frauen gelten genau die gleichen Screening-Programme wie für andere Frauen. Zwar haben die Autoren in der Studie für Frauen mit RA ein geringeres Brustkrebsrisiko gefunden, aber der Effekt ist sehr klein. Schaut man sich die Hazard-Ratio an, ist das mit dem oberen 95%-Konfidenzintervall knapp unter 1 – der Zusammenhang ist statistisch zwar da, aber sehr schwach. Die Kollegen haben insgesamt Daten von 95362 Frauen ausgewertet. Wenn es so viele Studienteilnehmer braucht, um einen so kleinen Effekt zu zeigen, ist dieser absolut gesehen nicht so bedeutsam.
Welches Fazit ziehen Sie aus der Studie?
B. Thürlimann: Eine interessante wissenschaftliche Beobachtung – mehr nicht.
Was halten Sie von der Hypothese der Autoren, dass beiden Krankheiten ein gemeinsamer Pathomechanismus zugrunde liegen könnte?
B. Thürlimann: Das könnte theoretisch sein, zum Beispiel eine bestimmte HLA-Konstellation. Diese Konstellation würde dann das Risiko für RA erhöhen und gleichzeitig das für Brustkrebs senken. Aber das ist alles noch völlig spekulativ. Man müsste die Studie mit Registerdaten aus anderen Ländern wiederholen und vielleicht die HLA-Typen mitbestimmen. Es könnte sein, dass bestimmte HLA-Typen und andere disponierende genetische Faktoren in Schweden häufiger vorkommen und der Zusammenhang nur dort zu sehen ist. Falls sich wirklich ein gemeinsamer pathogenetischer Mechanismus ergibt, wäre das interessant – das würde ein neues therapeutisches Fenster öffnen.
Aber auch wenn der statistische Effekt schwach ist, ist er doch signifikant …
B. Thürlimann: Ja, aber die Autoren haben nicht für wichtige Einflussfaktoren adjustiert. Man hätte auf jeden Fall weitere Daten erheben müssen: das Alter bei der ersten Menarche, wann die Frauen in die Menopause kamen, ob und wie lange sie gestillt haben, ob die Frauen benigne Brusterkrankungen hatten oder ein dichtes Brustgewebe. Alle Einflussfaktoren kann man nicht herausrechnen, aber die wichtigsten müsste man in so einer Studie erfassen, um zu valideren Aussagen zu kommen.
Nehmen wir mal an, eine Frau mit RA bekommt Brustkrebs. Was muss man bezüglich der Behandlung beachten?
B. Thürlimann: Ob und wie man die RA-Medikation ändern muss, hängt von vielen Faktoren ab, und man sollte das immer im interdisziplinären Team besprechen. Während einer Chemotherapie empfehlen wir oftmals, die RA-Medikation zu pausieren. Interessanterweise fühlen sich die RA-Patientinnen unter einer Chemotherapie aber oft auch besser, selbst wenn man die RA-Medikamente absetzt. Denn die Chemotherapie kann immunsuppressiv wirken und das lindert dann offenbar auch die RA-Beschwerden. Soll die Frau beispielsweise Antikörper wie Trastuzumab erhalten oder eines der neueren, gezielt wirkenden Präparate, kann man in der Regel die RA-Medikamente weitergeben, denn diese Antikörper wirken nicht immunsuppressiv.
Welchen Frauen empfehlen Sie eine Mammografie?
B. Thürlimann: Unsere Früherkennungsprogramme sehen für Frauen zwischen 50 und 69 Jahren ein organisiertes Mammografie-Screening alle zwei Jahre vor. In manchen Programmen liegt die obere Altersgrenze bei 74 Jahren. Hat die Frau bestimmte Risikofaktoren, also etwa eine genetische Vorbelastung, gelten andere Empfehlungen.
Wie erklären Sie der Frau, welchen Nutzen sie von der Mammografie hat?
B. Thürlimann:Nicht alle Frauen profitieren vom Screening. Bei 1000 Frauen, die 20 Jahre am Screening teilnehmen, entdecken wir bei rund 750 nichts Auffälliges. Der mögliche Nutzen dabei liegt darin, dass sie das weiss und vorerst beruhigt sein kann. Bei den 250 Frauen mit auffälligem Befund ergeben die weiteren Abklärungen dann in 65 Fällen Brustkrebs. Wenn die 1000 Frauen keine Mammografie machen würden, würden 55 Frauen die Diagnose Brustkrebs bekommen und 20 an Brustkrebs sterben. In unserer fiktiven Gruppe von 1000 Frauen lassen sich durch das Screening im Schnitt 4 Brustkrebs-Todesfälle verhindern. Ich sage der Frau: Der Hauptvorteil der Mammografie liegt darin, dass wir Brustkrebs im Frühstadium entdecken und damit meist weniger ausgedehnt operieren und medikamentös behandeln müssen. Und dass wir das Risiko senken können, an Brustkrebs vorzeitig zu sterben. Der Hauptnachteil: Mit der Mammografie wird manchmal «falscher Alarm» ausgelöst und auch langsam wachsende Tumoren werden entdeckt, die nie lebensbedrohlich geworden wären, aber in der Regel trotzdem behandelt werden. Wie fast alles im Leben haben auch die Vorteile des Screenings ihren Preis. Letztendlich muss die Frau das selbst entscheiden.
Literatur:
1 Wadström H et al.: Ann Rheum Dis 2020; 79: 581-6
Das könnte Sie auch interessieren:
Bedeutung pulmonaler Symptome zum Zeitpunkt der Erstdiagnose
Bei der Erstdiagnose von entzündlich-rheumatischen Erkrankungen können bereits pulmonale Symptome vorliegen, dies muss jedoch nicht der Fall sein. Eine Studie des Rheumazentrums Jena hat ...
Betroffene effektiv behandeln und in hausärztliche Betreuung entlassen
Bei bestimmten Patientinnen und Patienten mit Gicht ist eine rheumatologisch-fachärztliche Betreuung sinnvoll. Eine im August 2024 veröffentlichte S3-Leitlinie zur Gicht macht deutlich, ...
Gezielte Therapien bei axSpA – und wie aus ihnen zu wählen ist
Nachdem 2003 der erste TNF-Blocker zugelassen wurde, existiert heute für die röntgenologische (r-axSpA) und die nichtröntgenologische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) eine ganze Reihe ...