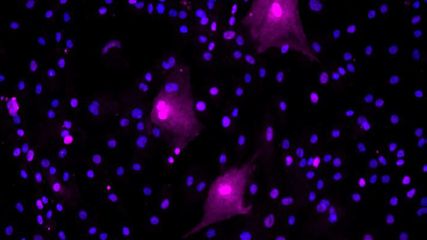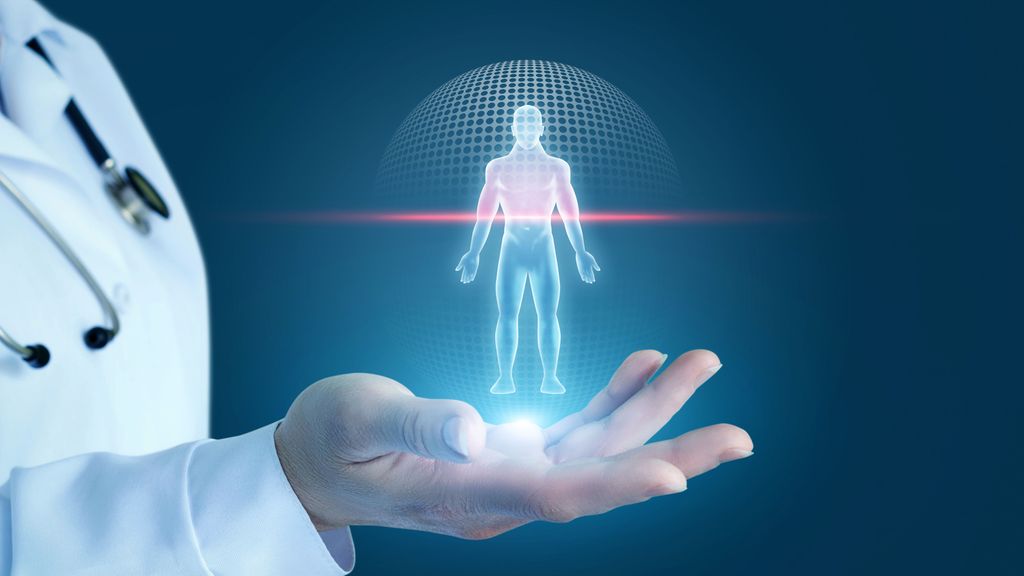
©
Getty Images/iStockphoto
41. Badener Rheumatologischer Fortbildungstag und 8. Burgenländischer Rheumatag
Jatros
30
Min. Lesezeit
21.09.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ein praxisbezogenes Programm wurde dieses Jahr in Baden geboten. Themen waren unter anderem die Transition von Jugendlichen und der Umgang mit Kortison. ÖGR-Präsident Dr. Rudolf Puchner sprach über Biologika und Biosimilars.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>Wenn Rheumakinder erwachsen werden</h2> <p>Der Übergang von der kinderrheumatologischen Betreuung in die Erwachsenenrheumatologie ist weder für die Patienten noch für die Angehörigen und Ärzte einfach. Was ändert sich? „In der Kinderrheumatologie ist die Betreuung familienorientiert, die Gespräche werden mehr mit den Eltern und weniger mit den Kindern geführt und die Betreuungsintensität ist relativ hoch“, erklärt Dr. Josef Feyertag, Wilhelminenspital, Wien. Aus dieser Situation wird der jugendliche Rheumapatient gleichsam „herausgerissen“ und kommt nun in die internistische Betreuung. „Internisten sind es nicht gewohnt, mit Eltern zu sprechen. Sie wollen mit dem Patienten sprechen.“ Die Betreuung wird symptomorientierter, die Betreuungsintensität sinkt deutlich. Für den Jugendlichen bedeutet dies, eine Verantwortlichkeit übernehmen zu müssen, die vorher hauptsächlich bei seinen Eltern gelegen ist.<br /> Definitionsgemäß soll Transition eine geplante, koordinierte Überleitung von chronisch kranken Jugendlichen aus der Kinder- in die Erwachsenenbetreuung sein. Die EULAR hat dazu Empfehlungen erarbeitet (Foster HE et al: Ann Rheum Dis 2017; 76: 639-46). Unter anderem wird darin betont, dass der Transitionsprozess schon möglichst früh – laut Feyertag ab dem 13. Lebensjahr – starten und einem geplanten Ablauf folgen soll, der mit dem Patienten und den Angehörigen erarbeitet wird. Jede betreuende Einrichtung sollte Strategien zur strukturierten Transition vorhalten und die individuellen Transitionsprozesse dokumentieren. In einigen europäischen Ländern (Großbritannien, Belgien, Niederlande, Deutschland) sind bereits eigene Transitionsprogramme geschaffen worden, die auch Checklisten anbieten (siehe z.B. www. berliner-transitionsprogramm.de).<br /> Für die Praxis empfiehlt Feyertag, sich für die erste Sprechstunde in der Erwachsenenrheumatologie eine ganze Stunde – ohne Störungen – Zeit zu nehmen, um mit dem jungen Patienten auch grundsätzliche Fragen erörtern zu können. „Oft wissen die Patienten nicht einmal, an welcher Krankheit genau sie leiden“, berichtet Feyertag. In weiterer Folge sollte der Arzt das Selbstmanagement der Jugendlichen fördern, indem er z.B. Terminvereinbarungen nicht mit den Eltern, sondern direkt mit dem Patienten trifft. Die Anwesenheit der Eltern in den Sprechstunden sollte alsbald nicht mehr nötig sein. Dann können auch Themen wie Sexualität, Drogen, Verhältnis zu den Eltern etc. gezielter angesprochen werden. Auch Berufswünsche bzw. Probleme in der Schule sollten besprochen werden, denn „in Schulen gibt es oft wenig Verständnis für diese Erkrankung“, so Feyertag.</p> <h2>Kunstfehler bei der Kortisontherapie vermeiden</h2> <p>„Fehler im Rahmen einer Kortisontherapie sind zunehmend Thema in gerichtlichen Prozessen“, weiß Dr. René Thonhofer, LKH Mürzzuschlag. Immer wieder komme es leider zu falschen Anwendungen, z.B. bei fehlender Indikation oder weil das Kortison zum falschen Zeitpunkt oder in einer falschen Dosis verabreicht wird. Wichtig sei es, folgende Punkte zu beachten:</p> <ul> <li>Kortison erst verabreichen, nachdem eine Diagnose gestellt worden ist, denn diese Therapie kann die rheumatologische Diagnostik verfälschen;</li> <li>unter Beachtung publizierter Leitlinien die richtige Dosis für die richtige Erkrankung finden und auch die Dosisreduktion empfehlungsgemäß durchführen;</li> <li>Morbidität und Mortalität bedenken.</li> </ul> <p><br /> „Kortison wäre ein ideales Arzneimittel, wenn es nicht so viele Nebenwirkungen hätte“, so Thonhofer. Von simplen Hautnebenwirkungen bis hin zu schweren Infektionen, Osteoporose, Diabetes und kardiovaskulären Problemen reichen die Komplikationen. Die Mortalität steigt bei 15mg/Tag nach einem Jahr auf das 3,6-Fache (Listing J et al: Ann Rheum Dis 2015; 74: 415-21). Häufig sind auch unerwünschte Wirkungen an den Augen wie Katarakt oder Glaukom, wobei die Katarakt schon bei geringer Dosierung auftreten kann. Nicht nur die tägliche, sondern auch die kumulative Dosis ist relevant für Nebenwirkungen. So erhöhen z.B. 5400mg das Risiko für eine osteoporotische Fraktur um das 13-Fache (Balasubramanian A et al: Osteoporos Int 2016; 27: 3239-49). Das entspricht in etwa einer zweijährigen Therapie mit 7,5mg.<br /> Ein laut Thonhofer zu wenig beachtetes Problem ist die kortisoninduzierte Nebenniereninsuffizienz, die im Mittel 37,4 % der behandelten Patienten betrifft: „Das Risiko dafür ist unabhängig von der Dosis und der Applikationsform und bleibt auch nach Absetzen der Kortisontherapie bestehen.“ Drei Jahre nach Beendigung der Kortisontherapie sind gemäß Studiendaten noch 15 % von einer Nebenniereninsuffizienz betroffen (Broersen LHA et al: J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2171-80; Joseph RM et al: Semin Arthritis Rheum 2016; 46: 133-41).<br /> Diesen Problemen steht der Nutzen einer Kortisontherapie gegenüber, der z.B. bei früher RA gegeben ist: Wenn zusätzlich zur Basistherapie intraartikulär Glukokortikoid verabreicht wird, reduziert das die entzündliche Aktivität und erhöht sowohl Remissionsraten als auch Lebensqualität (Kuusalo LA et al: Clin Exp Rheumatol 2016; 34: 1038-44). Unter Beachtung von Risiken und Nutzen ist jedoch auch der Einsatz systemischer Kortisongaben bei RA für die Betroffenen von Vorteil, insbesondere als „bridging“: Durch die rasche entzündungshemmende Wirkung von Kortison werden die Entzündung und damit auch die Schmerzen gelindert; auf diese Weise wird die Zeit bis zum Eintritt der Wirkung einer DMARD-Therapie überbrückt (Verschueren P et al: Arthritis Res Ther 2015; 17: 97). Zum Einsatz kommt Prednisolon in einer Dosis von 15 bis maximal 30mg. Die Vorteile einer lokalen gegenüber einer systemischen Kortisontherapie liegen in der kürzeren Zeitdauer bis zum Ansprechen und der geringeren Dosierung, wodurch es zu weniger Nebenwirkungen kommt. Auch im Vergleich mit der intramuskulären Gabe schneidet die intraartikuläre besser ab. Intraartikuläres Kortison gilt daher als integraler Bestandteil in der Behandlung der frühen RA. Wichtig bei Gelenkinfiltrationen: „Steril arbeiten und Gelenkergüsse zuerst absaugen!“, so Thonhofer.<br /> Systemische Glukokortikoide können bei rheumatischen Erkrankungen einen Benefit erbringen, z.B. bei der Therapie der Polymyalgia rheumatica, aus der sie nicht wegzudenken sind. Als Initialdosis werden 12,5–25mg Prednisolonäquivalent gegeben. „Hier sind im Einzelfall Nutzen und Risiko sorgfältig abzuwägen“, betont Thonhofer, „beispielsweise das Rezidivrisiko gegen ein eventuell vorhandenes Diabetesrisiko.“ Auch die Dosisreduktion sollte nach einem individualisierten Therapieplan unter Berücksichtigung von Krankheitsaktivität und Komorbiditäten erfolgen. In der Regel wird nach 4–8 Wochen auf 10mg reduziert, in weiterer Folge alle 4 Wochen um 1mg bis zum Ausschleichen.<br /> Bei unkomplizierter Riesenzellarteriitis werden 40–60mg Prednisolon oral empfohlen, bei komplizierter 0,5–1g Methylprednisolon i.v. für 3 Tage. Während der ein- bis dreijährigen Therapiedauer soll nach 2–4 Wochen alle 2 Wochen um 10mg bis auf eine Tagesdosis von 20mg reduziert werden, danach alle 2–8 Wochen um 1–2,5mg (Buttgereit F et al: JAMA 2016; 315: 2442-58). „Rezidive treten bei bis zu fünfzig Prozent der Patienten auf, meist bei einer Dosis von weniger als 10mg Prednisolon“, erklärt Thonhofer. „Andererseits sehen wir viele Komplikationen. Besonders gefürchtet ist eine Sepsis mit gramnegativen Keimen.“ Bei Polymyalgia rheumatica und Riesenzellarteriitis plädiert Thonhofer daher für kortisonsparende Therapien, insbesondere wenn kardiovaskuläre Komorbiditäten vorhanden sind. Für die Kortisoninitialdosis bei RA gibt es keine genauen Empfehlungen. Derzeit werden meist 15–30mg Prednisolon peroral als Überbrückung bis zum Wirkeintritt der Basistherapie verordnet. Dieses Vorgehen verbessert nicht nur die Lebensqualität, sondern hat auch nachhaltig günstige Effekte auf klinische und radiologische Parameter (Smolen JS et al: Ann Rheum Dis 2017; 0: 1-18). „Nach drei bis sechs Monaten sollte Kortison aber ausgeschlichen sein“, weiß Thonhofer.<br /> Auch die Initialtherapie der Arthritis urica benötigt systemisches Kortison, und zwar 30–35mg Prednisolonäquivalent für 5 Tage. Nach dem Gichtanfall können neben der harnsäuresenkenden Therapie 5–7,5mg Kortison als Prophylaxe verschrieben werden. Hierfür gibt es aber auch Alternativen wie NSAR, Colchizin oder IL-1-Hemmer.<br /> Bei Psoriasisarthritis sind systemische Glukokortikoide mit Zurückhaltung anzuwenden, die Dosierung soll abhängig von der entzündlichen Aktivität und den Risiken erfolgen. Allgemeine Empfehlungen gibt es nicht. Bei Befall des Axialskelettes besteht keine Indikation für Kortison. „Insgesamt gilt für jede Kortisontherapie: so wenig und so kurz wie möglich, aber so hoch und so viel wie nötig“, so Thonhofer zusammenfassend. „Und immer an die Möglichkeit einer lokalen Applikation denken.“</p> <h2>Biologika und Biosimilars</h2> <p>Biologika haben die Behandlung und Prävention vieler Erkrankungen revolutioniert. Für Rheumatologen sind sie mittlerweile unverzichtbar geworden. „Die Einführung der Biologika war für mich eine der wesentlichsten Bereicherungen in meiner beruflichen Laufbahn“, berichtet Dr. Rudolf Puchner, Wels.<br /> Biologika sind nicht billig, sie sind ein erheblicher Kostenfaktor für das Gesundheitsbudget. Da sie nun aber nach und nach das Ende ihrer Patentdauer erreichen, nützt die pharmazeutische Industrie die Möglichkeit, sehr ähnliche Produkte zu entwickeln und zu vermarkten. Diese können – unter der Bezeichnung Biosimilars – zu niedrigeren Preisen angeboten werden. Allerdings ist hier der Preisunterschied nicht so groß wie derjenige zwischen herkömmlichen Arzneimitteln und Generika, denn der Herstellungsprozess ist ähnlich aufwendig und es muss ein Zulassungsprocedere durchlaufen werden. Mit einer Kostenersparnis von derzeit etwa 30 % im Vergleich zu Biologika kann immerhin gerechnet werden.<br /> Biosimilars werden das Gesundheitsbudget also entlasten. „Dies sollte dazu führen, dass sehr wirksame Medikamente in verschiedenen Ländern breiter eingesetzt werden können“, hofft Puchner. Der Zugang zu Biologika ist nämlich international sehr unterschiedlich und keineswegs überall optimal. So variieren z.B. die Verschreibungskriterien: In Deutschland und Österreich sind Biologika zur Behandlung der rheumatoiden Arthritis (RA) bei einem DAS28-Score >3,2 verschreibbar, in England und Italien erst bei einem DAS28 >5,1. Die QUEST-RA-Studie (Sokka T et al: Ann Rheum Dis 2007; 66: 1491- 6) hat einen starken inversen Zusammenhang zwischen dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) eines Landes und dem durchschnittlichen DAS28-Wert festgestellt. „Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Wohlfahrt eines Landes streng mit der Krankheitslast assoziiert ist“, erklärt Puchner. Der Anteil an Patienten mit RA, die Biologika erhalten, variiert ebenfalls von Land zu Land und beträgt z.B. in Deutschland 25 % , in Polen hingegen nur 1,3 % (Pentek M et al: Eur J Health Econ 2014; 15(suppl 1): 35-43; Huscher D et al: Ann Rheum Dis 2015; 74: 738-45). Die COMORA-Studie (Dougados M et al: Ann Rheum Dis 2014; 73: 62-8) hat eine klare Assoziation zwischen Krankheitsaktivität und sozioökonomischem Status belegt, und zwar sowohl auf individuellem Level, in Bezug auf Ausbildung, als auch auf Länderebene, gemessen am BIP.<br /> Im Gegensatz zu klassischen Arzneimitteln, die durch chemische Synthese oder Extraktion hergestellt werden, benötigt man für die Produktion von Biologika und Biosimilars lebende Wirtszellen. Dieses Verfahren bedingt Variabilitäten in der Molekülstruktur der Endprodukte. „Die Herstellung eines völlig identischen Nachbaus eines Biologikums ist technisch kaum möglich“, weiß Puchner. „Auch das Originalprodukt weist schon eine gewisse Variabilität auf.“<br /> Hinsichtlich Qualität und Sicherheit sind Biosimilars nach derzeitigem Wissensstand als gleichwertig zu betrachten. „Die gesetzlichen Bestimmungen, die zur Zulassung eines Biosimilars führen, sind in Europa und in den USA sehr streng“, so Puchner. Die Herstellung muss nach den gleichen Pfaden und Richtlinien erfolgen, wie sie bei den Biologika angewandt werden. Abweichungen in der Molekülstruktur dürfen nicht die wirksame Aminosäuresequenz betreffen. Eine biologisch gleichwertige Wirksamkeit muss durch Äquivalenzstudien nachgewiesen werden, und auch Pharmakodynamik und Pharmakokinetik müssen mit dem ursprünglichen Biologikum äquivalent sein.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Ortho_1705_Weblinks_s89_abb1.jpg" alt="" width="1455" height="922" /></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: 41. Badener Rheumatologischer Fortbildungstag und
8. Burgenländischer Rheumatag, 20. Mai 2017, Baden
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Neue Therapieansätze für Arthrose
Dass Zellen altern, könnte eine entscheidende Rolle bei der Entstehung von Arthrose spielen. Welche Mechanismen dahinterstecken und welche Ansätze sich für neue Therapien ergeben, ...
Fertilität und Schwangerschaft bei entzündlicher Arthritis
Auf der 13. International Conference on Reproduction, Pregnancy and Rheumatic Diseases (RheumaPreg 2025) in Wien präsentierte Prof. Dr. Radboud Dolhain (Rotterdam, NL) aktuelle ...
Therapieauswahl nach pulmonalem Inflammations- und Fibrosemuster
Da Fibrose und Entzündung in unterschiedlichem Ausmaß zu Lungenbeteiligungen bei rheumatologischen Erkrankungen beitragen, werden im klinischen Alltag Methoden gebraucht, um beide ...