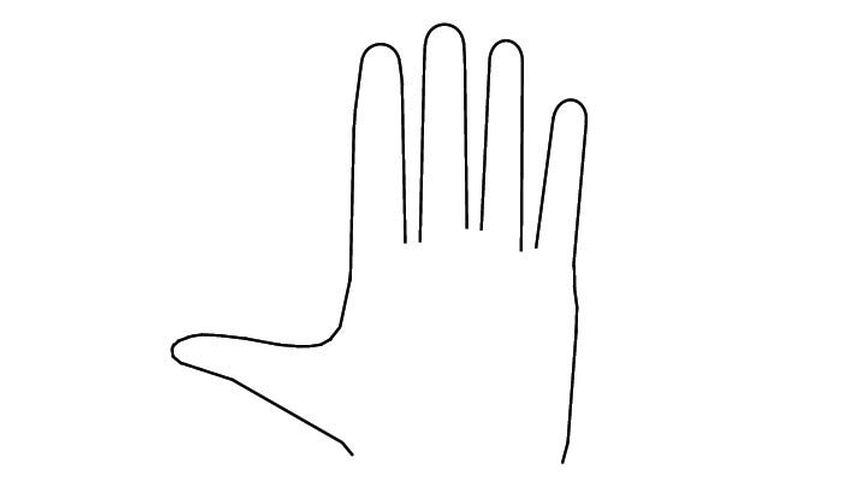Wir müssen Alkoholabhängige auch medikamentös behandeln
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Alkoholabhängige brauchen genauso wie z.B. Diabetiker eine gute medikamentöse Einstellung. Bisher gibt es da nichts Etabliertes. Aber es zeichnen sich neue Ansätze ab, mit denen es erstaunlich gut geht.
Keypoints
-
Für die medikamentöse Einstellung einer Alkoholabhängigkeit bieten sich agonistische Substanzen aus verschiedenen Stoffgruppen an, vor allem Dihydrocodein und andere Opioide, aber auch Clomethiazol, Baclofen, in Einzelfällen Cannabis, Amphetamine und GHB.
-
Alles wartet auf die nötige, wissenschaftliche Entwicklung. Bisherige Erfolge sind ausgesprochen ermutigend und versprechen eine ganz neue Behandlungsära.
-
Mehrere dieser Substanzen sind bei ungenügender Patientenbetreuung hoch gefährlich, aber bei gut strukturierter Behandlung sehr sicher.
Bedeutung der Alkoholabhängigkeit
Alkoholabhängigkeit ist weltweit eine der bedeutendsten Krankheiten. Sie gehört mit jährlich mehr als 3 Millionen Toten zu den größten gesundheitlichen Herausforderungen. Viele Betroffene und ihre Angehörigen können ein Lied davon singen, wie furchtbar diese Krankheit zuschlagen und wie viele Leben sie zerstören kann. Prinzipiell weist sie viele Parallelen zu anderen großen chronischen Krankheiten wie z.B. Diabetes und Hypertonie auf: meist schleichender Beginn, eine unscharfe Grenze zwischen noch gesund und krank, phasenweise Verschlimmerungen, öfters akute, krisenhafte Zuspitzungen und Münden in Komplikationen mit starker Verkürzung der Lebenserwartung (20 Jahre!).1
Aber Lebensqualität und Prognose unterscheiden sich fundamental: Bei vielen anderen Krankheiten sind sie dank guter Behandlung weitgehend normal, bei einer Alkoholabhängigkeit jedoch nicht. Es kommt zu unzähligen gravierendsten Abweichungen. Jeder kennt die Persönlichkeitsveränderungen, Aggressivität, Kriminalität, Verkehrsunfälle, Leistungsdefizite, soziale Abstiege bis zum Erfrieren unter der Brücke. Jeder Mediziner kennt das Spektrum schwerer körperlicher Folgen. Und Alkohol während der Schwangerschaft führt neben einer großen Zahl von Aborten dazu, dass 2–5% der Bevölkerung an FASD leiden müssen, einer schweren, lebenslangen Behinderung, der häufigsten Entwicklungsstörung auf der Welt.
Fehlende medikamentöse Behandlung
Warum sind die Folgen bei der Alkoholabhängigkeit so fundamental anders? Weil es bei ihr keine medikamentöse Einstellung gibt! Unsere Patienten waren etwa 97% ihrer Krankheitszeit ohne therapeutische Hilfe, bevor sie zu uns kamen. Man muss sich das einmal klarmachen: Eine Krankheit, die zu den eingreifendsten gehört, deren Folgeschäden allein in Deutschland jährlich auf zwischen 26 und 40 Milliarden Euro geschätzt werden – und die Kranken werden fast die gesamte Zeit über sich selbst überlassen!
Kommt es bei einer anderen chronischen Krankheit wegen einer Verschlimmerung zu einer stationären Behandlung, wird dort in der Regel die medikamentöse Behandlung neu eingestellt – als Basis für die nahtlose Weiterbetreuung beim Haus- oder Facharzt. Alkoholabhängige aber werden de facto wieder in die Nichtbehandlung entlassen. Sie erhalten allenfalls den Rat, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Das ist insuffizient. Eine medikamentöse Einstellung fehlt.
Es gibt auch nur kümmerlich wenige zugelassene Substanzen: in Deutschland Acamprosat, Naltrexon und Nalmefen. Sie sind alle wenig effektiv und spielen in der Praxis so gut wie keine Rolle. Kaum einer unserer 539 Patienten war in durchschnittlich >18 Jahren Vorgeschichte je damit behandelt worden.
Der agonistische Ansatz
Wo kann ein echter Ansatz sein, der das ändert? Schauen wir genau hin! Er bietet sich sehr überzeugend an.
Bisher gilt: Abstinenz oder Alkohol! Im Bild einer Hand heißt das: Daumen oder Zeigefinger (Abb. 1). Der abgespreizte Daumen des Ausstiegs ist relativ klein, weil nur relativ wenige damit dauerhaft zurechtkommen. Die Krankheit ist ja chronisch – lebenslang. Wie bei anderen chronischen Krankheiten entkommt man ihr nur selten. Scheitert man also an der Abstinenz, was demnach ganz natürlich ist, macht die Krankheit das, was alle chronischen Krankheiten machen: Sie macht immer weiter oder kommt wieder und wieder.
Süchtig ist man, weil man etwas braucht. Kann man dieses „Brauchen“ also nicht abstreifen, dann muss man es in irgendeiner Form bedienen. Alkohol ist dafür eine besonders ungünstige Substanz, denn er
macht betrunken,
ist ein Gift für praktisch alle Organe und Gewebe und
ist eine Substanz, dessen Konsummenge häufig schwer oder gar nicht steuerbar ist.
Abb. 1: Alkoholabhängigkeit: Das Dilemma „Alkohol oder Abstinenz“ symbolisch dargestellt durch den Daumen und den Zeigefinger an einer Hand. Die anderen Finger stehen für bessere therapeutische Alternativen.
Wenn die Substanz so furchtbar eingreifende Nebenwirkungen hat, warum brauchen wir sie dann? Was „brauchen“ die Abhängigen denn genau? Fragen wir sie das, nennen sie meist „Beruhigung“ oder „Abschalten“, wohl eine Filterfunktion gegenüber Stress und Sorgen. Man kann auch sagen: ein wenig Entspannung und eine zumindest leichte Stimmungsaufhellung. Auch viele nicht Suchtkranke konsumieren genau deshalb Alkohol. Diese erwünschte Wirkung ist also allgemein akzeptiert.
Wenn man darüber aber suchtkrank geworden ist und Alkohol so viele Probleme macht, kann man dann die erwünschte ganz leichte Entspannung und Stimmungsaufhellung nicht vielleicht über andere Substanzen mit weniger Nebenwirkungen erhalten? Ohne betrunken zu werden, ohne die Giftigkeit für die Organe und Gewebe und mit besserer Steuerbarkeit? Den Alkohol damit ersetzen?
Genau das ist der neue Ansatz. Man nennt es ein agonistisches Prinzip. Im Gegensatz zu einem Antagonisten, der versucht, die Wirksamkeit oder Verträglichkeit von Alkohol zu blockieren, versucht eine agonistische Substanz, dem Menschen etwas von der erwünschten Alkoholwirkung zu geben. Sie „agiert“ also ähnlich wie der Alkohol, nur mit entscheidend weniger Nebenwirkungen. „Agieren“ und „agonistisch“ kommen vom griechischen „agein“ – wirken.
Idealerweise sind die Entspannung und Stimmungsaufhellung so unmerklich, dass kein Nebenwirkungsgefühl aufkommt. Es ist keine „Bedröhnung“, keine Betrunkenheit, Müdigkeit oder Störung der geistigen Leistungsfähigkeit feststellbar, die ideale Wirkung und Rückmeldung sind: „Ich fühle mich normal“. Und: „Das Verlangen nach Alkohol ist weg“ oder „viel geringer“.
Es gibt ein ganzes Spektrum möglicher Substanzen aus verschiedenen Stoffgruppen, die das leisten. Im Bild der Hand entsprechen sie den weiteren Fingern. Mit ihnen wird das „Brauchen“ des Süchtigen weiter bedient. Das Abhängigsein setzt sich also erst einmal fort. Den entscheidenden Unterschied machen die viel geringeren Nebenwirkungen. Er ist so ausgeprägt, dass immer wieder die Beschreibung „wie von Nacht zu Tag“ gebraucht wird.
Nutzen durch Opioide, vor allem Dihydrocodein (DHC)
Der bei Weitem überzeugendste Ersatz von Alkohol durch eine andere agonistische Substanz ist uns bisher mit DHC gelungen. Wir haben 116 schwer Alkoholabhängige damit behandelt und 2012 und 2019 erste statistische Auswertungen publiziert.2, 3 Es gibt eine Reihe von Patienten, die Bedenken haben, sich auf dieses Opioid einstellen zu lassen. Wenige empfinden auch die Wirkung nicht als das, was sie sich wünschen. Als gelegentliche Nebenwirkungen, die in Einzelfällen eine weitere Einnahme unmöglich machen, kommen Juckreiz und eine stärkere Obstipation mit Übelkeit vor. Aber weit überwiegend ist die Verträglichkeit ausgezeichnet. Die Haltequote derer, die bei der DHC-Behandlung blieben, war nach 1 Jahr 52,6%, nach 4 Jahren 26,4%. Das heißt, wir konnten erstmals bei einer relevanten Zahl von Alkoholabhängigen eine medikamentöse Einstellung über Jahre realisieren.
Das strenge Kriterium einer durchgehenden Alkoholabstinenz erfüllten nach 1 Jahr 15,5%, nach 2 Jahren 12,9%. Auch ohne dieses Kriterium erreichten 24,6% von allen, denen wir jemals ein DHC-Rezept ausgestellt haben, langfristig das umfassende Ziel, wieder über Jahre wie Gesunde stabil ohne Suchtdruck und Rückfälle leben zu können. Von denen, die zwei Jahre dabei blieben, waren es schon 60,5%. Einer Auswertung von allen, die wir länger als 8 Jahre kontinuierlich betreut haben, zeigte, dass die Patienten ohne durchgehende DHC-Behandlung mehr als 70-mal so viele stationäre Entzüge gebraucht haben wie die DHC-Patienten. Das alles bedeutete immer wieder eine nachhaltige Wende: Auflösung der ganzen Suchtkrankheitssymptomatik und bei vielen ein guter Reifungsprozess unter jahrelanger Behandlung, weg vom suchtgeprägten alkoholischen Leben zu einer immer umfassenderen Normalität.
Dass DHC ein Opioid ist und man damit opioidabhängig wird, hat natürlich Angst ausgelöst. Nicht wenigen wurde deshalb von anderen abgeraten. Aber bei unserer Art der Behandlungsstrukturierung erweist sich die induzierte Abhängigkeit praktisch ausnahmslos als problemlos. Wer vom DHC nicht profitiert, es nicht mag oder nicht verträgt, verlässt die DHC-Behandlung meist innerhalb von Tagen bis Monaten, selten nach wenigen Jahren wieder, ohne dass wir Rückmeldungen zu schweren Entzügen erhalten. Es gibt also einen gangbaren Ausweg aus einer medizinisch herbeigeführten Opioidabhängigkeit. Und wer von einer DHC-Behandlung profitiert, tut gut daran, sie mit großer Geduld weiterzuführen und mit einem Wunsch nach einem Ausstieg sehr vorsichtig umzugehen. Der ist aber gut und erfolgreich möglich. Mit anderen Opioiden – Buprenorphin,4 MST, Tapendadol und Methadon – haben wir in kleiner Zahl prinzipiell ähnliche Erfahrungen gemacht.
Das häufige schwere Alkoholproblem von Patienten in Methadonbehandlung lässt sich mit einer langsamen, starken Dosissteigerung und dem unbedingten Splitten der Dosis beeindruckend erfolgreich behandeln.5,6 Jedwede agonistische Suchtmedizin steht und fällt mit einer sorgfältigen, gewissenhaften Behandlungsstrukturierung: gute Einführung, regelmäßige, eingehende Gespräche, Dosis immer nach Plan statt nach Bedarf, Anvertrauen von nur begrenzten Mengen. Wir dürfen nie vergessen, dass ärztlich verordnete Opioide, auch das DHC,7 immer wenn die adäquate Betreuung fehlt, schon viele Menschen umgebracht haben. Die amerikanische Opioidkrise8 zeigt eine riesige, fast kollektive Entgleisung. Deswegen muss eine Art Gewissenhaftigkeitsstruktur gewährleistet sein.
Clomethiazol und ambulante Entzüge
Das gilt auch für Clomethiazol, bei dem es ebenfalls unter mangelhafter Betreuung so viele, auch tödliche Entgleisungen gegeben hat,9 dass seine Zulassung für ambulante Verordnungen in Deutschland 2005 widerrufen wurde. Aber mit adäquater Gewissenhaftigkeitsstruktur ist es eine weitere ungemein wertvolle agonistische Substanz, die aus einem differenzierten Behandlungsalltag nicht mehr wegzudenken ist. Alle sagen, es habe ein hohes Abhängigkeitspotenzial. Bei richtiger Behandlungsstruktruierung stimmt das nicht.
Vor allem ambulante Entzüge, die wir in großer Zahl Clomethiazol-gestützt durchgeführt haben, sind ein unverzichtbares Behandlungselement, das in unzähligen Fällen helfen kann, viel pragmatischer mit allen möglichen Krankheitszuspitzungen umzugehen.
Baclofen
In den letzten Jahren wurde Baclofen zur gefragtesten Substanz. Es ist nicht, wie Clomethiazol und DHC, mit direkter Abhängigkeit verbunden. Man kann einfach mit einer Eindosierung beginnen, während noch getrunken wird. Aber seine agonistische Kraft ist vergleichsweise gering. Von den 60 Patienten, die wir mit Baclofen behandelt haben, haben nur 10% davon im Sinne einer nachhaltigen Wende profitiert. Das ist viel weniger als beim DHC, aber immerhin. Alle genannten Substanzen lassen sich auch differenziert kombinieren.
Weitere Substanzen
Vieles spricht dafür, dass sich das Spektrum hilfreicher agonistischer Substanzen noch erheblich erweitern lässt, wenn dieser Ansatz systematisch weiterentwickelt wird. Infrage kommen insbesondere Cannabis, Amphetamine und das in Italien zugelassene GHB.10 Zu all diesen Substanzen gibt es erste Fälle der Bewährung, die wir angesichts der Schwere der Alkoholproblematik alle systematisch ernst nehmen und weiter studieren müssen.
Perspektive
Mit einem agonistischen Behandlungsansatz bietet sich uns eine neue Möglichkeit zur Behandlung von alkoholabhängigen Menschen. Endlich können wir sie ähnlich medikamentös einstellen wie Menschen mit anderen chronischen Krankheiten und ihnen in viel größerer Zahl ein Leben ermöglichen, das dem eines Gesunden entspricht. Wer das einmal erlebt hat, möchte nicht mehr darauf verzichten.
Aber eine wirkliche Perspektive wird nur daraus, wenn es systematisch wissenschaftlich entwickelt wird und immer alles dafür getan wird, dass eine gut strukturierte Behandlung selbstverständlicher Standard ist.
Eine ausführliche Darstellung der Thematik erscheint demnächst in einem Buch mit dem voraussichtlichen Titel „Alkoholabhängigkeit anders behandeln“.
Literatur:
1 John U et al.: Excess mortality of alcohol-dependent individuals after 14 years and mortality predictors based on treatment participation and severity of alcohol dependence. Alcohol Clin Exp Res 2013; 37(1): 156-63 2 Ulmer A et al.: Dihydrocodeine/agonists for alcohol dependents. Frontiers in Psychiatry/Addict Dis 2012; 3(21): 1-7 3 Ulmer A et al.: Medical adjustment of alcohol dependence – a comparison of treatment results with dihydrocodeine and acamprosate. Heroin Addict Relat Clin Probl 2019; published ahead of print 4 Ulmer A, Meinhold C: Buprenorphine for the treatment of alcohol dependence: 14 attempts, 3 successful cases. Heroin Addict Relat Clin Probl 2020; 22 (2): 23-28 5 Ulmer A et al.: How to improve a poorly running agonist opioid treatment. Part 4: dosage splitting. Heroin Addict Relat Clin Probl 2017; 19(6): 57-64 6 Ulmer A, Meinhold C: How to improve a poorly running agonist opioid treatment. Part 5: higher dosage. Heroin Addict Relat Clin Probl 2018; 20(2): 41-50 7 Penning R et al.: Drogentodesfälle durch dihydrocodeinhaltige Ersatzmittel. Deutsches Ärzteblatt 1993; 90: 528-9 8 Preuss UW et al.: Die Opioidkrise in den USA: Ausmaß, Ursachen, Gegenmaßnahmen und die europäische Situation im Vergleich. Suchttherapie 2020; 21: 85-97 9 Faerber D, Toelle R: Warnende Hinweise zur Verschreibung von Clomethiazol (Distraneurin ® ). Dt. Aerztebl 1996; 93: A-2098 10 Caputo F et al.: Sodium oxybate in maintaining alcohol abstinence in alcoholic patients with and without psychiatric comorbidity. Eur Neuropsychopharmacol 2011; 21(6): 450-6
Das könnte Sie auch interessieren:
Phytotherapie bei Angsterkrankungen und assoziierten Beschwerden
Pflanzliche Arzneimittel gewinnen immer mehr Bedeutung in der Psychiatrie. Insbesondere bei Angsterkrankungen und Depressionen stellen Phytotherapeutika eine sinnvolle Alternative zu ...
Machine Learning zur Verbesserung der Versorgung ausländischer Patient:innen
Die zunehmende Diversität aufgrund von Migration bringt spezifische Herausforderungen hinsichtlich Kommunikation, kultureller Deutung von Symptomen sowie institutioneller Strukturen mit ...
Stellungnahme zum Konsensus Statement Schizophrenie 2023
In dem Konsensus Statement Schizophrenie 20231 wurde die Sachlage zur Diagnostik und Therapie schizophrener Erkrankungen in 19 Kapiteln erarbeitet. Doch besteht im Bereich der ...