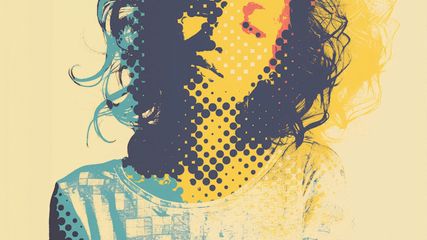©
Getty Images/iStockphoto
Wie erkenne ich „Bipolarität“ in der Allgemeinpraxis?
DAM
Autor:
Univ.-Prof. Dr. Christian Simhandl
Facharzt für Psychiatrie & Psychotherapeutische Medizin Arzt für Psychotherapie, BIPOLAR Zentrum Wiener Neustadt E-Mail: psychiatrie@simhandl.at
30
Min. Lesezeit
22.12.2016
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Stimmungsschwankungen, Phasen der Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit sowie Phasen der Euphorie, Gereiztheit oder Aggressivität kennt jeder Mensch aus eigener Erfahrung. Die Übergänge von einer normalen Entwicklung zu einer behandlungsbedürftigen Störung sind fließend.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Handlungsbedarf besteht dann, wenn die Stimmungsveränderungen länger anhalten – die diagnostischen Kriterien sprechen von 2 Wochen bei der depressiven Episode und 1 Woche bei der manischen Episode – und sich die Betroffenen und/oder deren Angehörige in ihrem Erleben oder Funktionieren im Alltag beeinträchtigt fühlen. Bei den meisten Patienten mit einer bipolaren Störung sind das sogenannte Burnout und depressive Symptome der Anlass für einen Arztbesuch. Bei der Anamneseerhebung gilt es, auch vorangegangene Symptome zu erfassen, die auf eine Manie hinweisen könnten.</p> <p>Da die Symptome einer – vor allem leicht ausgeprägten – Manie von den Betroffenen häufig nicht als belastend empfunden werden, berichten sie beim Arztbesuch (ebenso beim Therapeuten) oftmals nicht davon bzw. haben sie diese gar nicht als Problem und schon gar nicht als Krankheit wahrgenommen. Die Abgrenzung einer bipolaren Störung von einer unipolaren Depression ist aber von großer Bedeutung, da dies entscheidende Auswirkungen auf die medikamentöse und psychotherapeutische Therapie hat.</p> <p>Ein entscheidendes Kriterium bei der Diagnosefindung und Abgrenzung von bipolar und unipolar ist, ob einer gegenwärtig herrschenden depressiven Episode ein Stimmungshoch zum Beispiel mit Schlafverkürzung und/oder Hyperaktivität vorangegangen ist, was für eine bipolare Erkrankung sprechen würde. Manchmal können sich Patienten ganz genau erinnern, dass es Zeiten gegeben hat, in denen sie „der Welt einen Hax’n ausreißen wollten“ oder tagelang mit wenigen Stunden Schlaf das Auslangen gefunden haben und nicht müde waren. Bipolare vergleichen zwar den Zustand der Hypomanie mit extremer Verliebtheit, wissen aber andererseits genau um den Unterschied in der Qualität.</p> <p>Die Frage nach der Familiengeschichte, ob da jemand mit bipolarer Erkrankung, Suizidversuchen oder Lithium-Langzeit-Therapie dabei war, ist oft hilfreich. Risikoreiches Verhalten, risikoreiche Sportarten, welche phasenhaft ausgeübt werden und sich mit sozialem Rückzug und depressiven Episoden abwechseln, sind ein starker Hinweis auf eine zyklothyme oder bipolare Komponente. Und das dritte Burnout sollte auch zu denken geben.</p> <p>Lag das Vollbild einer Manie vor, bezeichnet man diesen Verlauf als Bipolar I, sind lediglich hypomane Episoden aufgetreten, als Bipolar II. Nur weil jemand noch nicht im Spital war, nur von einer Hypomanie zu sprechen, ist nicht richtig. Viele Menschen „brauchen“ ihre Manie im Frühjahr und Sommer, um alles zu erledigen und etwas im Leben weiterzubringen. Sie empfinden diesen Verlauf als normal.</p> <p>Oftmals kann im Vorfeld eine depressive oder manische Episode, ein subjektiv als belastend erlebtes Ereignis (Jobverlust, Scheidung, Trennung, Todesfall, Arbeitswechsel, Karriereaufstieg, Verliebtheit, Übersiedlung, bei Frauen wie auch bei Männern die Geburt eines Kindes) auftreten. Es können negative, aber auch positive Erlebnisse (Veränderungen) als sogenannte Trigger auftreten. Da Menschen immer nach negativen Ursachen als Erklärung suchen, wird oft falsch und voreilig eine Ursachenzuteilung gemacht.</p> <h2>Besonderheiten im Verlauf der bipolaren Erkrankung</h2> <p><strong>Rapid Cycling</strong><br />Damit beschreibt man das Auftreten von mindestens vier Episoden in einem Jahr, wovon mindestens eine hypomanisch oder manisch ist. Betroffene sollten unbedingt in einer Spezialambulanz behandelt werden.</p> <p><strong>Kippen</strong><br />Das Auftreten, den Beginn von Episoden erleben die meisten Betroffenen als langsam und schleichend. 10 % der Betroffenen „kippen“ jedoch direkt in die Depression oder in die Manie, d.h., die Stimmungslage wechselt über Nacht oder innerhalb eines Tages in den depressiven oder manischen Pol.</p> <p><strong>Mischbild, Mischzustand, gemischte Episode</strong><br />Es kann vorkommen, dass ein depressiver Mensch um 4 Uhr früh aufwacht und über eine scheinbar ausweglose Lebenssituation verzweifelt. Im Laufe des Tages wechselt dann die Stimmung, er ist wieder voller Tatendrang. Vor allem beim Übergang von einer Episodenqualität in die andere können solche gemischten Zustände auftreten. Die Behandlung einer gemischten Episode sollte nur durch einen geschulten Fachmann erfolgen.</p> <p><strong>Teufelskreis Episodenwiederholung</strong><br />Immer wieder hört man von Patienten, die es allein mit Psychotherapie oder mit einem Antidepressivum geschafft haben, gesund zu werden. Dies ist kein Wunder, sondern entspricht dem natürlichen Krankheitsverlauf: Jede Episode hat einen Anfang und ein Ende. Es geht nicht um die einjährige Behandlung, sondern um den deutlich längeren Verlauf durch das Wiederauftreten, das viele Betroffene bis ins hohe Alter begleitet. Depressive Episoden dauern bei unipolarem Verlauf im Median 5,4 Monate, bei bipolarem Verlauf im Median 4,3 Monate. Bei bipolarem Verlauf sind die Episoden also kürzer. Die Spannbreite erstreckt sich von einigen Tagen oder Wochen bis hin zu mehreren Monaten. Insgesamt ist der weitere Krankheitsverlauf in der Regel geprägt von immer wiederkehrenden manischen, depressiven oder gemischten Episoden, wobei es auch Jahre ohne Episoden geben kann. Der weitere Verlauf kann individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein, Intensität und Anzahl der auftretenden Episoden sind nicht vorhersagbar.</p> <p>Ohne Medikamente ist der bisherige Verlauf die beste Vorhersage für den weiteren Verlauf. Eine Langzeitbehandlung mit einem Stimmungsstabilisierer ist je nach Frequenz der Episoden mit dem Patienten zu besprechen.</p> <h2>Medikamentöse Behandlung lindert den Leidensdruck</h2> <p>Die unzureichende Behandlung einer bipolaren Erkrankung kann schwerwiegende Folgen bis hin zu einem Suizidversuch oder Suizid haben, eine individuell angepasste Therapie hingegen den hohen Leidensdruck von Betroffenen und ihren Angehörigen deutlich lindern. Denn der Verlauf der Erkrankung kann durch individuelle Medikamenteneinstellung, spezielle psychotherapeutische Techniken und durch umfassende Information (Psychoedukation) verbessert werden. Wichtig ist, dass die Erkrankung frühzeitig diagnostiziert wird! Ohne Behandlung erlebt nur ein äußerst geringer Prozentsatz, nämlich 5–10 % , keine weiteren Episoden. Das heißt: Abwarten und zuschauen macht nicht viel Sinn.</p> <h2>Medikamentöse Phasenprophylaxe</h2> <p>Die Phasenprophylaxe (= Langzeittherapie) dient dazu, das neuerliche Auftreten von Episoden zu verhindern. Durch die Normalisierung der Auslenkungen der Stimmungsschwankungen durch die entsprechende Medikation können die Betroffenen ihr Leben wieder selbst „in die Hand nehmen“. Informieren Sie Ihre Patienten darüber, dass der gewünschte Erfolg mitunter etwas auf sich warten lässt. Denn der Effekt einer Phasenprophylaxe macht sich erst langsam bemerkbar im Sinne eines Abnehmens der Episodentiefe, d.h., die Stimmungsschwankungen werden langsam, aber sicher über einen längeren Zeitraum geringer. Somit werden sie für die betroffenen Patienten selbst früher erkennbar und besser steuerbar. Patienten können dann oft selbst den Verlauf sehr gut beeinflussen.</p> <h2>Grenzen in der Allgemeinpraxis</h2> <p>In folgenden Fällen sollten Patienten zum Facharzt überwiesen werden:</p> <ul> <li>wenn es den Patienten Probleme bereitet, reguläre Termine wahrzunehmen</li> <li>wenn häufig Rezidive auftreten und/oder kontinuierliche funktionelle und soziale Beeinträchtigungen vorliegen</li> <li>wenn andere psychische (Angst, Sucht) oder körperliche Komorbiditäten vorliegen</li> <li>wenn eine akute gemischte Episode vorliegt</li> <li>wenn Suizidrisiko besteht</li> <li>wenn chronischer Alkohol- oder Drogenmissbrauch bzw. -abhängigkeit besteht</li> </ul></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>beim Verfasser</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick
Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...
Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers
In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...
«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie
Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...