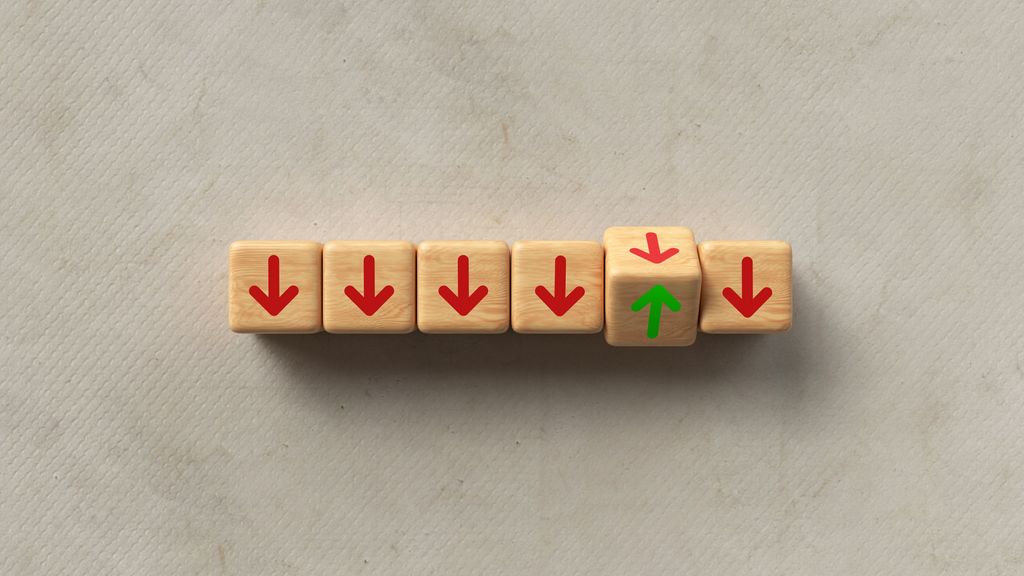
©
Getty Images/iStockphoto
Vier Tage psychiatrische Grundlagenforschung
Jatros
30
Min. Lesezeit
19.12.2019
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Der jährliche Kongress des European College of Neuropsychopharmacology (ECNP) fand in diesem Jahr vom 7. bis zum 10. September in Kopenhagen statt. Mit mehr als 6000 Teilnehmern ist dies Europas wichtigster Kongress für krankheitsorientierte Hirnforschung in der Psychiatrie. Dementsprechend weit war das thematische Feld. Hier eine Auswahl aktueller Forschungsergebnisse.</p>
<hr />
<p class="article-content"><h2>ADHS: Vorsicht bei Dosiserhöhung von Methylphenidat</h2> <p>Methylphenidat ist die beim Aufmerksamkeitsdefizit- Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) meistverschriebene medikamentöse Therapie. Wird damit nicht sofort der gewünschte Effekt erreicht, so besteht die Möglichkeit einer Dosiserhöhung. Nun zeigt eine im Rahmen des ECNP vorgestellte Metaanalyse randomisierter, klinischer Studien, dass höhere Dosierungen innerhalb des zugelassenen Bereichs kontraproduktiv sein können.<sup>1</sup> Bisherige Untersuchungen zeigten hinsichtlich des Gruppen- Effekts einen linearen Anstieg der Wirksamkeit auf Verhaltens-Symptome,<sup>2</sup> während auf der individuellen Ebene die optimalen Werte gleichmäßig zwischen niedrigen, mittleren und hohen Dosierungen verteilt sind.<sup>3</sup> In der nun präsentierten Metaanalyse wurden die Effekte unterschiedlicher Dosierungen von Methylphenidat auf die Impulskontrolle erhoben. In der Studie wurde zwischen niedrigen (0,10 mg/kg–0,39 mg/kg), mittleren (0,40 mg/kg–0,69 mg/kg) und hohen (0,70 mg/kg–0,99 mg/kg) Dosen unterschieden. Insgesamt wurden 19 Studien für die Metaanalyse ausgewählt. In allen Analysen war Methylphenidat im Vergleich zu Placebo überlegen, wobei mittlere Dosen den deutlichsten Effekt auf die Impulskontrolle zeigten, gefolgt von niedrigen und hohen Dosen. Die Autorin der Studie unterstreicht, dass Impulskontrolle in der Regel nicht als Outcome-Parameter bei Patienten mit ADHS verwendet, dabei aber hohe Bedeutung für die psychosoziale und akademische Entwicklung der jungen Patienten hat. In der Praxis sollte daher mit Dosiserhöhungen von Methylphenidat vorsichtig umgegangen werden.</p> <h2>Was die Metaphernverarbeitung bei Schizophrenie stört</h2> <p>Patienten mit Erkrankungen des schizophrenen Formenkreises erleben oft große Schwierigkeiten im Verstehen alltäglicher, metaphorischer Sprache, wie sie zum Beispiel in Witzen verwendet wird, und tendieren dazu, statt der Metapher den wörtlichen Sinn der Sätze in den Vordergrund zu stellen. Eine im Rahmen des ECNP in Kopenhagen vorgestellte Studie suchte nun sowohl bei Gesunden als auch bei Schizophreniepatienten mittels Bildgebung nach hirnphysiologischen Korrelaten zum Verständnis metaphorischer Sprache.<sup>4</sup><br />Zwar gibt es bereits einige Arbeiten, in denen Repräsentationen des Metaphernverständnisses im Gehirn beschrieben wurden, doch liefern diese Studien, so die Autoren der aktuellen Arbeit, keine Information darüber, in welchem Schritt der Metaphernverarbeitung Patienten mit Schizophrenie von Gesunden abweichen.<br /> In die Studie wurden 30 ambulante Schizophreniepatienten und 30 gematchte Kontrollen eingeschlossen. Die Probanden wurden mit 90 Geschichten konfrontiert, von denen 30 ein metaphorisches, 30 ein absurdes und 30 ein neutrales Ende hatten. Nach dem Lesen der Geschichte entschieden die Probanden, ob das Ende zur Geschichte passte und ob diese ein metaphorisches Ende hatte oder nicht. Dabei wurden zwischen den Gruppen Unterschiede hinsichtlich des Erkennens mangelnder Kongruenz (absurd vs. neutral), des Auflösens und der Elaboration von Inkongruenz (metaphorisch vs. absurd) sowie des kompletten Metaphernverstehens (neutral vs. metaphorisch) analysiert und mit Befunden aus der fMRT korreliert. Dabei wurden erhebliche Unterschiede zwischen gesunden und kranken Probanden gefunden. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich das bei Schizophrenie gestörte Erkennen von Inkongruenz im Vergleich zu Gesunden in Alterationen in der linken Hemisphäre kombiniert mit Hyperaktivität im linken temporoparietalen Cortex, rechten mittleren Cingulum sowie bilateral im frontalen Cortex äußert. Damit wurden beim Erkennen von Inkongruenz, also gewissermaßen an der Basis des Verstehens von Metaphern, die deutlichsten Unterschiede zwischen gesunden und kranken Probanden gefunden. Bei Gesunden waren für die Verarbeitung von Metaphern vor allem der präfrontale Cortex und die Amygdala zuständig. Die Autoren schließen daraus auf Kompensationsmechanismen in der frühen Phase der Metaphernverarbeitung. Auf der Verhaltensebene zeigten die Schizophreniepatienten auf allen Ebenen der Metaphernverarbeitung längere Reaktionszeiten und ihre Einschätzungen waren weniger akkurat als jene der gesunden Probanden.</p> <h2>Im Tiermodell: wie Antidepressiva auf Neuroinflammation wirken</h2> <p>Antidepressiva sind erste Wahl in der Behandlung der Depression (Major Depression) und haben in einer Vielzahl von Studien ihre Wirksamkeit gezeigt. Dennoch sind die Ansprechraten im klinischen Alltag suboptimal. Gleichzeitig ist seit Langem bekannt, dass sich depressive Patienten in einem generell proinflammatorischen Zustand befinden. Der Gedanke, die Depression über die Behandlung der Entzündung beeinflussen zu wollen, ist daher naheliegend. Im Rahmen des diesjährigen Kongresses des ECNP wurde der aktuelle Forschungsstand zu diesem Thema intensiv diskutiert. So wurden im Tiermodell Hinweise gefunden, dass SSRI nicht nur Neuroplastizität, sondern auch Neuroinflammation beeinflussen und dass dieses Wechselspiel die antidepressive Wirkung der SSRI erklären könnte.<sup>5</sup> Eine italienische Gruppe führte dazu zwei Versuche durch. Der erste sollte zeigen, dass die von SSRI induzierte neuronale Plastizität Entzündung kontrolliert. Der zweite Versuch untersuchte den Einfluss des Inflammationsniveau auf die neuronale Plastizität.<br /> Im ersten Experiment wurden Mäuse entweder mit Fluoxetin oder Vehikel behandelt und entweder einer stressreichen oder einer für Mäuse angenehmen („enriched“) Umgebung ausgesetzt. Von Ersterem wurde ein pro-, von Zweiterem ein antiinflammatorischer Effekt erwartet. Tatsächlich waren unter SSRI-Wirkung beide Effekte reduziert. Wurde die Inflammation mithilfe des SSRI in einem engen physiologischen Bereich gehalten, so wirkte sich das auch günstig auf depressionsartiges Verhalten der Tiere aus. Im zweiten Experiment wurden Mäuse entweder mit Lipopolysaccharid-Infusion (proinflammatorisch) oder Ibuprofen (antiinflammatorisch) behandelt. LPS führte zu einem krankheitsbedingten Verhalten und erhöhter Expression von IL-1β und IL-1Ra. Sowohl die durch LPS induzierte InflammaInflammation als auch das antiinflammatorische Ibuprofen reduzierten die Neuroplastizität (gemessen durch die Langzeitpotenzierung im Hippocampus) im Vergleich zu Kontrollmäusen signifikant. Die Autoren der Studie schließen aus diesen Daten, dass enge Zusammenhänge zwischen Inflammation und Neuroplastizität bestehen. Damit besteht die Hoffnung, dass antiinflammatorische Therapie das Ansprechen auf Serotonin-Wiederaufnahmehemmer substanziell verbessern könnte. Dazu Studienautorin Dr. Silvia Poggini vom Istituto Superiore di Sanità in Rom: „Unsere Daten zeigen, dass die Neuroplastizität hoch ist, solange es gelingt, die Entzündung in einem bestimmten Bereich zu halten.“</p> <h2>Neues Forschungsgebiet: das Darmmikrobiom in der Psychiatrie</h2> <p>Eine weitere Studie im Tiermodell<sup>6</sup> bietet einen völlig neuen Zugang zum Verständnis psychiatrischer Medikamente sowie ihrer Wirkungen und Nebenwirkungen: Sie beeinflussen das Darmmikrobiom. Die Studie wurde an der University of Cork in Irland, einem der weltweit führenden Zentren in der Mikrobiomforschung, durchgeführt. In der Studie erhielten sieben Gruppen von jeweils acht Ratten therapeutische oder leicht erhöhte Dosen der gängigen Psychopharmaka Escitalopram, Venlafaxin, Fluoxetin, Lithium, Valproat und Aripiprazol. Nach vier Wochen Behandlung wurden die Effekte auf das Darmmikrobiom evaluiert. Die Studie zeigte eine Zunahme von Clostridium-Spezies unter Lithium, Valproat und Aripiprazol. Im Gegensatz dazu zeigten die beiden Antidepressiva Fluoxetin und Escitalopram eine ausgeprägte und dosisabhängige antibakterielle Wirkung, wobei sich diese im Fall von Fluoxetin primär gegen L. rhamnosus und E. coli richtete, während Escitalopram das Wachstum von E. coli inhibierte. Vergleichbare Effekte im menschlichen Darm sind naheliegend. Die University of Cork plant eine große Studie zu diesem Thema.<br /> „Unsere Studie zeigt, dass verbreitete Medikamente die Zusammensetzung und Menge des Darmmikrobioms beeinflussen können. Es war dies die erste Studie, die das für psychiatrische Medikamente im Tierversuch demonstriert hat“, kommentierte Erstautorin Sofia Cussotto ihre Arbeit und wies auf deren Implikationen hin: „Da bei Patienten mit psychiatrischen Erkrankungen Alterationen des Darmmikrobioms nachgewiesen wurden, könnte die Wirkung der psychiatrischen Medikamente auf die Darmbakterien einen Teil der klinischen Wirkung dieser Substanzen ausmachen. Es könnte sich hier auch eine Erklärung für das individuell sehr unterschiedliche Ansprechen der Patienten beispielsweise auf Antidepressiva finden. Unter Umständen könnten Veränderungen des Mikrobioms aber auch für einige der Nebenwirkungen dieser Medikamente verantwortlich sein. Diese Hypothesen müssen nun zunächst in präklinischen und dann, wenn möglich, in klinischen Studien untersucht werden.“</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: Kongress des European College of Neuropsychopharmacology
(ECNP), 7.–10. September 2019, Kopenhagen
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Vertessen K: Methylphenidate and inhibition in children with ADHD: a meta-analyses on dosage effects. ECNP 2019; Poster P.831 <strong>2</strong> Coghill DR et al.: Effects of methylphenidate on cognitive functions in children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: evidence from a systematic review and a metaanalysis. Biol Psychiatry 2014; 76(8): 603-15 <strong>3</strong> Coghill D and S Seth: Effective management of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) through structured re-assessment: the Dundee ADHD Clinical Care Pathway. Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2015; 9: 52 <strong>4</strong> Jáni M et al.: Neural substrates of metaphor comprehension impairments in chronic schizophrenia outpatients - an fMRI study. ECNP 2019; Poster P372 <strong>5</strong> Poggini el al.: The interaction between inflammation and neural plasticity controls the efficacy of serotoninergic antidepressants. ECNP 2019; Poster P604 <strong>6</strong> Cussotto S et al.: Differential effects of psychotropic drugs on microbiome composition. ECNP 2019; Poster P585</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten
In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...
Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie
Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...
Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen
Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...


