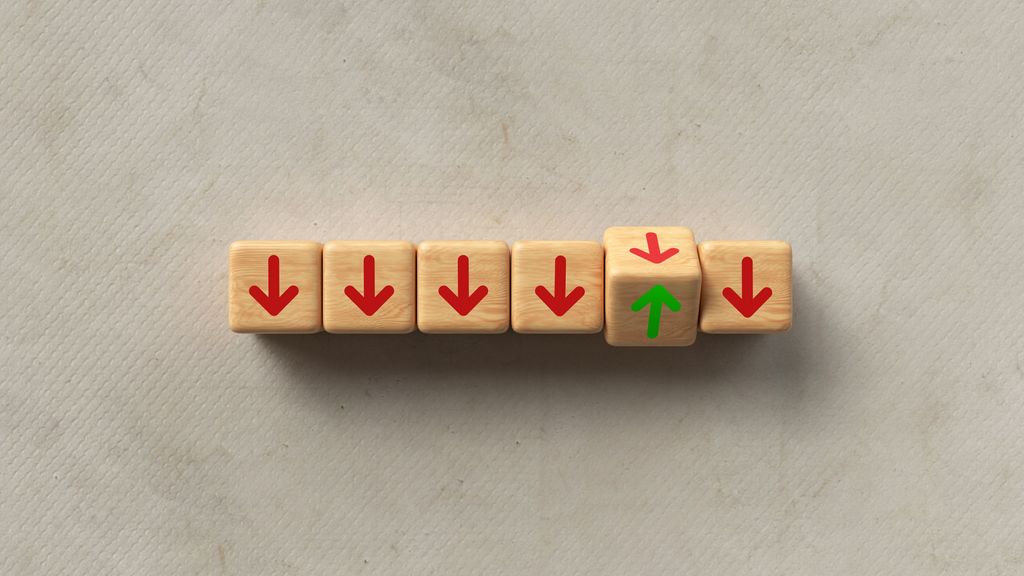
©
Getty Images/iStockphoto
Über den Tellerrand schauen
Jatros
30
Min. Lesezeit
09.03.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Eine psychische Erkrankung steht nicht isoliert im Raum. Komorbiditäten sind zu beachten, das Umfeld ist einzubeziehen. Darauf weisen Untersuchungen hin, die anlässlich des Jahreskongresses der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) im November 2016 in Berlin vorgestellt wurden.</p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Wenn Frauen mit psychischen Erkrankungen schwanger werden, machen sie sich zu Recht Sorgen. Mögliche Auswirkungen einer Medikation auf das Ungeborene sind ebenso zu bedenken wie mögliche Verschlechterungen der Erkrankung durch die Schwangerschaft und die Geburt, gerade bei phasenhaftem Verlauf. Dr. Valenka Dorsch aus Essen betonte in Berlin, dass auch das hohe Rezidivrisiko in der Postpartalzeit berücksichtigt werden müsse. Die Inzidenz einer postpartalen Psychose liege in der Allgemeinbevölkerung bei nur 0,1 % , bei Frauen mit bipolarer Störung oder Psychose in der Anamnese liege das Rezidivrisiko in der Postpartalzeit aber bei 75 bis 80 % . Daher sei bei diesen Frauen immer die Indikation zu einer stationären Behandlung gegeben. Die Beratung dürfe nicht nur auf Teratogenität und Fetotoxizität der psychiatrischen Medikamente beschränkt bleiben, es sei mindestens genauso wichtig, den Einfluss der Schwangerschaft auf die psychische Erkrankung zu besprechen und mit der Vorstellung, dass eine psychische Erkrankung durch eine Schwangerschaft besser werde, aufzuräumen. Die S3-Leitlinien für die verschiedenen psychischen Erkrankungen geben mittlerweile klare Empfehlungen für die Behandlung, betonte Dorsch und nannte in den Leitlinien übereinstimmend genannte allgemeine Prinzipien, die zu beachten sind (Tab. 1).</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Jatros_Neuro_1701_Weblinks_s38_tab1.jpg" alt="" width="1417" height="1359" /></p> <h2>Individueller Geburtsplan</h2> <p>In der Gynäkologischen Psychosomatik der Universitätsfrauenklinik Bonn umfasst das peripartale Management laut Dorsch ein spezialisiertes Beratungsprogramm von der Kinderwunschberatung bis zur Postnatalzeit. Sechs bis acht Wochen vor dem errechneten Geburtstermin erfolgt eine ausführliche Vorbesprechung, ein Geburtsplan wird entwickelt. Damit werden nicht nur Entscheidungen dokumentiert, sondern auch konkrete Handlungsanweisungen für Patientin, Angehörige und alle an der Geburt beteiligten Professionen niedergelegt. Die Medikation wird auf das krankheitsabhängige und individuelle Rezidivrisiko abgestimmt. So sollte die Möglichkeit einer Reduktion zwei oder eine Woche vor dem Geburtstermin überprüft werden, nicht aber bei Psychose, bipolarer Störung oder Zwangsstörung. Intrapartal kann bei Panikstörung oder Reaktivierung von Trauma/Missbrauch ggf. Lorazepam zum Einsatz kommen. Postpartal ist eine reduzierte Medikamentendosis wieder auf die Dosis vor oder in der Schwangerschaft zu erhöhen. Bei bipolarer Störung und Psychose sollte ab dem Tag der Entbindung eine prophylaktische Erhöhung auf die therapeutische Dosis erfolgen. Etwa 50 % der entsprechenden Episoden beginnen bereits am 1. bis 3. Tag postpartal, betonte Dorsch. Selbst bei bislang gesunden Frauen sei die Zeit nach Geburt eines Kindes die Zeit mit dem höchsten Risiko, wegen einer psychischen Störung behandelt werden zu müssen. Für die Zeit nach der Entbindung sollte die soziale und familiäre Unterstützung schon im Vorfeld organisiert werden – sehr konkret und pragmatisch zugeschnitten auf die individuelle Situation.</p> <h2>Seele wund – Knochenschwund</h2> <p>Nahezu jede psychiatrische Erkrankung und deren pharmakologische Behandlung ist mit einem erhöhten Osteoporoserisiko behaftet, betonte Priv.-Doz. Dr. Annamaria Painold aus Graz. Dabei wirkt häufig eine Vielzahl von Faktoren zusammen. Bei einer Depression oder Schizophrenie führt beispielsweise ein Lebensstil mit Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben zu weniger Lichtexposition und Bewegung, Alkohol- und Tabakabusus wirken sich ebenfalls ungünstig auf die Knochengesundheit aus.<br /> Bei Depression finden sich aber auch krankheitsspezifische und medikationsbedingte Effekte auf den Knochenstoffwechsel. So scheint Serotonin über eine Hemmung der sympathikotonen Erregung günstig auf den Knochenstoffwechsel zu wirken, ein Mangel dagegen die Osteoklastenaktivität zu verstärken. Serotoninwiederaufnahmehemmer (SSRI) führen entsprechend zu einer 45 % igen Erhöhung des Osteoporoserisikos. Das Frakturrisiko ist laut Painold dosis- und einnahmedauerabhängig. Trizyklika haben keine metabolischen Effekte auf den Knochen, ergänzte sie, gehen allerdings in den ersten 14 Tagen der Einnahme mit einem noch deutlich stärker erhöhten Sturzrisiko einher als SSRI. Das heißt aber nicht, dass bei Osteoporoserisiko eine antidepressive Behandlung zu verweigern sei, betonte sie. Letztlich sei ein besseres Management beider Erkrankungen – der Depression und der Osteoporose – anzustreben.</p> <h2>Indikator Kopfschmerz</h2> <p>Eine Auswertung von Versicherungsdaten in Deutschland zeigt, dass Kopfschmerz ein wichtiger Indikator in der Primärprävention von psychischen Erkrankungen ist. Kommen Darm- oder/und Rückenschmerzen hinzu, werden psychische Belastungen und Erkrankungen noch einmal deutlich häufiger, berichtete Amelie Rouche vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Berlin. Die Diagnosen Depression, Angststörungen, Belastungsstörungen, Konzentrationsstörungen und Unruhe sowie somatoforme Störungen treten dann deutlich häufiger auf als bei Menschen ohne Kopfschmerzen, Angststörungen sind bei Vorliegen von Kopfschmerzen zusammen mit Darmund Rückenschmerzen sogar um 315 % häufiger als bei Personen ohne diese Beschwerdekonstellation.</p> <h2>Borderline for ever?</h2> <p>Eine lang anhaltende Remission einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) scheint nach dem Konzept der Erkrankung als Persönlichkeitsstörung per Definition unmöglich, die Persistenz der Symptome war bislang ein Paradigma. Die McLean Study of Adult Development<sup>1</sup> stellte dies erstmals infrage. Eine Arbeitsgruppe des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim und der Klinik für Allgemeine Psychiatrie in Heidelberg begann daraufhin mit der Untersuchung von Remission bzw. Recovery bei Patienten aus dem Rhein-Neckar-Raum. Beim DGPPN-Kongress 2016 stellten sie erste Ergebnisse vor, bei denen 32 Frauen mit einer aktuellen BPS-Diagnose, 32 Frauen mit einer remittierten BPS und 28 gesunde Frauen verglichen wurden. Häufig nahmen dabei die Patientinnen mit einer remittierten BPS in Tests eine mittlere Position zwischen akut erkrankten und gesunden Frauen ein, z.B. bei Symptomzahl oder Symptomschwere oder im State-Trait-Anger- Test, aber auch beim Test zu dem Gefühl der Fremdheit des eigenen Körpers und dem Schmerzerleben. Weiterhin deutlich erhöhte Werte fanden sich aber auch in Remission noch für die selbstberichtete emotionale Dysregulation, Depressivität und überdauernden Ärger. Das spiegelte sich im EEG bei der Auswertung ereigniskorrelierter Potenziale wider. Der Vergleich der Ableitung P100 zeigte eine verringerte frühe Hyperreagibilität bei Remission und sogar eine Normalisierung früher struktureller Gesichtsverarbeitung (Ableitung N170), aber keine Veränderungen gegenüber Akutpatienten hinsichtlich der späteren attentionalen und kognitiven Prozesse der Emotionsklassifikation (Ableitung P300).</p> <h2>PTSD und soziale Integration mehr beachten</h2> <p>Laut Prof. Dr. Martin Bohus vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim war die Kohorte der McLean Study of Adult Development extrem selektiert, die Definition der Remission in der Studie sei zu hinterfragen. Trotz Normalisierung in einigen Symptombereichen blieb doch meist eine Vielzahl von Achse- I-Diagnosen, die Patienten seien häufig nicht mit dem Leben zufrieden und die meist vorhandene posttraumatische Belastungsstörung (PTSD) überdauere die sogenannte Remission. Er empfahl, bei der Therapie der BPS stärker die persistierende PTSD und die soziale Integration in den Mittelpunkt zu stellen.</p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: DGPPN-Kongress 2016, 23. bis 26. November 2016, Berlin
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>Zanarini MC et al: Prediction of time-to-attainment of recovery for borderline patients followed prospectively for 16 years. Acta Psychiatr Scand 2014; 130: 205-13</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Phytotherapie bei Angsterkrankungen und assoziierten Beschwerden
Pflanzliche Arzneimittel gewinnen immer mehr Bedeutung in der Psychiatrie. Insbesondere bei Angsterkrankungen und Depressionen stellen Phytotherapeutika eine sinnvolle Alternative zu ...
Machine Learning zur Verbesserung der Versorgung ausländischer Patient:innen
Die zunehmende Diversität aufgrund von Migration bringt spezifische Herausforderungen hinsichtlich Kommunikation, kultureller Deutung von Symptomen sowie institutioneller Strukturen mit ...
Stellungnahme zum Konsensus Statement Schizophrenie 2023
In dem Konsensus Statement Schizophrenie 20231 wurde die Sachlage zur Diagnostik und Therapie schizophrener Erkrankungen in 19 Kapiteln erarbeitet. Doch besteht im Bereich der ...


