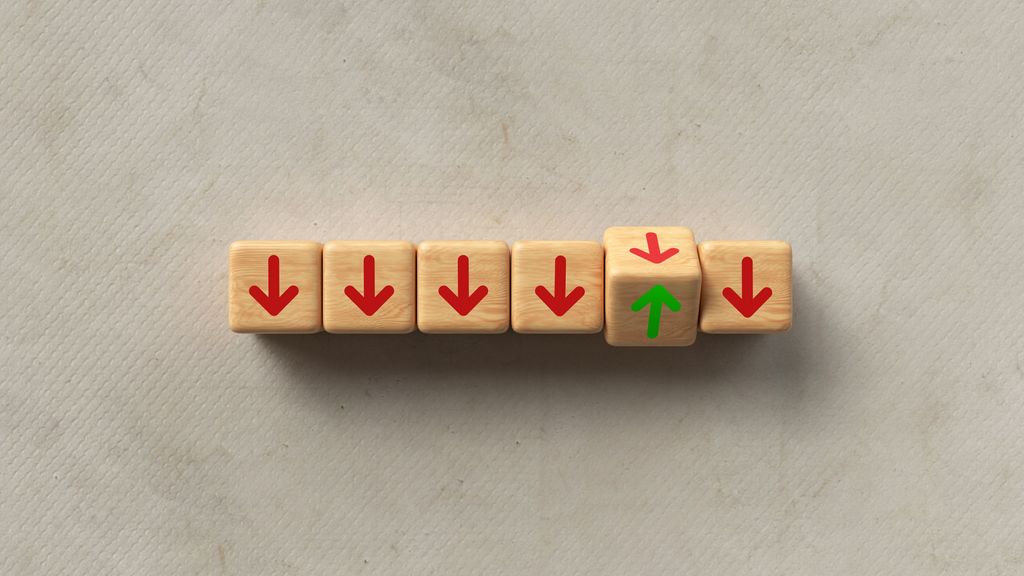<p class="article-intro">Jugendliche, die an einer psychotischen Störung erkranken, werden in ihrer Entwicklung stark beeinträchtigt und weisen nach aktuellem Forschungsstand eine schlechtere Prognose auf als erwachsene Ersterkrankte. Das Ziel aller Früherkennungszentren ist, die Symptome früh zu erkennen und in der Folge früh zu behandeln. In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Zürich wurde ein innovatives Therapieprogramm für Jugendliche entwickelt, mit dem Ziel, den jungen Patienten eine Behandlung anzubieten, die altersgerecht, symptom- und ressourcenorientiert ist. Unterstützt wird die therapeutische Behandlung durch eine Smartphone-App.</p>
<p class="article-content"><div id="keypoints"> <h2>Keypoints</h2> <ul> <li>Psychotische Störungen gelten als schwerwiegende psychische Erkrankungen, die mit grossem Leidensdruck und starken psychosozialen Beeinträchtigungen verbunden sind. Die Früherkennung und die Frühbehandlung des «At Risk»-Status werden von Experten in diesem Bereich als vielversprechende Strategie gesehen, um belastenden Symptomen und den möglichen dramatischen Folgen effektiv entgegenzuwirken.</li> <li>Die Therapie von Jugendlichen mit einer Risikosymptomatik stellt eine Herausforderung für die Therapeuten dar. Einerseits, weil bei Jugendlichen die Hürde für eine psychotherapeutische Behandlung höher als bei Erwachsenen liegt. Andererseits fehlt es an altersadäquaten Behandlungsprogrammen.</li> <li>Die Früherkennungssprechstunde in Zürich will mit dem Behandlungsprogramm «Robin» diese Lücke schliessen. Innovativ ist die Kombination des Manuals mit der Smartphone-App Robin Z. Die Inhalte der Therapie stehen den Jugendlichen dadurch auch zwischen den Therapiesitzungen zur Verfügung. Durch eine einfache Lesbarkeit und den auffordernden Charakter bewirkt die App eine positive Resonanz bei den Jugendlichen. Zentral in «Robin» sind die symptomspezifische Therapie und die Stärkung von Selbstbewusstsein und Selbstwirksamkeit.</li> </ul> </div> <p>Psychotische Störungen gehören zu den schwersten psychiatrischen Erkrankungen. Insbesondere für junge Menschen hat die Erkrankung stark belastende Konsequenzen, da sie an einem kritischen Punkt ihrer schulischen, persönlichen und sozialen Entwicklung stehen und durch die Krankheit darin beeinträchtigt werden.<br /> Psychotische Störungen können sich über einen längeren Zeitraum hinweg entwickeln. Betroffene bemerken meist schon längere Zeit vor dem Ausbruch der Erkrankung Veränderungen in ihrer Wahrnehmung, ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit oder ihren sozialen Fertigkeiten. Die Forschung zur Früherkennung von Psychosen hat diese beeinträchtigenden Veränderungen untersucht und es ist der Begriff der «At Risk»-Symptome entstanden. «At Risk»-Symptome sind sowohl erste subjektiv wahrgenommene Beeinträchtigungen, die bereits einen eigenen Krankheitswert aufweisen (Miller et al., 2003; Schultze-Lutter & Koch, 2010), als auch die sogenannten attenuierten psychotischen Symptome, die zwar die Qualität von psychotischen Symptomen aufweisen, bei denen jedoch der Realitätsbezug noch intakt ist. Kliniker und Forscher haben dafür plädiert, dass bereits «At Risk»-Symptome behandelt werden sollten, unabhängig von der Rate des Übergangs in eine psychotische Erkrankung, da der Leidensdruck der Betroffenen ausreiche, um eine Behandlung zu rechtfertigen (z. B. Bertolote & McGorry, 2005; Correll, Hauser, Auther, & Cornblatt, 2010; Fusar-Poli, Yung, McGorry, & van Os, 2014; Schmidt et al., 2015). Weltweit sind in den letzten Jahren Früherkennungszentren für Psychosen entstanden, die sich unter anderem die Frühintervention zum Ziel gemacht haben.<br /> Bisher konnte die Effektivität von Frühinterventionen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie noch nicht ausreichend nachgewiesen werden, was unter anderem daran liegt, dass keine altersentsprechenden Behandlungsmanuale vorliegen und bislang nur wenige Studien in dieser Altersgruppe durchgeführt wurden (Bechdolf et al., 2012; McGorry et al., 2013; Miklowitz et al., 2014; Schmidt et al. 2015). Bei den Jugendlichen, die die Kriterien einer «At Risk»-Symptomatik erfüllen, handelt es sich um eine sehr heterogene Patientengruppe, bei der sowohl der Ausprägungsgrad der Symptomatik als auch das Auftreten von Komorbiditäten variiert. In den bisherigen Wirksamkeitsstudien wurden Kinder und Jugendliche oft mit ähnlichen Therapiekonzepten behandelt wie Erwachsene. Analysen zur Therapiemotivation zeigen jedoch, dass junge Patienten anders als Erwachsene auf Psychotherapie reagieren und die Hürde, um sie für die therapeutische Arbeit zu gewinnen, höher zu liegen scheint (Haddock et al., 2006). Umso wichtiger sind altersadäquate, an die spezifischen Bedürfnisse der Jugendlichen angepasste Therapiematerialien.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Neuro_1905_Weblinks_lo_neuro_1905_s29_tab1_franscini.jpg" alt="" width="550" height="780" /></p> <h2>Therapieprogramm Robin</h2> <p>In der Früherkennungssprechstunde in der KJPP Zürich wurde ein Therapieprogramm für Jugendliche mit «At Risk»-Symptomen entwickelt, welches auf die Bedürfnisse dieser Altersgruppe abgestimmt ist. Das Therapieprogramm Robin besteht aus einem Therapiemanual und einer Smartphone-App.<br /> Das Therapiemanual ist aufgrund der Heterogenität dieser Patientengruppe modular aufgebaut. Die Module können den Bedürfnissen der Patienten entsprechend individuell zusammengestellt und angewendet werden. Das Manual lehnt sich an kognitiv-verhaltenstherapeutische und systemische Ansätze an, enthält altersgerechte Therapiematerialien und weist einen auffordernden, nicht pathologisierenden Charakter auf.<br /> Das Therapiemanual wird durch die Smartphone-App Robin Z ergänzt, welche die Patienten zwischen den Therapieterminen unterstützen soll. Die Benutzung einer Smartphone-App im therapeutischen Kontext hat viele Vorteile, wie Zugänglichkeit, Transportfähigkeit, niedrige Kosten und 24-Stunden-Support (Alvarez-Jimenez et al., 2013). Insbesondere für die Psychoedukation eignen sich mobile Technologien (Rotondi, Eack, Hanusa, Spring, & Haas, 2013), da Informationen beliebig häufig und insbesondere zu kritischen Zeitpunkten nachgelesen werden können. Ein weiterer grosser Vorteil von Smartphone-Technologien in der Behandlung ist die Echtzeit- Erfassung von Stimmung und Symptomen (Ben-Zeev, 2012; Kimhy, Myin-Germeys, Palmier-Claus & Swendsen, 2012). Sie erlaubt, exaktere Informationen bezüglich eines Vorkommnisses zu speichern und daraus besser zu erkennen, welche Faktoren mit der Veränderung der Symptomatik zusammenhängen, da genauere Angaben über Kontext, Kognitionen und Befindlichkeit zur Verfügung stehen. Den Patienten kann eine Echtzeit-Symptom-Erfassung helfen, sich selbst besser zu verstehen, die Symptome besser einzuschätzen und in der Folge als kontrollierbarer und beeinflussbarer zu erleben (Palmier-Claus et al., 2013). Selbstmanagement mittels einer App kann zu einem Gefühl von Selbsteffizienz verhelfen (Reid et al., 2013), was einerseits das Selbstbewusstsein und andererseits die Selbstwirksamkeit des Patienten fördert.<br /> Bei der Entwicklung der App Robin Z wurde speziell auf folgende Punkte geachtet: Die App ist offline verfügbar und Passwort- geschützt. Der Name «Robin Z» und das Icon wirken neutral und geben keine Rückschlüsse auf die Inhalte der App. Die Texte sind in einer leicht verständlichen Sprache verfasst. Auf Fachbegriffe wurde weitgehend verzichtet. Die App hat einen auffordernden Charakter und ist individuell gestaltbar. Es wurde insgesamt darauf geachtet, dass positive, ressourcenorientierte Inhalte in der App enthalten sind.<br /> Die App existiert aktuell in vier verschiedenen Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Sie kann im App-Store und bei Google Play kostenlos heruntergeladen werden.<br /> Die bisherigen Erfahrungen mit der App Robin Z sind vielversprechend. Im klinischen Alltag wird die App regelmässig genutzt und gemäss einer ersten Auswertung zur Nutzerzufriedenheit von Fachpersonen als auch von den Jugendlichen als hilfreich empfunden.<br /> Die 16-jährige Lea wird durch ihre Therapeutin in der Früherkennungssprechstunde aufgrund von Wahrnehmungsveränderungen in Form von optischen Halluzinationen angemeldet. Daneben berichtet Lea von affektiven Veränderungen, wie depressiven Stimmungseinbrüchen, erhöhter Reizbarkeit, Energielosigkeit und wiederkehrender Gefühlslosigkeit. Sie leidet unter Ein- und Durchschlafproblemen. In ihrer formalen Denkfähigkeit erlebt sich Lea seit Längerem beeinträchtigt. Sie berichtet von Konzentrationsproblemen, Wortfindungsstörungen und Gedankenblockaden. Aufgrund eines schulischen Leistungsabfalls hat Lea im Februar 2018 von der 3. Sek A in die 3. Sek B gewechselt. Trotzdem hat sie nach wie vor Mühe, die schulischen Anforderungen zu erfüllen. Sie bleibt dem Unterricht immer öfter fern und hat sich im Vorfeld der Erstkonsultation in der Sprechstunde über mehrere Wochen hinweg komplett geweigert, in die Schule zu gehen. Die Abklärung innerhalb der Früherkennungssprechstunde bestätigt bei Lea ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Psychose. Zusätzlich wird die Diagnose einer mittelgradigen depressiven Episode gestellt. Lea benutzt zwischen den Therapieterminen die App Robin Z. Als besonders hilfreich empfindet sie die Wochenziele, um kurzfristige Ziele, die in der Sitzung abgemacht werden, weiterzuverfolgen. Innerhalb der Therapiestunde werden mit Lea Strategien im Umgang mit ihren Symptomen, beispielsweise mit den optischen Halluzinationen, ausführlich besprochen. In der App kann sie diese unter «Tipps» nachlesen. Auch bei Einschlafschwierigkeiten und erhöhter Reizbarkeit empfindet sie die Tipps der App Robin Z als hilfreich. Hingegen schafft sie es bei depressiven Stimmungseinbrüchen oft aufgrund von Antriebsproblemen nicht, die App zu benutzen, und lässt dann auch die Logbucheinträge weg. Unter dem Memo notiert sie sich einen Reminder für den Tipp «Überprüfe deine Ansprüche». Als zusätzlichen Tipp im Memo definiert sie ein Baderitual und ihre Entspannungsplaylist. Im Verlauf der Therapie gelingt es Lea, dies für Tage mit besonders starken Stimmungstiefs, an denen ihr sonst gar nichts gelingt, anzuwenden. Die Einträge im Log buch zeigen, dass sich ihre Stimmung nach dem Baderitual und Hören der Entspannungsplaylist jeweils mindestens um zwei Punkte verbessert.<br /> Lea erhält aufgrund ihrer depressiven Symptomatik medikamentöse Unterstützung durch Fluoxetin. Durch die Reminderfunktion wird sie an die Einnahme erinnert. Durch die Besprechung der Logbucheinträge in den Therapiestunden zeigen sich schnell bestimmte Muster, die mit dem Vorkommen der einzelnen Symptome zusammenhängen. So sind z. B. Leas Halluzinationen am Abend und an Wochentagen, an denen sie unter Stress steht, stärker vorhanden. Präventiv gegen die Halluzinationen helfen Verabredungen und positive Interaktionen mit ihren besten Freundinnen.<br /> Ihre Freundinnen ergänzen Leas Stärkenliste mit zusätzlichen Stärken von ihr (Abb. 1). Somit wird die Stärkenliste für Lea eine Unterstützung in Momenten mit Selbstwertproblemen. Bei den positiven Aktivitäten findet Lea vor allem die Ideen zum kognitiven Training hilfreich. An Tagen, an denen sie sich im formalen Denken als eingeschränkt erlebt, benutzt sie diese, um ihre Konzentration und Denkfähigkeit zu verbessern. Dadurch, dass sie immer eine der Aktivitäten trotz subjektiv empfundener Denkschwierigkeiten umsetzen kann, gewinnt sie wieder mehr Selbstbewusstsein hinsichtlich ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit. In der Therapiestunde werden positive Erlebnisse der vergangenen Woche gemeinsam aufgelistet und auf der App nachgetragen. Im Verlauf findet Lea diese Funktion zunehmend hilfreicher und beginnt von sich aus, die positiven Erlebnisse regelmässig zu notieren.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2019_Leading Opinions_Neuro_1905_Weblinks_lo_neuro_1905_s30_abb1_franscini.jpg" alt="" width="550" height="414" /></p> <p>Weitere Informationen:<br /><a href="https://www.robinz.uzh.ch">https://www.robinz.uzh.ch</a></p></p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p>bei den Verfasserinnen</p>
</div>
</p>