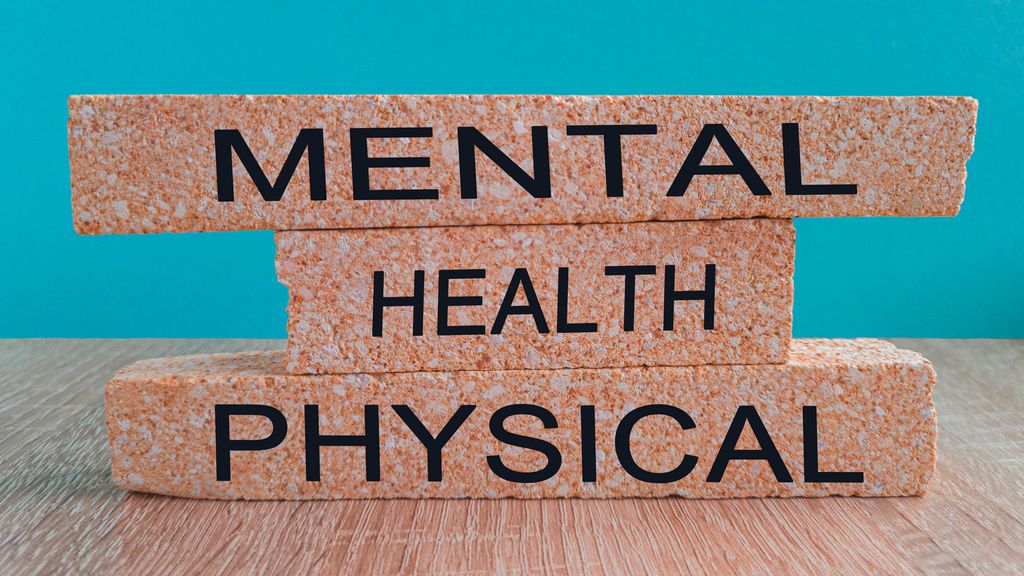
Sportpsychiatrie und -psychotherapie im Breitensport
Autoren:
PD Dr. med. Dr. phil. Ulrich Michael Hemmeter
Psychiatrische Dienste Graubünden, Chur
E-Mail: ulrich.hemmeter@pdgr.ch
Dr. med. Theofanis Ngamsri
Psychiatrische Universitätsklinik Zürich
E-Mail: theofanis.ngamsri@pukzh.ch
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) hat das Ziel der Förderung der Sportpsychiatrie und -psychotherapie über die Lebensspanne in der Schweiz im Leistungssport und in der Allgemeinbevölkerung. In Leading Opinions Neurologie & Psychiatrie wird regelmässig über die jüngsten Entwicklungen der Sportpsychiatrie und -psychotherapie (in der Schweiz) und ihre Tätigkeitsfelder – im Breiten-, Gesundheits- und Leistungssport – berichtet.
In dieser Ausgabe bildet der Breitensport den Schwerpunkt; im Speziellen wird auf den Stellenwert von Sport, seine gesundheitlichen Risiken sowie das Auftreten von psychischen Erkrankungen im Breitensport, deren Diagnostik, Behandlung und Prävention eingegangen.
Während es im Bereich Gesundheitssport, der in der letzten Ausgabe der Leading Opinions das Thema war, um die Wirkungen von körperlicher Aktivität und Sport bei der Prävention und Behandlung psychischer Erkrankungen geht,1 befasst sich die Sportpsychiatrie im Leistungssport mit der psychischen Gesundheit sowie der Diagnostik und Behandlung von psychischen Erkrankungen bei Leistungssportlern, die entweder unabhängig vom Leistungssport bereits an einer psychischen Erkrankung leiden oder bei denen sich während ihrer Karriere, ggf. unter der sportspezifischen Belastung, eine psychische Erkrankung, z.B. in Form eines Burnout, einer Depression oder auch einer Essstörung, entwickelte2–5 (Lehrbuch der Sportpsychiatrie und -psychotherapie, Bd. 1 und 2).
Diese beiden Bereiche waren bei der Gründung der SGSPP zunächst die wesentlichen Themen der Sportpsychiatrie und -psychotherapie. Nicht zuletzt aufgrund der alltäglichen klinischen Arbeit in sportpsychiatrischen und -psychotherapeutischen Sprechstunden sowie aufgrund einer von der SGSPP initiierten Umfrage stellte sich die Relevanz von psychischen Störungen und psychiatrischen Problemen auch im Breitensport heraus. Die Themen, die eine Relevanz für psychische Erkrankungen im Breitensport aufweisen, sind den Themen, die sich bei Leistungssportlern finden, sehr ähnlich. Dies betrifft die psychischen Erkrankungen mit definierten psychiatrischen Diagnosen per se. Auch im Breitensport finden sich Depressionen und Essstörungen wie auch weitere psychische Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum psychiatrischer Diagnosen, die unabhängig sind von der sportlichen Aktivität; bei vorhandener Vulnerabilität für psychische Erkrankungen können Sport und Bewegung sowohl ein Risikofaktor als auch eine aufrechterhaltende Bedingung sein. Hinzu kommen neuropsychiatrische Symptome, die nach Unfällen mit Gehirnerschütterungen und Hirnkontusionen im Rahmen der sportlichen Betätigung auftreten, sowie der ganze Bereich der Einnahme von leistungsfördernden Substanzen, die nahezu alle (sekundär) mit psychotropen Wirkungen einhergehen. Zuletzt sind gerade im Breitensport das Phänomen der Sportsucht und damit verbundene psychische Störungen ein zunehmend auftretendes Phänomen.4,5
Die Bezeichnung Breitensport wird hier in Abgrenzung zum Leistungssport gebraucht. Laut Duden handelt es sich beim Breitensport um Sport, der von der Bevölkerung auf breiter Ebene betrieben wird. Der Deutsche Sportbund (DSB) definierte 1975, dass unter Breitensport «jegliche sportliche Tätigkeit, die nicht ‹wettkampfmässig› betrieben wird», verstanden wird. Breitensport wird häufig in der Freizeit betrieben und dann häufig auch synonym mit Freizeitsport angewandt, umfasst aber auch Schulsport und Betriebssport. Der Begriff des Breitensports ist unscharf, insbesondere in seiner Abgrenzung zum Leistungssport. Besonders in Mannschaftssportarten, aber auch Einzelsportarten sind Wettkämpfe im Bereich des Breitensports selbstverständlich, sodass auch hier ein Wettkampfcharakter entsteht, der mit erhöhten Belastungssituationen (physischer und psychischer Art) einhergehen kann.
Somit treffen viele Erkenntnisse über die Zusammenhänge von sportlicher Aktivität, psychischem Befinden, physischer und kognitiver Leistungsfähigkeit wie auch zu psychischen Erkrankungen im Leistungssport, für den bezogen auf Wettkampfsituationen die Spezifikation Spitzensport oder Hochleistungssport (in Abgrenzung zum Breitensport) eingeführt werden kann, auch auf den Breitensport zu.6
Im Folgenden soll nun auf zwei Bereiche, die auch für den Breitensport relevant sind, genauer eingegangen werden.
Hirnverletzungen im Breitensport
Auch im Breitensport besteht ein Risiko für Verletzungen in Abhängigkeit von der Art der sportlichen Betätigung, deren Häufigkeit und Intensität. Sportinduzierte Verletzungen, die mit einer Einschränkung der Alltagsfunktionalität und ggf. mit Schmerzen und Schlafstörungen verbunden sind, können per se weitere psychische Störungen und Erkrankungen verursachen. In besonderem Masse sind jedoch Hirnverletzungen mit psychischen und v.a. neuropsychiatrischen Folgen assoziiert.7 Hier ist insbesondere die sportbezogene traumatische Gehirnerschütterung zu nennen («sport-related concussion», SRC), die v.a. bei hierfür prädestinierten Sportarten, wie Eishockey, Fussball und American Football, aber auch in vielen anderen Sportarten (Kampfsportarten, u.a. Boxen) vorkommen kann. In diesen Sportarten sind – bei Leistungssportlern – die Verletzungen im Wettkampf 4–10x häufiger als im Training und bei Frauen wurde eine höhere Inzidenz sportbezogener Gehirnerschütterungen gefunden als bei Männern. Auch bei Freizeitsportlern ist daher bei Vorliegen von Wettkampfbedingungen mit einer erhöhten Anzahl an Hirnverletzungen zu rechnen.
Während die akute traumatische Gehirnerschütterung relativ einfach zu erkennen ist, ist die Diagnose einer subklinischen SRC bei mehrfachen, leichten (subklinischen) Gehirnerschütterungen, wie sie z.B. beim Fussball oder Boxen häufiger vorkommen, schwieriger. Auch sie können zu einer Verletzung des zentralen neuronalen Systems führen (Verletzungen der Axone, Neuroinflammation), ohne dass zunächst klinische Symptome auftreten. Die wiederholte subklinische Traumatisierung kann zeitverzögert – auch nach Jahren – kognitive Störungen induzieren und sogar zu psychischen Erkrankungen wie der Depression führen.
Zu den Kernsymptomen der akuten sportbezogenen Gehirnerschütterung gehören somatische Symptome (Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen u.a.), kognitive Symptome (Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Verlangsamung u.a.), Schlafstörungen und emotionale Symptome (Nervosität, Ängstlichkeit u.a.). Ein erhöhtes Risiko für die spätere Entwicklung einer Demenz und von affektiven Störungen insgesamt sowie eine Reduktion der späteren Lebensqualität werden diskutiert, wenngleich die Befunde hierfür noch uneinheitlich sind.
Aufgrund der möglichen langfristigen Folgen ist bei einer akuten sportbezogenen Gehirnerschütterung, die i.d.R. gut erkannt wird, eine schnell einsetzende Therapie notwendig und diese ist auch erfolgversprechend. Besonders wichtig ist jedoch das Erkennen von neuropsychiatrischen Störungen auf der Grundlage von subklinischen SRC bzw. die von den Patienten geäusserten klinischen Beschwerden mit wiederholten subklinischen sportbezogenen Gehirnerschütterungen in Verbindung zu bringen. Neben einer eingehenden klinischen Untersuchung und Anamnese stehen hier verschiedene Checklisten zur Verfügung, z.B. das SCAT5.6
Die Behandlung der sportbezogenen Gehirnerschütterung erfordert i.d.R. einen multidisziplinären Ansatz, der Physiotherapie, Medikation und auch Verhaltensmanagement i.S. kognitiver (Psycho-)Therapiestrategien umfasst.
Breitensportler, die Symptome einer sportbezogenen Gehirnerschütterung aufweisen, sollten daher gut diagnostiziert, überwacht und schnell von Spezialisten behandelt werden, auch wenn nur der Verdacht auf subklinische Traumata besteht, um Langzeitfolgen zu vermeiden.
Sport und Sucht im Breitensport
Leistungs- und Breitensportler haben ein zumindest gleich hohes Risiko für die Entwicklung eines Suchtverhaltens und einer manifesten Suchterkrankung wie die Allgemeinbevölkerung. Dies betrifft primär den Alkohol-, aber auch den Medikamentenmissbrauch (Schmerzmittel, Sedativa und Anxiolytika).8
Hinzu kommt die Einnahme von leistungsfördernden Substanzen, die sich zu einem Suchtverhalten und auch zu einer Abhängigkeit entwickeln kann, und dies nicht nur im Leistungs-, sondern auch im Breitensport.6,9
Die Einnahme von im Sport nicht erlaubten leistungssteigernden Substanzen (Doping) per se muss noch nicht die Kriterien für ein Suchtverhalten erfüllen, falls Doping, wenngleich es verboten ist, vom Sportler (Leistungs- und Breitensportler) bewusst und zeitlich terminiert eingesetzt wird, es kann sich jedoch ein Suchtverhalten entwickeln.
Am weitesten verbreitet ist Doping durch anabol wirkende Substanzen bei Kraftsportlern, z.B. in Fitnessstudios, in denen der Sport in Zusammenhang mit der Entwicklung eines idealisierten Körperschemas (Bodybuilding) auch von Freizeitsportlern exzessiv betrieben wird und auch körperliche wie psychische Gesundheitsschäden in Kauf genommen werden.6,9
Neben der Sucht nach der Einnahme psychotroper Substanzen können auch Verhaltensweisen Suchtcharakter annehmen, die dann zu den nichtstoffgebundenen Süchten, den sog. Verhaltenssüchten, zählen. Hierfür wurde in der ICD-11 die Kategorie der Verhaltenssüchte neu geschaffen, in die u.a. die Glücksspielsucht bzw. pathologisches Spielen («gambling disorder») fällt, das bei Leistungssportlern vermehrt auftritt (Zahlen für den Breitensport liegen nicht vor).
Ein spezifisches sportbezogenes pathologisches Verhalten ist die Sportsucht («exercise addiction»), bei der Sport und körperliches Training selbst den Charakter eines Suchtverhaltens im Sinne einer Verhaltenssucht annehmen. Dies ist dann der Fall, wenn der Athlet die Merkmale eines Suchtverhaltens durch exzessives Trainingsverhalten zeigt und negative Auswirkungen auf die Leistung und die Gesundheit negiert. Dieses Verhalten kann nicht kontrolliert werden und muss im Sinne eines Zwangs immer wieder ausgeführt werden.10
Die Sportsucht ist bisher nicht in das internationale Klassifikationssystem (ICD-11) aufgenommen worden. Es gibt jedoch seit Längerem Bestrebungen, Sportsucht in die Kategorie der Verhaltenssüchte einzugliedern.
Eine Besonderheit der «Sportsucht» ist, dass die Aktivität (Sport) grundsätzlich etwas Positives darstellt und zu einem besseren Gesundheitszustand führen kann. Erst wenn die sportliche Betätigung übermässig und mit einem Zwang ausgeübt wird, nicht kontrolliert werden kann, trotz körperlicher Schädigung (wie Verletzungen) weitergeführt wird und die Gedanken nicht mehr auf die notwendigen Alltagsaktivitäten gerichtet werden können, schlägt die eigentlich positive sportliche Aktivität in eine negative und letztlich gesundheitsschädliche Aktivität um.11 Damit verbunden sind auch eine Vernachlässigung des Familien- und Freundeskreises sowie das Auftreten von Entzugssymptomen, wenn die sportliche Aktivität nicht ausgeübt werden kann, begleitet von Stimmungsveränderungen. Sportsucht kann sich als isoliertes pathologisches Phänomen entwickeln oder mit anderen Psychopathologien und Verhaltensstörungen verbunden sein, wie insbesondere Essstörungen in Form von Anorexia nervosa oder Bulimie.12
Das grösste Risiko für die Entwicklung einer Sportsucht bergen Ausdauersportarten wie z.B. Marathonlaufen.13
Sportsucht ist ein Phänomen, das sich v.a. im Breitensport findet. Da die Grenze zwischen noch «normalem» intensivem Training und der Entwicklung einer Sportsucht fliessend und individuell sehr unterschiedlich ist und auch der Übergang zu einem gesundheitsschädigenden Verhalten fliessend ist, ist das Umfeld des Sportlers (Familie, Trainer, v.a. auch Ärzte und Psychologen – wenn involviert) gefordert, frühe Anzeichen zu erkennen und mit dem Breitensportler einen Weg zur Kontrolle des pathologischen Verhaltens zu finden. Hilfreich beim Erkennen einer Sportsucht können Ratingskalen wie das Inventar zur Erkennung von Sportsucht14 und der Einbezug eines Sportpsychiaters und -psychotherapeuten sein.
Gut informiert
Aktuelle Informationen zur Schweizerischen Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie wie auch zu weiteren Veranstaltungen finden sich auf der SGSPP-Homepage: www.sgspp.ch .
Ausblick
Ein wesentliches Element der Sportpsychiatrie und -psychotherapie im Breitensport ist die Prävention, um das Auftreten der hier angesprochenen Phänomene und Krankheiten zu verhindern oder zumindest zu reduzieren.15 Zudem müssen bestehende Behandlungskonzepte sowie störungs- und sportspezifische Konzepte bei psychischen Erkrankungen wie der Sportsucht oder der Muskeldysmorphie ergänzt werden. Hierfür sind die Aufklärung über die dargestellten Zusammenhänge, Anlaufstellen und Behandlungsmöglichkeiten wie auch die Schulung des Umfeldes (Trainer, ehrenamtlich tätige Personen) in Sportvereinen, in denen vielfach Breitensport (auch mit Wettkampfcharakter) betrieben wird, ein äusserst wichtiger Aspekt. Hinzu kommt, dass die Entwicklung spezifischer klinischer Angebote und Sprechstunden in der Zukunft verstärkt verfolgt werden muss.
Literatur:
1 Hemmeter U, Ngamsri T.: Gesundheitssport. Leading Opinions Neurologie & Psychiatrie 2023; 2: 32-33 2 Claussen MC et al.: Positionspapier – Psychische Gesundheit im Leistungssport. Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP). Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother 2020; 171: w03103 3 Imboden C et al.: Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie: Positionspapier – Körperliche Aktivität und psychische Gesundheit. Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother 2021; 172: w03199 4 Claussen MC, Seifritz E (Hrsg.): Lehrbuch der Sportpsychiatrie und -psychotherapie: Psychische Gesundheit und Erkrankungen im Leistungssport. Bern: Hogrefe AG, 2022 5 Claussen MC, Seifritz E (Hrsg.): Lehrbuch der Sportpsychiatrie und -psychotherapie: Sport und Bewegung bei psychischen Erkrankungen. Bern: Hogrefe AG, voraussichtliche Erscheinung 2023 6 van de Ven K et al.: Substance use in elite and recreational sport. Sports Psychiatry 2022; 1(4): 131-3 7 Gonzalez Hofmann C et al.: Sports psychiatry and medical views on mild traumatic brain injury in competitive sport: a current review and recommendations. Dt. Zeitschrift für Sportmedizin 2021; 22: 203-99 8 Glick ID et al.: Managing psychiatric issues in elite athletes. Psychiatry 2012; 73(5): 640-4 9 Müller-Platz C et al.: Robert Koch Institut (RKI), Gesundheitsberichtserstattung des Bundes, Doping im Freizeit- und Breitensport. 2006; Heft 34. https://edoc.rki.de/bitstream/handle/176904/3186/26Herxag1MT4M_G36.pdf?sequence=1&isAllowed=y 10 Sellman D: Behavioural health disorders rather than behavioural addictions. Aust N Z J Psychiatry 2016; 50(8): 805-6 11 Colledge F, Meyer M: Exercise addiction - status, identification and treatment. Praxis (Bern 1994) 2022; 111(6): 317-21 12 Cook B et al.: Exercise Addiction and Compulsive Exercising: Relationship to Eating Disorders, Substance Use Disorders, and Addictive Disorders. In: Brewerton TD, Baker Dennis A (eds.): Eating Disorders, Addictions and Substance Use Disorders: Research, Clinical and Treatment Perspectives. Berlin, Heidelberg: Springer, 2014. 127-44 13 Nogueira A et al.: Exercise addiction in practitioners of endurance sports: a literature review. Front Psychol 2018; 9: 1484 14 Terry A et al.: The Exercise Addiction Inventory: a new brief screening tool. Addiction Research and Theory 2004; 12: 489-99 15 Ngamsri T et al.: Sport als Prävention und Therapie psychischer Erkrankungen. ARS MEDICI 2020; 7: 224-8
Das könnte Sie auch interessieren:
Das «Feeling Safe»-Programm und eine neue postgraduale Fortbildungsmöglichkeit in der Schweiz
Evidenzbasierte Psychotherapie für Menschen mit Psychosen ist sehr wirksam. Sie gilt heute wie auch die Pharmakotherapie als zentraler Bestandteil einer modernen, Recovery-orientierten ...
Psychedelika in der Psychiatrie
Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn ist wie eine verschlungene Landkarte, auf der die immer gleichen Wege gefahren werden. Diese Strassen sind Ihre Denkmuster, Gefühle und Erinnerungen. ...
Klinische Interventionsstudie bei ME/CFS
An der Klinik für Konsiliarpsychiatrie und Psychosomatik des Universitätsspitals Zürich wird eine Sprechstunde für chronische Fatigue angeboten. Seit 2023 wird hier in Zusammenarbeit mit ...


