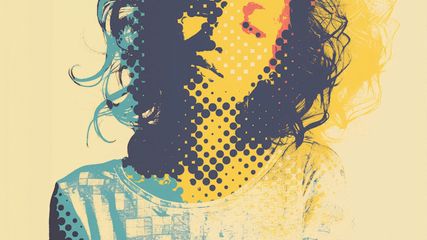Insomnie bei Kopfschmerzen
Autorin:
Prof. Dr. med. Svenja Happe
Klinik für NeurologieKlinik Maria Frieden Telgte
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Einige Inhalte sind aufgrund rechtlicher Bestimmungen nur für registrierte Nutzer bzw. medizinisches Fachpersonal zugänglich.
Sie sind bereits registriert?
Loggen Sie sich mit Ihrem Universimed-Benutzerkonto ein:
Sie sind noch nicht registriert?
Registrieren Sie sich jetzt kostenlos auf universimed.com und erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln, bewerten Sie Inhalte und speichern Sie interessante Beiträge in Ihrem persönlichen Bereich
zum späteren Lesen. Ihre Registrierung ist für alle Unversimed-Portale gültig. (inkl. allgemeineplus.at & med-Diplom.at)
Unter schlafbezogenen Kopfschmerzen versteht man idiopathische Kopfschmerzerkrankungen, die aus dem Schlaf heraus entstehen können und oft mit einer Insomnie einhergehen (gem. ICSD-3). Die Beziehung ist bidirektional. Neueste Empfehlungen hierzu werden hier gemäss der S2k-Leitlinie «Insomnie bei neurologischen Erkrankungen» zusammengefasst.
Schlafbezogene Kopfschmerzen gehören zu den idiopathischen Kopfschmerzerkrankungen, die aus dem Schlaf heraus entstehen können, und gehen oft mit einer Insomnie einher (ICSD-3).1 Hierzu zählen die Migräne, der Clusterkopfschmerz, die chronische paroxysmale Hemikranie und das Hypnic Headache Syndrome (deutsch: primärer schlafgebundener Kopfschmerz). All diese zeigen einen engen Zusammenhang zwischen Schmerzbeginn und Schlaf, deshalb sind sie auch als schlafbezogene Kopfschmerzen im Appendix A in der ICSD-3 genannt. Ausserdem differenziert die International Headache Society (IHS) in der International Classification of Headache Disorders weit über 200 Kopfschmerzformen, die bis auf die eben genannten schlafbezogenen Kopfschmerzen in den meisten Fällen keinen Bezug zum Schlafen aufweisen.2
Die schlafbezogenen Kopfschmerzen gehen häufig mit einer Insomnie einher, hier ist aber die Beziehung bidirektional, sodass von der Insomnie ausgehend auch die Kopfschmerzen zunehmen können. Andere Kopfschmerzarten, die mit einer Schlaferkrankung einhergehen können, wie zum Beispiel Kopfschmerzen beim obstruktiven Schlafapnoesyndrom oder bei Bruxismus, fallen nicht in diese Gruppe.
Was gibt es Neues zu Insomnie bei Kopfschmerzen?
46% aller Patienten mit Migräne sowie 33% aller Patienten mit anderen Kopfschmerzformen haben eine unzureichende Schlafdauer, nur 20% der Kontrollpersonen ohne Kopfschmerzen zeigten ebenfalls eine unzureichende Schlafdauer.3 Circa 9% der Patienten mit Migräne oder mit wahrscheinlicher Migräne leiden unter einer Insomnie.4 Bei einer verminderten Schlafdauer oder Insomnie ist die Migränefrequenz erhöht, sodass sich hier wieder der bidirektionale Zusammenhang zeigt.4,5
Eine andere Studie konnte zeigen, dass circa 50% der Migränepatienten zugleich eine Insomnie aufweisen6 und 13% der Patienten mit isoliertem Kopfschmerz vom Spannungstyp, wohingegen nur 6% der Patienten ohne Kopfschmerz zugleich unter einer Insomnie litten.7 Während bei Patienten mit Spannungskopfschmerz und chronischer Migräne subjektiv eine Insomnie vorlag, konnten objektive Schlafparameter im Vergleich zu Betroffenen ohne die subjektiv auch gleichzeitig angegebene Insomnie nicht unterschiedlich gemessen werden. Hier zeigte sich also nur eine subjektive Schlafstörung, die nicht objektiviert werden konnte.8, 9
Auch Patienten mit Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch zeigten in 44% zugleich eine Insomnie (Shand et al. 2015).10
Wendet man bei den Patienten mit Kopfschmerzen und Insomnie kognitives behaviorales Therapietraining für Insomnie (CBTi) inklusive Schlafhygiene und Schlafrestriktion zweimal wöchentlich für 30 Minuten an, so zeigte sich zunächst 2 Wochen nach Behandlungsende eine nicht signifikante Reduktion der Kopfschmerzfrequenz von nur 27% in der Gruppe, die CBTi anwand, im Vergleich zu 36% in der Kontrollgruppe ohne CBTi. Bei einer Folgeuntersuchung 6 Wochen nach dem Behandlungsende war die Frequenz in der CBTi-Gruppe um 48% und bei der Kontrollgruppe ohne CBTi um 25% gesenkt. Zusätzlich zeigten sich eine signifikante Besserung der Schlafeffizienz und eine selbstberichtete subjektive Besserung der Insomniebeschwerden.
Die CBTi hatte demnach sowohl auf die Kopfschmerzfrequenz als auch auf die Insomnie einen positiven Effekt.11 In einer weiteren Studie zeigte die Einnahme von 3mg Eszopiclon im Vergleich zu Placebo eine signifikant geringere Wachzeit. Am Tag waren Fatigue, Vigilanz und Leistungsvermögen signifikant verbessert. Die Kopfschmerzdauer, -frequenz und -intensität unterschieden sich aber in diesen beiden Gruppen nicht signifikant.12
Die wichtigsten Empfehlungen für Kopfschmerzpatienten mit Insomnie
Neben der symptomorientierten medikamentösen Therapie sollte der Einsatz der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie (CBTi) empfohlen werden (Evidenzgrad A).11 Ausserdem kann Eszopiclon bei zugleich bestehender Insomnie zumindest über 6 Wochen verabreicht werden, da es hierdurch keinen negativen Einfluss auf Kopfschmerzfrequenz, -dauer und -intensität von Migräneattacken gibt (Evidenzgrad B).12
Die Empfehlungen sind zusammengefasst in der S2k-Leitlinie «Insomnie bei neurologischen Erkrankungen» in «DGNeurologie» (2020).13
Diese Zusammenfassung basiert auf einem Vortrag bei der 29. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) im Oktober 2020.
Literatur:
1 American Academy of Sleep Medicine: International Classification of Sleep Disorders – Third Edition (ICSD-3). Rochester, MN: American Sleep Disorders Association 2014 2 Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS): The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia 2018; 38: 1-211 3 Kim J et al.: Insufficient sleep is prevalent among migraineurs: a population-based study. J Headache Pain 2017; 18: 50 4 Kim J et al.: Insomnia in probable migraine: a population-based study. J Headache Pain 2016; 17: 92 5 Song TJ et al.: Short sleep duration and poor sleep quality among migraineurs: a population-based study. Cephalalgia 2018; 38: 855-64 6 Begasse de Dhaem O et al.: Screening for insomnia: an observational study examining sleep disturbances, headache characteristics, and psychiatric symptoms in patients visiting a headache center. Pain Med 2018; 19: 1067-76 7 Kim J et al.: Insomnia in tension-type headache: a population-based study. J Headache Pain 2017; 18: 95 8 Engstrøm M et al.: Sleep quality, arousal and pain thresholds in tension-type headache: a blinded controlled polysomnographic study. Cephalalgia 2014; 34: 455-63 9 Verma R et al.: Study of sleep disorders and polysomnographic evaluation among primary chronic daily headache patients. J Neurosci Rural Pract 2016; 7(Suppl 1): 72-5 10 Shand B et al.; the COMOESTAS CONSORTIUM: Clinical and demographical characteristics of patients with medication overuse headache in Argentina and Chile: analysis of the Latin American Section of COMOESTAS Project. J Headache Pain 2015; 16: 83 11 Smitherman TA et al.: Randomized controlled pilot trial of behavioral insomnia treatment for chronic migraine with comorbid insomnia. Headache 2016; 56: 276-91 12 Spierings EL et al.: Efficacy of treatment of insomnia in migraineurs with eszopiclone (Lunesta®) and its effect on total sleep time, headache frequency, and daytime functioning: a randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, pilot study. Cranio 2015; 33: 115-21 13 Mayer G und Redaktionskomitee: S2k-Leitlinie: Insomnie bei neurologischen Erkrankungen. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Neurologie. DGNeurologie 2020; 3: 395-414
Das könnte Sie auch interessieren:
Die Vergangenheit und Zukunft der biologischen Depressionsbehandlung im Überblick
Trotz erheblicher Fortschritte in der neurobiologischen Forschung basiert die Diagnose der Depression nach wie vor primär auf der klinischen Beurteilung von Symptomen und Verlauf. In ...
Schizophrenie: Therapie durch gezielte Auswahl der Medikamente und Einbindung von Angehörigen und Peers
In den vergangenen Jahren hat es nicht die Erfolge bei der Entwicklung neuer Medikamente gegeben, die sich Schizophrenieforscher gewünscht haben. Trotzdem kann den Patient:innen heute ...
«Hyper-Arousal» statt Schlafmangel: neue Perspektiven bei Insomnie
Bei der Insomnie handelt es sich um eine der häufigsten neuropsychiatrischen Störungen, bei der das subjektive Empfinden teilweise stark von objektiven Messparametern abweicht. In einem ...