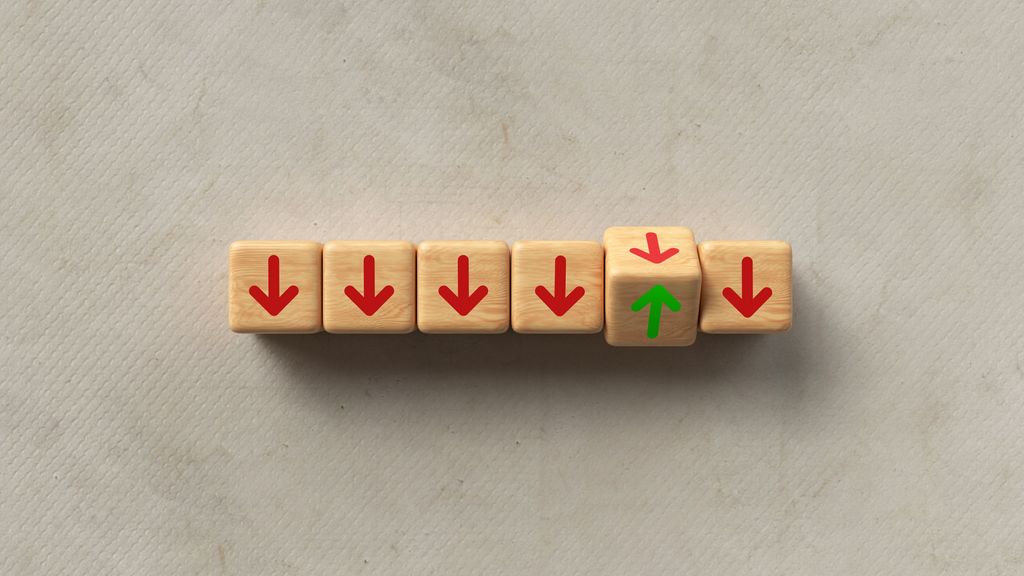
©
Getty Images/iStockphoto
«Für manche ist das Internet der einzige Zugang zur Therapie»
Leading Opinions
30
Min. Lesezeit
09.03.2017
Weiterempfehlen
<p class="article-intro">Ein unkontrollierbarer Drang, sich einzelne Haare oder Haarbüschel auszureissen, bis der Kopf von kahlen Stellen übersät ist: Das ist die Trichotillomanie, die zu den Störungen der Impulskontrolle gehört. Die Krankheit kommt häufiger vor als gedacht, weil viele Betroffene sich schämen, darüber zu reden. Vor allem diesen Betroffenen kann ein Internet-basierter Ansatz helfen, den Prof. Dr. med. Michael Rufer aus Zürich am Kongress der DGPPN in Berlin vorstellte.<sup>1, 2</sup></p>
<hr />
<p class="article-content"><p>Sie tat es immer, wenn sie sich alleine fühlte, beim Fernsehen, beim Lesen, automatisch und unbewusst. Zuerst riss sie nur am Hinterkopf, dann auch an anderen Stellen. Die 25-Jährige, die ihre Geschichte erzählt,<sup>3</sup> litt 13 Jahre lang unter Trichotillomanie. Im Gegensatz zu vielen anderen Betroffenen traut sie sich, offen über ihr Problem zu sprechen.<br /> Trichotillomanie ist gemäss ICD-10 und DSM-IV eine Störung der Impulskontrolle (Tab. 1), hierzu gehören auch Kleptomanie, Pyromanie oder pathologisches Spielen. «Wir haben unterschätzt, wie häufig Trichotillomanie vorkommt, weil viele Betroffene sich für ihr Verhalten schämen und keinem davon erzählen», sagt Prof. Dr. med. Michael Rufer, stellvertretender Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsspital Zürich. «Die Angst, entdeckt zu werden, belastet die Patienten sehr.»<br /><br /> Früher ging man davon aus, dass kaum mehr als ein halbes Promille der Bevölkerung an Trichotillomanie leidet. Die Lebenszeitprävalenz liegt jedoch zwischen 0,6 und 1 % ,<sup>4, 5</sup> wobei Frauen häufiger betroffen sind.<sup>6–8</sup> In der Schweiz sollen es schätzungsweise 35 000 Menschen sein. «Die Betroffenen gehen nicht mehr ins Schwimmbad, vermeiden Friseurbesuche oder gehen bei windigem Wetter nicht mehr ausser Haus, damit man die kahlen Stellen nicht sieht», erzählt Rufer.<br /> Der französische Dermatologe François Henri Hallopeau beschrieb 1889 einen Patienten, der sich büschelweise die Haare ausrupfte, und nannte das zwanghafte Verhalten Trichotillomanie – von den griechischen Begriffen thrix für Haar, tillein für rupfen und mania für Wahnsinn.<sup>9</sup> Aber erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts definierten Ärzte es als eigenständige Krankheit. Die Betroffenen haben häufig etwas Schlimmes in ihrer Kindheit erlebt, Ärger mit den Eltern oder in der Schule, zusätzlich leiden einige unter depressiven Verstimmungen oder Ängsten. «Das Ausreissen lenkt ab, tröstet kurzfristig und lindert die innere Anspannung», sagt Rufer. «Irgendwann brennt sich das Verhalten ein und wird zum Automatismus.» Mit dem Ausreissen regulieren die Betroffenen unangenehme Gefühle, was ihnen meist nicht bewusst ist. Einige empfinden es sogar als genussvoll, das Haar auszurupfen, mit ihm zu spielen oder es in den Mund zu nehmen.</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1701_Weblinks_s32_tab1.jpg" alt="" width="1419" height="986" /></p> <h2>Gute Belege für kognitive Verhaltenstherapie</h2> <p>Alle möglichen Behandlungen werden angeboten, etwa Diäten, Akupunktur oder Kinesiologie, für die aber nicht belegt ist, dass sie helfen. Auch Medikamente wirken nicht genügend. Gute Belege gibt es dagegen für die kognitive Verhaltenstherapie.<sup>10, 11</sup> Hier werden dem Patienten Techniken vermittelt, das zwanghafte Verhalten zu umgehen, das Selbstvertrauen wird gestärkt und traumatische Erlebnisse werden verarbeitet. Zusätzlich kann Entspannungstraining die innere Unruhe lindern. Bei einigen genügen schon einfache Massnahmen, berichtet Rufer: Beim «habit reversal training» machen sich die Betroffenen bewusst, in welchen Situationen sie reissen, und lernen, stattdessen eine andere Bewegung auszuführen – etwa einen Schwamm zu drücken.<sup>12</sup> Ähnlich funktioniert die Entkopplungsmethode, die ein Kollege von Rufer an der Uniklinik in Hamburg mit ihm zusammen entwickelte.<sup>13</sup> Will der Betroffene ein Haar ausreissen, soll er die Bewegung ruckartig zu Ohr, Kinn oder Nase umlenken oder in die Luft schnipsen. «Der Clou daran ist, dass die neue Bewegung anfangs jener des Ausreissens ähnelt», erklärt Rufer. «Das macht es leichter, die Handlung durch die andere zu ersetzen.»<br /> Als Rufer in Trichotillomanie-Foren recherchierte, las er immer wieder, dass viele aus Scham keine Hilfe suchen. «Deshalb haben wir uns überlegt, die Methode über das Internet anzubieten.» In Online- Foren warb sein Team für die Studie. 100 Frauen und 5 Männer machten mit. Am häufigsten rissen die Teilnehmer Haare am Kopf aus, was auch in anderen Studien gezeigt worden war (Abb. 1). Die Hälfte der Teilnehmer sollte Entkopplung erlernen, die andere Entspannungstechniken. Zu Beginn der Studie erfuhren sie, was Trichotillomanie ist und wie die Techniken funktionieren. Jede Woche bekamen sie Motivationsmails. Nach einem Monat rupften sie weniger, und es ging ihnen auch insgesamt psychisch besser, erkennbar an einer Verbesserung der Lebensqualität. Der Erfolg war auch noch nach einem halben Jahr zu sehen.<br /> «Für manche Patienten ist das Internet der einzige Zugang zu einer Therapie», kommentierte Prof. Dr. med. Michael Lucht, Psychiater an der Uni Greifswald und Experte für E-Health in der Psychiatrie. «Die Schwelle, Hilfe zu suchen, ist über das Internet viel geringer.» Es ermögliche den Betroffenen, heimlich eine Behandlung in Anspruch zu nehmen, bestätigt Prof. Dr. med. Gregor Hasler, Chef- Psychiater an der Uniklinik in Bern, und spare auch noch Geld. Ihn habe erstaunt, dass die Methode über das Internet so gut wirkt. «Wir beobachten das aber auch bei Depressionen und Angststörungen», sagt er. «Das Vermitteln von Informationen und einfachen Verhaltenstechniken ist offenbar viel wichtiger, als wir dachten.» In Zeiten des übermässigen Individualismus könne es zudem therapeutisch wirksam sein, dass die Betroffenen sich nicht als Einzelfall fühlten: «Vor dem Computer wird ihnen bewusst: Ich bin nicht allein – auch andere tun das, und wir können es loswerden.»</p> <p><img src="/custom/img/files/files_datafiles_data_Zeitungen_2017_Leading Opinions_Neuro_1701_Weblinks_s32_abb1.jpg" alt="" width="1417" height="824" /></p></p>
<p class="article-quelle">Quelle: DGPPN-Kongress, 23.–26. November 2016, Berlin
</p>
<p class="article-footer">
<a class="literatur" data-toggle="collapse" href="#collapseLiteratur" aria-expanded="false" aria-controls="collapseLiteratur" >Literatur</a>
<div class="collapse" id="collapseLiteratur">
<p><strong>1</strong> Rufer M et al: Symposium S-077: Therapeutische Innovationen: telemedizinische Ansätze in der Psychiatrie und Psychotherapie, 25. 11. 2016, DGPPN-Kongress Berlin <strong>2</strong> Weidt S et al: Psychother Psychosom 2015; 84: 359-67 <strong>3</strong> http:// www.20min.ch/schweiz/news/story/12427384 <strong>4</strong> Christenson GA et al: J Clin Psychiatry 1991; 52: 415-7 <strong>5</strong> Rothbaum BO et al: J Clin Psychiatry 1993; 54: 72-3 <strong>6</strong> Christenson GA, Crow SJ: J Clin Psychiatry 1996; 57(suppl 8): 42-7 <strong>7</strong> Cohen LJ et al: J Clin Psychiatry 1995; 56: 319-26 <strong>8</strong> Christenson GA, Ristvedt SL, Mackenzie TB: Behav Res Ther 1993; 31: 315-20 <strong>9</strong> Hallopeau H: Annales de Dermatologie et de Syphiligraphie 1889; 5: 541-3 <strong>10</strong> Duke DC et al: Clin Psychol Rev 2010; 30: 181-93 <strong>11</strong> Neudecker A, Rufer M: Verhaltenstherapie 2004; 14: 90-8 <strong>12</strong> Azrin NH, Nunn RG: Behav Res Ther 1973; 11: 6 19-28 <strong>13</strong> Moritz S et al: www.uke.de/impulskontrolle</p>
</div>
</p>
Das könnte Sie auch interessieren:
Von RED-S bis zu Essstörungen bei Athletinnen und Athleten
In Chur lud im Februar wieder die Schweizerische Gesellschaft für Sportpsychiatrie und -psychotherapie (SGSPP) zur Jahrestagung ein. Ein grosses Thema dabei waren Ernährungsproblematiken ...
Besonderheiten in Symptomatik, Schwangerschaft und Stillzeit bei Frauen mit ADHS: Diagnostik und Therapie
Mädchen und Frauen mit ADHS erhalten seltener eine Diagnose, da sie weniger durch auffälliges oder externalisierendes Verhalten in Erscheinung treten. Unbehandelt kann ADHS jedoch zu ...
Psychopharmaka bei Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung – Richtlinien und Evidenzen
Menschen mit Störungen der intellektuellen Entwicklung (SIE) erhalten deutlich häufiger Psychopharmaka als Menschen ohne SIE. Neben einer klaren, diagnosebezogenen Indikation werden ...


